Teil B - Leitbild Und Gestaltungskonzept
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
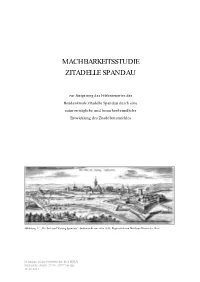
Machbarkeitsstudie Zitadelle Spandau
MACHBARKEITSSTUDIE ZITADELLE SPANDAU zur Steigerung des Erlebniswertes des Baudenkmals Zitadelle Spandau durch eine naturverträgliche und besucherfreundliche Entwicklung des Zitadellenumfeldes Abbildung 1 – „Die Statt und Vestung Spandaw“, Stadtansicht von zirka 1638, Kupferstich von Matthäus Merian der Ältere Henningsen Landschaftsarchitekten BDLA, Schlesische Straße 29/30, 10997 Berlin 18.12.2014 Machbarkeitsstudie Zitadelle Spandau AUFTRAGGEBER: BEZIRKSAMT SPANDAU VON BERLIN UMWELT- UND NATURSCHUTZAMT HERR WEISS CARL-SCHURZ-STR. 8 13597 BERLIN BEARBEITUNG: HENNINGSEN LANDSCHAFTSARCHITEKTEN BDLA JENS HENNINGSEN / EVA ZERJATKE SCHLESISCHE STRASSE 29/30 10997 BERLIN Berlin, den 18.12.2014 Seite 2 von 70 Machbarkeitsstudie Zitadelle Spandau INHALTSVERZEICHNIS 1 Einleitung 6 2 Anlass und Ziel der Machbarkeitsstudie 8 3 Betrachtungsbereiche 9 4 Schutzgebiete 10 4.1 Landschaftsschutzgebiet 10 4.2 Flora-Fauna-Habitat Gebiet 11 4.3 Denkmalbereiche 12 5 Bestehende Planungen 14 5.1 Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 17 14 5.2 Planwerk Westraum Berlin 15 5.3 Steganlagenkonzeption Spandau 16 6 Klärung der Eigentumsverhältnisse und Zuständigkeiten 18 6.1 Entwicklungsziele 18 6.2 Zusammenfassung Maßnahmen 18 6.3 Bestand 19 6.3.1 Tabelle Eigentümer – Bundeswasserstraßenverwaltung 19 6.3.2 Tabelle Eigentümer – Land Berlin 20 6.3.3 Tabelle Eigentümer – Liegenschaftsfonds Berlin GmbH & Co. KG 21 6.3.4 Tabelle Eigentümer – Private 22 7 Standortfindung Fußgängerbrücke und Stege 24 7.1 Entwicklungsziele 24 7.2 Bestandsanalyse 24 7.3 Bestehende Planungen -

Konzept (ISEK) Altstadt Spandau Bericht
Berlin Integriertes Städtebauliches Entwicklungs- konzept (ISEK) Altstadt Spandau Bericht BEZIRKSAMT SPANDAU STADTENTWICKLUNGSAMT CARL-SCHURZ-STRASSE 2-6 13578 BERLIN HERWARTH + HOLZ PLANUNG UND ARCHITEKTUR SCHLESISCHE STRASSE 27 10997 BERLIN Bezirksamt Spandau von Berlin Abt. Bauen, Planen, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Stadtplanung Altstadt Spandau Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) Berlin ISEK Altstadt Spandau Bericht Impressum Auftraggeber: Bezirksamt Spandau von Berlin Abt. Bauen, Planen, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung Stadtentwicklungsamt Fachbereich Stadtplanung Carl-Schurz-Straße 2/6, 13597 Berlin Tel. 030 / 90279 - 2663, Fax 030 / 90279 - 2947 E-Mail: [email protected] Markus Schulte, Nadine Deiwick, Markus Anders in Zusammenwirken mit: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Referat IV C – Städtebauförderung / Stadterneuerung Württembergische Straße 6, 10707 Berlin Tel. 030 90139 – 4936, Fax 030 90139 - 4901 E-Mail: [email protected] Maria Berning, Petra Nothdorf, Martina Mineif, Kai Reichelt Auftragnehmer: Herwarth + Holz Planung und Architektur Schlesische Straße 27, 10997 Berlin Tel. 030 / 61 654 78-0, Fax 030 / 61 654 78-28 E-Mail: [email protected] Carl Herwarth v. Bittenfeld Brigitte Holz Bearbeitung: Victoria Hoedt, Carl Herwarth v. Bittenfeld, Thomas Fenske, Lara Nixdorf, Marion Bauthor, Thea Rath Berlin, 30.04.2015 Die deutsche Sprache bietet keine flüssigen Begriffe, die den weiblichen und männlichen -

Description Basic Data
[ Weitere Angaben: https://brandenburg.museum-digital.de/index.php?t=objekt&oges=47140 vom 28.09.2021 ] Objekt: ”Alt-Spandau” (Flutrinne am Kolk) Museum: MuseumundGalerieFalkensee Falkenhagener Straße 77 14612 Falkensee 03322-22288 Sammlung: Kunstsammlung Museum und Galerie Falkensee / Lorenz Kienzle/Ronka Inventarnummer: K-9.1-8 Oberhammer [CC BY-NC-SA] Beschreibung Die Lithografie ”Alt-Spandau” (Flutrinne am Kolk) ist unten rechts mit ”H. Zank” [Hans Zank] signiert. Der ”Kolk” ist das ¨alteste Siedlungsgebiet und eine Ortslage im Berliner Ortsteil Spandau, nahe der im Ortsteil Haselhorst gelegenen Zitadelle Spandau. Der Kolk grenzt unmittelbar an die Altstadt Spandau. Heute wird das Gebiet Behnitz (fr¨uher auch B¨ahnitz) und Kolk genannt. Kolk heißt dar¨uber hinaus eine Straße innerhalb dieses Gebietes (neben M¨ollentordamm, Hohen Steinweg und Behnitz). Trotzdem hat sich die Bezeichnung Kolk im Volksmund durchgesetzt. Die Straße Kolk liegt auf der fr¨uheren Insel Behnitz, einem der ¨altesten Siedlungsgebiete des Bezirks Spandau. Der Titel des Bildes ”Alt-Spandau” ist postum vergeben und konnte bisher nicht zweifelsfrei dem Werkeverzeichnis von Heinrich Wolter aus dem Jahr 1987 zugeordnet werden. Die vorliegende Arbeit (67,3 cm x 51,5 cm) entspricht in einer Variante den Werkeverzeichnis Nr.: 1744, 1746 und 1747 (Wolter, Heinrich (1987): Hans Zank und Willi Gericke - Zwei bedeutsame Berliner Maler in einer bewegten Zeit der Welt- und Kunstgeschichte, Verlag Galerie Pro Art, Auflage 1, Seite 217-218, Werkeverzeichnis Nr.: 1744, 1746 und 1747). Grunddaten Maße HxB:67,3cmx51,5cm [Rahmengr¨oße] Material/Technik Lithografie Ereignisse Wurde abgebildet (Ort) ... wo Berlin-Spandau Druckplatte hergestellt ... wann 20. Jahrhundert wer Hans Zank (1889-1967) Schlagworte ❼ Altstadt ❼ Druckgrafik ❼ Insel Literatur ❼ Wolter, Heinrich (1987): Hans Zank und Willi Gericke - Zwei bedeutsame Berliner Maler in einer bewegten Zeit der Welt- und Kunstgeschichte, Verlag Galerie Pro Art, Auflage 1. -

SPANDAU Berlin
FIND US IN THE OLD TOWN - SPANDAU We‘re near the market place and above the hobbyshop Rüther. The best way to reach us is: - U-Bahn Altstadt Spandau or Rathaus Spandau - - Berlin-Spandau - -Bus M32, M45, X33, 134, 136, 137 - In addition, there are nearby parking facilities or a multi-storey parking lot (within 5 minutes walking distance at 1 EUR parking fee / hour). OFFICE HOURS YOUR SPECIALIST PRACTICE From April 1st, 2021 FOR CHILD AND Monday to Thursday 9.00 - 12.00 and 14.00 - 18.00 Friday ADOLESCENT PSYCHIATRY 9.00 - 12.00 h and 13.00 - 14.00 & PSYCHOTHERAPY Consultation hours by appointment only. Appointments can be made via e-mail. Breite Str. 30 D – 13597 Berlin www.praxis-schajan.de [email protected] Berlin Tel.: +49 030.351 333 00 WE SUPPORT YOU OUR TEAM The development of children and adolescents is a dynamic We are a team with years of clinical experience. We work process. It can be challenging at times and sometimes also with a team of medical specialists, psychologists and social overwhelming for those involved. workers. We are very familiar with the care and support system in Berlin and Brandenburg. We offer children, adolescents and their families a compre- hensive and holistic treatment concept within the framework of the social psychiatric agreement. Parishad Schajan Specialist for Child and Adolescent Psychiatry & Psychotherapy Anja Teschner Psychologist „Diego“ We first discuss the current situation in a personal meeting. Our trained and certified Together we develop an individual and needs-based treat- therapy dog ment plan. -

AUF NACH SPANDAU Urlaub in Berlin B E R L in Spandauer E R Tegeler M a U Forst Bürgerablage E See
Entdeckungsreise AUF NACH SPANDAU Urlaub in Berlin B e r l in Spandauer e r Tegeler M a u Forst Bürgerablage e See r w w e e Neuendorfer Allee g g Spandauer Forst Bahnhof REINICKEN- S ch Falkenhagen ö H Bushaltestelle n ev. Johannesstiftw DORF a ld e Berliner Camping Club e. V. r INHALT A l le S e S-Bahn Segel-Club Spandau e. V. Falkenhöh H U U-Bahn Jungfernheide Havelland-Radweg An Havel und Spree – Im Herzen Spandaus 4 P Parkplatz .............. Hakenfelde Havel-Radweg Stefans Hakenfelde Information Fahrradverleih Maselakepark Hohenzollernpark Spandau ahoi! Leinen los...........................................10 Wasserfreunde Spandau 04 e. V. S c h Falkenseer Chaussee ö n w a Havel Falkenhagener l d Grill-Boot Spandaus grüne Seiten – Raus in die Natur..............14 e r D S t a r u Feld a m ß Bahnhof e s t Eiswerderra ß Hotel und City Camping Berlin 1 Altstadthafen Spandau e Albrechtshof Bootshaus Hettler & Lange Eldo-RAD-o – Unterwegs mit dem Drahtesel.............20 Seegefelder Straße Kiesteich Historisches Fahrradmuseum Spandauer See Krienickepark Hav H elland- Radw eg Wasserfreunde Spandau 04 e. V. Westernstadt Siemensstadt Spektegrünzug Zitadelle Haselhorst Teilungsstory – Hart an der Grenze.............................26 Berliner Mauerweg U Am Juliusturm Siemensstadt Bahnhof U U Nonnendammallee Falkenhagener Straße Münsingerpark Schönwalder Straße U Felds Staaken Altstadt traße Bahnhof U Spandau – Peng! IndustrielleMüllerstraße VergangenheitKörnerstraße ............30 Brunsbütteler Damm e Spandau ß S a e Fahrradverleih Spiegelturm -

City Guide Berlin Und Potsdam 8. Auflage
CityGuide „Tipps für jede Generation und Interessenlage“ Potsdam GEO Spezial mit Potsdam BERLIN mit im KaDeWe Seite 236 Das bunteste Gedrängel im Kiez: Kristine Jaath der Türkenmarkt am Maybachufer Seite 266 BERLIN Handbuch für die neue, alte Hauptstadt Berlin: eintauchen und entdecken 001-011b.qxd 29.07.2009 11:14 Seite 1 Reisetipps A–Z Berlin und Bewohner Berlin-Mitte Berlin-Tiergarten 310be Foto: kj Foto: 310be Rund ums Zentrum Ausflüge Potsdam Anhang Stadtatlas 001-011b.qxd 29.07.2009 11:14 Seite 3 Kristine Jaath Berlin mit Potsdam „Ich möchte Weltbürger sein, überall zu Hause und – was noch entscheidender ist – überall unterwegs.“ Erasmus von Rotterdam 001-011b.qxd 29.07.2009 11:14 Seite 4 Impressum Kristine Jaath Berlin mit Potsdam erschienen im REISE KNOW-HOW Verlag Peter Rump GmbH Osnabrücker Straße 79, 33649 Bielefeld © Peter Rump 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008 8., neu bearbeitete und komplett aktualisierte Auflage 2009 Alle Rechte vorbehalten. Gestaltung Umschlag: M. Schömann, P. Rump (Layout); Christina Hohenhoff (Realisierung) Inhalt: Günter Pawlak (Layout); Barbara Bossinger (Realisierung) Karten: Catherine Raisin, der Verlag Umschlagklappe hinten: BVG (Berliner Verkehrsbetriebe) Fotos: Kristine Jaath (kj), Christian Prager (cp; S. 117), Umschlagfoto: www.fotolia.com © Bernd Kröger (Fahrradfahrer am Brandenburger Tor) Lektorat (Aktualisierung): Christina Hohenhoff Druck und Bindung Media Print, Paderborn ISBN 978-3-8317-1858-0 PRINTED IN GERMANY Dieses Buch ist erhältlich in jeder Buchhandlung Deutschlands, der Schweiz, Wir freuen uns über Kritik, Kommentare und Österreichs, Belgiens und der Niederlande. Verbesserungsvorschläge, gerne per E-Mail an Bitte informieren Sie Ihren Buchhändler [email protected]. über folgende Bezugsadressen: Alle Informationen in diesem Buch sind von der Deutschland Autorin mit größter Sorgfalt gesammelt Prolit GmbH, Postfach 9, und vom Lektorat des Verlages gewissenhaft D-35463 Fernwald (Annerod) bearbeitet und überprüft worden. -

70 Heveller Aug 2015.Qxp
HEvEllEr Beiderseits der Havel – Magazin für den Norden von Potsdam 6. Jahrgang/Nummer 70 • August 2015 Kostenlos zum Mitnehmen Der Mensch hat die Gabe, aus jedem Ort ein Paradies zu machen foto+rechte MAGDA G. Abbruch und Neubau: Ro- bex macht Ernst auf der Neu Fahrländer Insel. Seite 19 Die Unterkunft in der Waldsiedlung ist fertig – inzwischen sind die ersten Flüchtlinge angekommen. Seite 23 Heveller · Seite 2 Anzeigen August 2015 im Internet: www.heveller-magazin.de im Internet: HEvELLER NEU: NEU: August 2015 Editorial Seite 3 · Heveller Inhalt Liebe Leserinnen, liebe Leser, Seiten 4 – 5 eine wenig geliebte Zeitspanne viel zu sehen und zu fotografieren. Region: Die Straßensperrungen für Journalisten sind die Wochen, Schicken Sie uns doch einfach Ihre in der Urlaubszeit wenn die Sommerferien begonnen bestes Foto. Wir werden sie dann haben und man überall mit der Fra- auf unserer Internetseite www.he- Seiten 6 – 7 ge konfrontiert wird: Na, schon Ur- veller-magazin.de veröffentlichen – laub gehabt? und die ganze Welt kann sich mit Region Natürlich nicht. In der Branche Ihnen freuen. gilt es, das Sommerloch zu füllen. Seiten 8 – 9 Die Politik (auch die kleine in den Nicht so erfreulich ist das, was die Städten und Ortsteilen) macht Pause, existenziellen Probleme in der Welt Historie die Ämter, Institutionen, Vereine, ja nun auch nach Groß Glienicke ge- sogar kleine Firmen „fahren“ mit bracht haben: die ersten Flüchtlinge Seiten 10 – 14 Notbesetzung, – und jedes Ereignis, sind angekommen. Sie haben auch das trotzdem stattfindet, bekommt eine weite „Reise“ hinter sich – nicht, Region größere Wertigkeit. So entstehen die dass man ganze Seiten mit Fotos um etwas zu erleben, sondern um Sommerlochgeschichten. -

Festschrift Zu 750 Jahren Kladow
750 Jahre Kladow Festschrift Kladower Forum e. V. Küchenstudio Cladow Einbauküchen vom Fachhändler mit Geräten von Professionelle Beratung, Planung und Montage sowie ein individueller Kundendienst – alles aus einer Hand! Wir gestalten Ihre vorhandene Küche um – mit neuen Arbeitsplatten, moderner Spüle und hochwertigen Elektrogeräten. Mit unserer 3D-Software erhalten Sie eine genaue Vorstellung von Ihrer neuen Küche. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! © nobilia Küchenstudio Cladow Einbauküchen ▪ Türen ▪ Fenster Treppen ▪ Möbel ▪ Granit ▪ Edelstahl Parnemannweg 31 Parnemannweg 31 14089 Berlin 14089 Berlin 030 364 33 510 030 364 33 510 [email protected] [email protected] www.kuechenstudio-cladow.de www.seven-project.de 750 Jahre Kladow 1267 – 2017 Kladower Forum e. V. Berlin-Kladow 2017 2 750 Jahre Kladow · 1267 - 2017 · Festschrift Herausgeber: © Kladower Forum e. V. www.kladower-forum.de p. A. Rainer Nitsch Krohnweg 7, 14089 Berlin [email protected] Redaktion: Rainer Nitsch (Koordination), Hartmann Baumgarten, Eckart Elsner, Hans-Jürgen Lödden, Peter Streubel, Renate Wenzel Umschlagbild: Luftaufnahme Panorama Kladows mit Insel Imchen 1990. Foto: Rainer Nitsch LOGO zur 750-Jahrfeier Kladows: Stellwerk Grafic concepte+marketing [email protected] Layout & Druck: oberüber druck & werbung www.oberueber-druck.de Jede Art der Reproduktion oder Vervielfältigung des ganzen Buches oder von Teilen bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Herausgebers. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung der Autorin bzw. -

Studie Zum Solarstrompotenzial Der Altstadt Spandau Impressum
Studie zum Solarstrompotenzial der Altstadt Spandau Impressum Im Auftrag der Leitstelle für Nachhaltigkeit und Klimaschutz Corina Weber (Leitung) Angelika Haaser (Klimaschutzmanagerin) Bezirksamt Spandau von Berlin Carl-Schurz-Str. 2/6 13597 Berlin Erstellt von Reiner Lemoine Institut www.reiner-lemoine-institut.de [email protected] Rudower Chaussee 12 12489 Berlin Autorinnen Birgit Schachler Sabine Haas Sarah Berendes Mascha Richter September 2020 Finanziert im Rahmen der Städtebauförderung Bildnachweise Titelbild: Senat für Stadtentwicklung und Wohnen Alle weiteren Fotos in der Studie: Reiner Lemoine Institut SolarCity Spandau Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis II Zusammenfassung III 1 Ausgangssituation 1 2 Bestandserfassung 2 2.1 Methodik . 2 2.1.1 Bestimmung des Stromverbrauchs . 2 2.1.2 Bestimmung von solar erzeugter Energie . 5 2.2 Ergebnisse . 6 2.2.1 Stromverbrauch . 6 2.2.2 Solar erzeugte Energie . 10 3 Potenzialerhebung für die Erzeugung von Solarstrom 16 3.1 Methodik . 16 3.1.1 Erstellung eines Kriterienkatalogs . 16 3.1.2 Bestimmung des PV-Potenzials . 22 3.2 Ergebnisse . 23 4 Ertragsprognose für acht ausgewählte Gebäude 25 4.1 Methodik . 26 4.1.1 Abschätzung von Anlagengröße und erwartetem Ertrag . 26 4.1.2 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung . 27 4.2 Ergebnisse der Detailbetrachtungen . 32 4.2.1 Mauerstraße 6 (Kulturhaus) . 33 4.2.2 Carl-Schurz-Straße 17 (Volkshochschule) . 35 4.2.3 Moritzstraße 17 (Musikschule) . 36 4.2.4 Lindenufer 29 . 37 4.2.5 Ritterstraße 7 . 39 4.2.6 Reformationsplatz 6 . 41 4.2.7 Reformationsplatz -

Der Computer Und Die Slawen: Beispiele Zur Anwendung
www.ssoar.info Der Computer und die Slawen: Beispiele zur Anwendung quantitativer Methoden in der Erforschung der Geschichte der Mark-Brandenburg Kamke, Hans-Ulrich Veröffentlichungsversion / Published Version Zeitschriftenartikel / journal article Zur Verfügung gestellt in Kooperation mit / provided in cooperation with: GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Kamke, H.-U. (1991). Der Computer und die Slawen: Beispiele zur Anwendung quantitativer Methoden in der Erforschung der Geschichte der Mark-Brandenburg. Historical Social Research, 16(1), 90-97. https://doi.org/10.12759/ hsr.16.1991.1.90-97 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer CC BY Lizenz (Namensnennung) zur This document is made available under a CC BY Licence Verfügung gestellt. Nähere Auskünfte zu den CC-Lizenzen finden (Attribution). For more Information see: Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de Diese Version ist zitierbar unter / This version is citable under: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-51478 Historical Social Research, Vol. 16 — 1991 — No. 1, 90-97 COMPUTER SECTION Der Computer und die Slawen Beispiele zur Anwendung quantitativer Methoden in der Erforschung der Geschichte der Mark Brandenburg(1) Hans-Ulrich Kamke* Von 1977/78 bis 1982 fand sich am Fachbereich Geschichtswissenschaften der FU Berlin eine Gruppe von Wissenschaftlern verschiedener histori• scher Disziplinen (Siedlungsgeschichte, Siedlungsgeographie, Mittelalter• archäologie, Rechtsgeschichte, historische Sprachwissenschaft) mit dem Ziel zusammen, Fragen der slawisch-deutschen Symbiose im Bereich der hochmittelalterlichen deutschen Ostsiedlung (2) umfassend, d.h. auf der Basis aller in Betracht kommender Quellengruppen mit den ihnen ent• sprechenden Methoden komplex zu betrachten. -
Going Local Berlin
visitBerlin.com 25 00 (0)30-25 +49 Berlin’s amazing neighbourhoods! Hotels, Tickets, Info Tickets, Hotels, Alte Fasanerie Lübars Tangoloft Park at Gleisdreieck 2 Lübars, with its countryside and late 4 The real deal in 8 A spreading green park directly Explore Berlin’s 12 boroughs with a mass eighteenth-century baroque church, tango – in the at Potsdamer Platz! Perfect for has retained its rural village charm. Tango Loft Mitte, a a picnic or beach volleyball – or of top tips in one app. And there's fun for all the family at the Alte hidden gem in a court- just to stretch out and let the sun Panke Trail Fasanerie farm – with activities, animals yard loft in Wedding. do the rest! and plants, and a playground! Gerichtstraße 23 Berlin’s heart beats in the “kiez” – in the neighbourhoods! This Buddhist House Möckernstraße26, 10963 Berlin c Pankow for purists! If you have enough time to Fasanerie 10, 13469 Berlin 13347 Berlin gruen-berlin.de/gleisdreieck explore a very different side of Pankow, just tangoloft-berlin.de city map and companion Going Local Berlin app are packed alte-fasanerie-luebars.de 3 Meditate – in the Buddhist walk or bike along the banks of the gentle River House in Frohnau with ideas and insights to make your Berlin stay even more fun! Panke. More a stream than a torrent, the Panke gave Edelhofdamm 54, 13465 Berlin Uferhallen and this borough its name. The trail is well sign-posted Barnimstraße Zeiss-Großplanetarium das-buddhistische-haus.de Uferstudios and takes you around 14 km through Pankow. -
Spandau Bei Berlin
AIV Architekten- und Ingenieur-VereinSchinkel-Wettbewerb zu Berlin e.V. | seit 1824 AIV-SCHINKEL-WETTBEWERB2014 2014 SPANDAU BEI BERLIN AUSLOBUNG ZUM 159. WETTBEWERB AUSLOBUNG 23. SEPTEMBER 2013 1 AIV Schinkel-Wettbewerb 2014 Architekten- und Ingenieur-Verein zu Berlin e.V. | seit 1824 Ideen- und Förderwettbewerb für junge Städtebauer Landschaftsarchitekten, Architekten, Ingenieure, und Künstler Auslobung September 2013 (Stand: 23.09.2013) Wettbewerbsdurchführung Architekten- und Ingenieur-Verein zu Berlin e.V. Vorstand mit Schinkel-Ausschuss Bleibtreustraße 33 10707 Berlin www.aiv-berlin.de AUSLOBUNG 23. SEPTEMBER 2013 2 AIV Schinkel-Wettbewerb 2014 Anmerkung Im Sinne einer besseren Lesbarkeit wird im Auslobungstext auf die Ergänzung der weiblichen Form verzichtet. An dieser Stelle sei jedoch ausdrücklich betont, dass in der Regel beide Geschlechter gemeint sind. AUSLOBUNG 23. SEPTEMBER 2013 3 AIV SPANDAU BEI BERLIN Schinkel-Wettbewerb 2014 Vorwort Verstehen, indem man entwirft – das ist der Impuls des AIV-Schinkel-Wett- bewerbs Jahr für Jahr. Der Architekten- und Ingenieur- Verein zu Berlin schafft gemeinsam mit Förderern, Stiftern, Juroren und Hochschulen ein Netzwerk un- terschiedlicher Disziplinen, in dem Antworten auf planerische und gestalterische Fragen gegeben und gleichzeitig junge Architekten, Ingenieure und Künstler in ihrer fachlichen Entwicklung gefördert werden. Mittel hierzu ist der Wettbe- werbsbeitrag, der persönliche Entwurf. Die Aufgabenstellung und die Wahl des Kontextes sollen eine Auseinandersetzung mit komplexen Zusammenhängen und fachübergreifenden Sichtweisen initiieren. Im vergangenen Jahr wurden 154 Wettbewerbsarbeiten von mehr als 360 Teilnehmern aus Deutschland, Polen, Österreich, der Schweiz, sogar aus Russland und der Ukraine eingereicht. Nachdem im Rahmen des 158. AIV-Schinkel-Wettbewerbs die Nachnutzung des Tegeler Flughafengebiets thematisiert wurde, soll der Fokus des nächsten Wett- bewerbes auf Spandau an der Havel liegen: Die Aufgabe nähert sich dem Standort unter unterschiedlichen Blickwinkeln.