Der Computer Und Die Slawen: Beispiele Zur Anwendung
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

181222 ICOMOS Heft LXVII Layout 1 11.01.19 09:15 Seite 94
181222 ICOMOS Heft LXVII_Layout 1 11.01.19 09:15 Seite 94 Circular Villages: Reflections Based on a Global Comparative Analysis Britta Rudolff, Eva Battis and Michael Schmidt 1 Introduction into the surrounding agricultural landscape with fan-shaped farmsteads. The villages’ ground plan and harmonious ap- This paper summarises the findings of a comparative analysis pearance is significantly characterised by a small number of undertaken with a view towards a World Heritage nomination detached-standing vernacular hall houses, predominantly of of the so-called Rundling villages in the Wendland, Germany. the 18th and 19th centuries, whose decorated timber-frame Compared with other similar rural settlement typologies these gables are directed towards the open central village space. are characterised by equally approaching a round ground plan. The site selected for nomination is composed exclusively of The identified Outstanding Universal Value of the Wendland Rundling villages embedded in cultured farmland.1 Rundlinge (see previous paper by Schmidt et al.) selected Given that the settlement landscape and village typology for World Heritage nomination derives from their settlement were found to be the most outstanding features of the Wend- landscape and village typology. The typology developed over land Rundlinge, a typological analysis is the centre piece of the centuries and today features a unique village footprint the comparative study and is synthesised in this paper. This approaching a regular circular shape which extends radially study focuses on villages of more or less comparable settle- Fig. 2.1 The Rundling village Satemin (©IHM, photographer: Eva Battis) 94 ICOMOS · Hefte des Deutschen Nationalkomitees LXVII 181222 ICOMOS Heft LXVII_Layout 1 11.01.19 09:15 Seite 95 Circular Villages: Reflections Based on a Global Comparative Analysis Fig. -

Berlin - Wikipedia
Berlin - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Berlin Coordinates: 52°30′26″N 13°8′45″E Berlin From Wikipedia, the free encyclopedia Berlin (/bɜːrˈlɪn, ˌbɜːr-/, German: [bɛɐ̯ˈliːn]) is the capital and the largest city of Germany as well as one of its 16 Berlin constituent states, Berlin-Brandenburg. With a State of Germany population of approximately 3.7 million,[4] Berlin is the most populous city proper in the European Union and the sixth most populous urban area in the European Union.[5] Located in northeastern Germany on the banks of the rivers Spree and Havel, it is the centre of the Berlin- Brandenburg Metropolitan Region, which has roughly 6 million residents from more than 180 nations[6][7][8][9], making it the sixth most populous urban area in the European Union.[5] Due to its location in the European Plain, Berlin is influenced by a temperate seasonal climate. Around one- third of the city's area is composed of forests, parks, gardens, rivers, canals and lakes.[10] First documented in the 13th century and situated at the crossing of two important historic trade routes,[11] Berlin became the capital of the Margraviate of Brandenburg (1417–1701), the Kingdom of Prussia (1701–1918), the German Empire (1871–1918), the Weimar Republic (1919–1933) and the Third Reich (1933–1945).[12] Berlin in the 1920s was the third largest municipality in the world.[13] After World War II and its subsequent occupation by the victorious countries, the city was divided; East Berlin was declared capital of East Germany, while West Berlin became a de facto West German exclave, surrounded by the Berlin Wall [14] (1961–1989) and East German territory. -
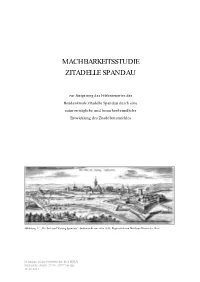
Machbarkeitsstudie Zitadelle Spandau
MACHBARKEITSSTUDIE ZITADELLE SPANDAU zur Steigerung des Erlebniswertes des Baudenkmals Zitadelle Spandau durch eine naturverträgliche und besucherfreundliche Entwicklung des Zitadellenumfeldes Abbildung 1 – „Die Statt und Vestung Spandaw“, Stadtansicht von zirka 1638, Kupferstich von Matthäus Merian der Ältere Henningsen Landschaftsarchitekten BDLA, Schlesische Straße 29/30, 10997 Berlin 18.12.2014 Machbarkeitsstudie Zitadelle Spandau AUFTRAGGEBER: BEZIRKSAMT SPANDAU VON BERLIN UMWELT- UND NATURSCHUTZAMT HERR WEISS CARL-SCHURZ-STR. 8 13597 BERLIN BEARBEITUNG: HENNINGSEN LANDSCHAFTSARCHITEKTEN BDLA JENS HENNINGSEN / EVA ZERJATKE SCHLESISCHE STRASSE 29/30 10997 BERLIN Berlin, den 18.12.2014 Seite 2 von 70 Machbarkeitsstudie Zitadelle Spandau INHALTSVERZEICHNIS 1 Einleitung 6 2 Anlass und Ziel der Machbarkeitsstudie 8 3 Betrachtungsbereiche 9 4 Schutzgebiete 10 4.1 Landschaftsschutzgebiet 10 4.2 Flora-Fauna-Habitat Gebiet 11 4.3 Denkmalbereiche 12 5 Bestehende Planungen 14 5.1 Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 17 14 5.2 Planwerk Westraum Berlin 15 5.3 Steganlagenkonzeption Spandau 16 6 Klärung der Eigentumsverhältnisse und Zuständigkeiten 18 6.1 Entwicklungsziele 18 6.2 Zusammenfassung Maßnahmen 18 6.3 Bestand 19 6.3.1 Tabelle Eigentümer – Bundeswasserstraßenverwaltung 19 6.3.2 Tabelle Eigentümer – Land Berlin 20 6.3.3 Tabelle Eigentümer – Liegenschaftsfonds Berlin GmbH & Co. KG 21 6.3.4 Tabelle Eigentümer – Private 22 7 Standortfindung Fußgängerbrücke und Stege 24 7.1 Entwicklungsziele 24 7.2 Bestandsanalyse 24 7.3 Bestehende Planungen -

Auf Dem Weg Zum Germania Slavica-Konzept
Sebastian Brather, Christine Kratzke. Auf dem Weg zum -Konzept: Perspektiven von Geschichtswissenschaft, Archäologie, Onomastik und Kunstgeschichte seit dem 19. Jahrhundert. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2005. 210 S. broschiert, ISBN 978-3-86583-108-8. Reviewed by Gerson H. Jeute Published on H-Soz-u-Kult (August, 2006) "Europa [zu] bauen", wie es als Stichwort in "Geisteswissenschaftlichen Zentrum Geschichte der Geschichtswissenschaft mehr und mehr auf‐ und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO)" in Leipzig taucht, ist ohne Regionen nicht denkbar. Diese bil‐ im Jahre 2002, jedoch profitieren die Beiträge den in ihrer unglaublichen Vielfalt das geeignete auch von Publikationen die später erschienen. Fundament für eine differenzierte Betrachtung Ernst Eichler (Methoden und Ergebnisse der der Vergangenheit und eine innovative Gestal‐ Namenforschung in der Germania Slavica, S. tung der Zukunft des Kontinents. Eine dieser Regi‐ 61-72) gibt einen Überblick über die Leipziger uni‐ onen ist die Germania Slavica, der westliche Rand versitäre Namenforschung der Nachkriegszeit, Ostmitteleuropas im Mittelalter, die in jener Zeit deren Schwerpunkte siedlungs- und namenge‐ vor allem durch das Aufeinandertreffen von Sla‐ schichtliche Arbeiten waren und die darüber hin‐ wen und Deutschen bestimmt war und die somit aus um populärwissenschaftliche Darstellungen eine entscheidende Rolle bei der hochmittelalter‐ bemüht war. Für die anderen Fächer der Germa‐ lichen Transformation in Europa spielte. Die Un‐ nia Slavica-Forschung sind vor allem die Orts- tersuchung -

Konzept (ISEK) Altstadt Spandau Bericht
Berlin Integriertes Städtebauliches Entwicklungs- konzept (ISEK) Altstadt Spandau Bericht BEZIRKSAMT SPANDAU STADTENTWICKLUNGSAMT CARL-SCHURZ-STRASSE 2-6 13578 BERLIN HERWARTH + HOLZ PLANUNG UND ARCHITEKTUR SCHLESISCHE STRASSE 27 10997 BERLIN Bezirksamt Spandau von Berlin Abt. Bauen, Planen, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Stadtplanung Altstadt Spandau Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) Berlin ISEK Altstadt Spandau Bericht Impressum Auftraggeber: Bezirksamt Spandau von Berlin Abt. Bauen, Planen, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung Stadtentwicklungsamt Fachbereich Stadtplanung Carl-Schurz-Straße 2/6, 13597 Berlin Tel. 030 / 90279 - 2663, Fax 030 / 90279 - 2947 E-Mail: [email protected] Markus Schulte, Nadine Deiwick, Markus Anders in Zusammenwirken mit: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Referat IV C – Städtebauförderung / Stadterneuerung Württembergische Straße 6, 10707 Berlin Tel. 030 90139 – 4936, Fax 030 90139 - 4901 E-Mail: [email protected] Maria Berning, Petra Nothdorf, Martina Mineif, Kai Reichelt Auftragnehmer: Herwarth + Holz Planung und Architektur Schlesische Straße 27, 10997 Berlin Tel. 030 / 61 654 78-0, Fax 030 / 61 654 78-28 E-Mail: [email protected] Carl Herwarth v. Bittenfeld Brigitte Holz Bearbeitung: Victoria Hoedt, Carl Herwarth v. Bittenfeld, Thomas Fenske, Lara Nixdorf, Marion Bauthor, Thea Rath Berlin, 30.04.2015 Die deutsche Sprache bietet keine flüssigen Begriffe, die den weiblichen und männlichen -

Description Basic Data
[ Weitere Angaben: https://brandenburg.museum-digital.de/index.php?t=objekt&oges=47140 vom 28.09.2021 ] Objekt: ”Alt-Spandau” (Flutrinne am Kolk) Museum: MuseumundGalerieFalkensee Falkenhagener Straße 77 14612 Falkensee 03322-22288 Sammlung: Kunstsammlung Museum und Galerie Falkensee / Lorenz Kienzle/Ronka Inventarnummer: K-9.1-8 Oberhammer [CC BY-NC-SA] Beschreibung Die Lithografie ”Alt-Spandau” (Flutrinne am Kolk) ist unten rechts mit ”H. Zank” [Hans Zank] signiert. Der ”Kolk” ist das ¨alteste Siedlungsgebiet und eine Ortslage im Berliner Ortsteil Spandau, nahe der im Ortsteil Haselhorst gelegenen Zitadelle Spandau. Der Kolk grenzt unmittelbar an die Altstadt Spandau. Heute wird das Gebiet Behnitz (fr¨uher auch B¨ahnitz) und Kolk genannt. Kolk heißt dar¨uber hinaus eine Straße innerhalb dieses Gebietes (neben M¨ollentordamm, Hohen Steinweg und Behnitz). Trotzdem hat sich die Bezeichnung Kolk im Volksmund durchgesetzt. Die Straße Kolk liegt auf der fr¨uheren Insel Behnitz, einem der ¨altesten Siedlungsgebiete des Bezirks Spandau. Der Titel des Bildes ”Alt-Spandau” ist postum vergeben und konnte bisher nicht zweifelsfrei dem Werkeverzeichnis von Heinrich Wolter aus dem Jahr 1987 zugeordnet werden. Die vorliegende Arbeit (67,3 cm x 51,5 cm) entspricht in einer Variante den Werkeverzeichnis Nr.: 1744, 1746 und 1747 (Wolter, Heinrich (1987): Hans Zank und Willi Gericke - Zwei bedeutsame Berliner Maler in einer bewegten Zeit der Welt- und Kunstgeschichte, Verlag Galerie Pro Art, Auflage 1, Seite 217-218, Werkeverzeichnis Nr.: 1744, 1746 und 1747). Grunddaten Maße HxB:67,3cmx51,5cm [Rahmengr¨oße] Material/Technik Lithografie Ereignisse Wurde abgebildet (Ort) ... wo Berlin-Spandau Druckplatte hergestellt ... wann 20. Jahrhundert wer Hans Zank (1889-1967) Schlagworte ❼ Altstadt ❼ Druckgrafik ❼ Insel Literatur ❼ Wolter, Heinrich (1987): Hans Zank und Willi Gericke - Zwei bedeutsame Berliner Maler in einer bewegten Zeit der Welt- und Kunstgeschichte, Verlag Galerie Pro Art, Auflage 1. -

SPANDAU Berlin
FIND US IN THE OLD TOWN - SPANDAU We‘re near the market place and above the hobbyshop Rüther. The best way to reach us is: - U-Bahn Altstadt Spandau or Rathaus Spandau - - Berlin-Spandau - -Bus M32, M45, X33, 134, 136, 137 - In addition, there are nearby parking facilities or a multi-storey parking lot (within 5 minutes walking distance at 1 EUR parking fee / hour). OFFICE HOURS YOUR SPECIALIST PRACTICE From April 1st, 2021 FOR CHILD AND Monday to Thursday 9.00 - 12.00 and 14.00 - 18.00 Friday ADOLESCENT PSYCHIATRY 9.00 - 12.00 h and 13.00 - 14.00 & PSYCHOTHERAPY Consultation hours by appointment only. Appointments can be made via e-mail. Breite Str. 30 D – 13597 Berlin www.praxis-schajan.de [email protected] Berlin Tel.: +49 030.351 333 00 WE SUPPORT YOU OUR TEAM The development of children and adolescents is a dynamic We are a team with years of clinical experience. We work process. It can be challenging at times and sometimes also with a team of medical specialists, psychologists and social overwhelming for those involved. workers. We are very familiar with the care and support system in Berlin and Brandenburg. We offer children, adolescents and their families a compre- hensive and holistic treatment concept within the framework of the social psychiatric agreement. Parishad Schajan Specialist for Child and Adolescent Psychiatry & Psychotherapy Anja Teschner Psychologist „Diego“ We first discuss the current situation in a personal meeting. Our trained and certified Together we develop an individual and needs-based treat- therapy dog ment plan. -

Von Der Sclavinia Zur Germania Slavica : Akkulturation Und Transformation
Von der Sclavinia zur Germania Slavica : Akkulturation und Transformation VON CHRISTIAN LÜBKE (1) Begriffsklärung und Forschungsgeschichte S. 207. – (2) Die Ausgangslage S. 212. – (3) Interaktionen und ihre Auswirkungen S. 216. – (4) Beschleunigung und Ergebnisse des kulturellen Wandels S. 227. (1) Begriffsklärung und Forschungsgeschichte Nimmt man den Verlauf des Mittelalters in denjenigen Landschaften in den Blick, die allmählich zu Deutschland zusammenwuchsen, dann sind in keiner Region ähnlich tief greifende und mit Akkulturationsphänomenen verbundene Wandlungs- oder Transfor- mationsprozesse zu beobachten, wie in der von der neueren historischen Forschung so genannten Germania Slavica. Es geht dabei, wie im Titel dieses Beitrages konkretisiert, um den Wandel von einer durch die Quellen begrifflich bezeugten Sclavinia1) zu einer mit dem Attribut »slavisch« definierten Germania, die aber in der Kombination Germa- nia Slavica lediglich einen wissenschaftlichen Hilfsbegriff darstellt, der erst nach der Mitte des 20. Jahrhunderts in Gebrauch kam2). Beide Bezeichnungen bedeuten jedenfalls 1) Eine umfassende Zusammenstellung der mit den Slaven verbundenen Erwähnungen in den lateini- schen Quellen bis zum Ende des 9. Jahrhunderts geben Jutta Reisinger/Günter Sowa, Das Ethnikon Sclavi in den lateinischen Quellen bis zum Jahr 900 (Glossar zur frühmittelalterlichen Geschichte im östlichen Europa, Beiheft 6), Stuttgart 1990. 2) Dieser Beitrag thematisiert überblicksartig den Zeitraum der Begegnung von »deutsch« und »sla- visch« sprechenden Individuen und Gemeinschaften von den ersten Anfängen bis zur weitgehenden sprachlichen »Germanisierung« im Gefolge des mit intensiven Migrationsbewegungen verbundenen hochmittelalterlichen Landesausbaus, wobei der langen Vorgeschichte dieser letzten Etappe ein in der Forschungsliteratur gewöhnlich nicht üblicher Platz eingeräumt wird. Dabei bleibt aber unbestritten, dass im Zusammenhang des Phänomens der seit dem späten 12. -

AUF NACH SPANDAU Urlaub in Berlin B E R L in Spandauer E R Tegeler M a U Forst Bürgerablage E See
Entdeckungsreise AUF NACH SPANDAU Urlaub in Berlin B e r l in Spandauer e r Tegeler M a u Forst Bürgerablage e See r w w e e Neuendorfer Allee g g Spandauer Forst Bahnhof REINICKEN- S ch Falkenhagen ö H Bushaltestelle n ev. Johannesstiftw DORF a ld e Berliner Camping Club e. V. r INHALT A l le S e S-Bahn Segel-Club Spandau e. V. Falkenhöh H U U-Bahn Jungfernheide Havelland-Radweg An Havel und Spree – Im Herzen Spandaus 4 P Parkplatz .............. Hakenfelde Havel-Radweg Stefans Hakenfelde Information Fahrradverleih Maselakepark Hohenzollernpark Spandau ahoi! Leinen los...........................................10 Wasserfreunde Spandau 04 e. V. S c h Falkenseer Chaussee ö n w a Havel Falkenhagener l d Grill-Boot Spandaus grüne Seiten – Raus in die Natur..............14 e r D S t a r u Feld a m ß Bahnhof e s t Eiswerderra ß Hotel und City Camping Berlin 1 Altstadthafen Spandau e Albrechtshof Bootshaus Hettler & Lange Eldo-RAD-o – Unterwegs mit dem Drahtesel.............20 Seegefelder Straße Kiesteich Historisches Fahrradmuseum Spandauer See Krienickepark Hav H elland- Radw eg Wasserfreunde Spandau 04 e. V. Westernstadt Siemensstadt Spektegrünzug Zitadelle Haselhorst Teilungsstory – Hart an der Grenze.............................26 Berliner Mauerweg U Am Juliusturm Siemensstadt Bahnhof U U Nonnendammallee Falkenhagener Straße Münsingerpark Schönwalder Straße U Felds Staaken Altstadt traße Bahnhof U Spandau – Peng! IndustrielleMüllerstraße VergangenheitKörnerstraße ............30 Brunsbütteler Damm e Spandau ß S a e Fahrradverleih Spiegelturm -

Zisterzienserklöster in Der Germania Slavica Und Ihr Beitrag Zur
Winfried Schich Zisterzienserklöster in der Germania Slavica und ihr Beitrag zur Gestaltung der Kulturlandschaft und zur Entwicklung der Wirtschaft im 12. und 13. Jahrhundert Die Raumbezeichnung Germania Slavica wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von Walter Schlesinger in Marburg in Analogie zu dem zu der Zeit bereits verbreiteten Begriff Germania Romana geprägt1 und in den 1980er Jahren von Wolfgang H. Fritze im Rahmen eines interdisziplinären Forschungsprojektes an der Freien Universität Berlin in die mediävistische Terminologie eingeführt.2 Ziel war es, das slavische Ethnikum als Bestandteil der deutschen Geschichte bewusst zu machen. Mit Fritzes Worten verstehen wir unter Germania Slavica „denjenigen Raum, innerhalb dessen die slavische Bevölkerung in einem allmählichen Prozess sprachlich germanisiert worden ist“.3 Dies gilt namentlich für das östliche Deutschland, in dem noch heute eine Fülle von slavischen Ortsnamen von der einstigen Verbreitung der slavischen Sprache zeugt, im weiteren Sinne für das historische östliche Deutschland mit Schle- sien, Pommern und der brandenburgischen Neumark. Im Folgenden werden zwei Zisterzienserklöster als Beispiele im Mittelpunkt der Betrachtung stehen: Leubus im einst polnischen, dann jahrhundertelang deutschen und als Folge des Zweiten Welt- krieges wieder polnischen Schlesien und Doberan in Mecklenburg. Beide Klöster wurden im 12. Jahrhundert von deutschen Mutterklöstern aus besetzt. Das östliche Mitteleuropa erlebte im 12./13. Jahrhundert einen Prozess der Trans- formation, der mit dem Ausbau des Landes verbunden war.4 Dieser orientierte sich an „modernen“ Strukturen im Westen, an ihm waren Zuwanderer von dort, namentlich deutsche und niederländische Siedler, maßgeblich beteiligt, aber auch die ansässige slavische Bevölkerung nahm an ihm teil. In den Gebieten zwischen Elbe, Oder und Ostsee waren mit diesem Vorgang die Expansion deutscher Fürsten und die Ausbrei- 1 Vgl. -

German Historical Institute London Bulletin Vol 32 (2010), No. 1
German Historical Institute London Bulletin Volume XXXII, No. 1 May 2010 CONTENTS Article Imperialism and Globalization: Entanglements and Interactions between the British and German Colonial Empires in Africa before the First World War (Ulrike Lindner) 4 Review Articles Micro Views of National History: Local and Regional Dimen- sions of the End of the Old Reich in 1806 (Torsten Riotte) 29 Hans-Ulrich Wehler’s Deutsche Gesellschaftsgeschichte (A. J. Nicholls) 38 Book Reviews Klaus Herbers and Nikolas Jaspert (eds.), Grenzräume und Grenzüberschreitungen im Vergleich: Der Osten und der Westen des mittelalterlichen Lateineuropa (Andrew Jotischky) 55 Peter D. Clarke, The Interdict in the Thirteenth Century: A Question of Collective Guilt (Christoph T. Maier) 60 Nicholas Edward Morton, The Teutonic Knights in the Holy Land 1190–1291 (Kristjan Toomaspoeg) 63 Simon Phillips, The Prior of the Knights Hospitaller in Late Medieval England (Jyri Hasecker) 69 Beat Kümin, Drinking Matters: Public Houses and Social Exchange in Early Modern Central Europe (Martin Scheutz) 75 (cont.) Contents Peter H. Wilson, Europe’s Tragedy: A History of the Thirty Years War (Georg Schmidt) 82 Stefan Kroll, Soldaten im 18. Jahrhundert zwischen Friedens- alltag und Kriegserfahrung: Lebenswelten und Kultur in der kursächsischen Armee 1728–1796 (Robert I. Frost) 86 Hubertus Büschel, Untertanenliebe: Der Kult um deutsche Mon archen 1770–1830 (Tim Blanning) 92 Heinz Duchhardt, Stein: Eine Biographie (Christopher M. Clark) 94 Michele Gillespie and Robert Beachy (eds.), Pious Pursuits: German Moravians in the Atlantic World (Gisela Mettele) 98 Warren Rosenblum, Beyond the Prison Gates: Punishment and Welfare in Germany, 1850–1933 (Beate Althammer) 101 Klaus Nathaus, Organisierte Geselligkeit: Deutsche und britische Vereine im 19. -

Trade and Communication Networks of the First Millennium AD in the Northern Part of Central Europe
Trade and Communication Networks of the First Millennium AD in the northern part of Central Europe Neue Studien zur Sachsenforschung 1 Trade and Communication Networks of the First Millennium AD in the northern part of Central Europe: Central Places, Beach Markets, Landing Places and Trading Centres Neue Studien zur Sachsenforschung Band 1 herausgegeben vom Niedersächsischen Landesmuseum Hannover in Verbindung mit dem Internationalen Sachsensymposion durch Babette Ludowici Trade and Communication Networks of the First Millennium AD in the northern part of Central Europe: Central Places, Beach Markets, Landing Places and Trading Centres herausgegeben von Babette Ludowici, Hauke Jöns, Sunhild Kleingärtner, Jonathan Scheschkewitz und Matthias Hardt Umschlaggestaltung: Karl-Heinz Perschall Satz und Layout: Karl-Heinz Perschall Grafische Arbeiten: Holger Dieterich, Karl-Heinz Perschall Redaktion: Beverley Hirschel, Babette Ludowici Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © 2010 Niedersächsisches Landesmuseum Hannover Alle Rechte vorbehalten In Kommission bei Konrad Theiss Verlag GmbH, Stuttgart Abbildungsnachweise liegen in der Verantwortung der Autoren Druck: BWH GmbH - Die Publishing Company, D-30457 Hannover ISBN 978-3-8062-2412-2 Vorwort zur Reihe Mit dem vorliegenden Band beginnt das Niedersächsische In der Nachfolge Genrichs wurde die „Sachsenforschung“ am Landesmuseum Hannover unter dem Titel „Neue Studien zur Landesmuseum Hannover von 1977 bis 2004 von Hans-Jürgen Sachsenforschung“ eine neue Reihe von Veröffentlichungen Häßler fortgeführt. Seine Untersuchungen zu frühgeschichtli - aus dem Bereich seiner Forschungstätigkeit. Dazu gehört die chen Bestattungsplätzen und Grabfunden aus Niedersachsen wissenschaftliche Erschließung der umfangreichen archäologi - haben der Forschung wesentliche Impulse verliehen.