Festschrift Zu 750 Jahren Kladow
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Hotels Und Gästehäuser in Der Nähe Des Gemeinschaftskrankenhauses Havelhöhe
Hotels und Gästehäuser in der Nähe des Gemeinschaftskrankenhauses Havelhöhe Unterkunft Entfernung vom GKH Telefon Gästehaus Havelhöhe GKH Havelhöhe (030) 36501-0 Kladower Damm 221, Haus 15 www.havelhoehe.de Hotel Ibis Spandau Spandauer Arkaden (030) 33 50 20 Klosterstr. 4, 13581 Berlin 8,5 km www.ibis.com/de/hotel-3321-ibis-berlin-spandau/index.shtml Hotel SensCity Hotel Spandau Altstadt Spandau (030) 33 07 20 Heidereuter Str. 37-38, 13597 Berlin 9,5 km https://www.senscity-hotel-spandau.de/ Hotel Herbst Altstadt Spandau (030) 353 70 00 Moritzstr. 20, 13597 Berlin 9 km Hotel Benn Altstadt Spandau (030) 353 92 70 Ritterstr. 1a+15, 13597 Berlin 9,5 km www.hotel-benn.de Hotel Lindenufer Altstadt Spandau (030) 353 77 00 Breite Str. 36, 13597 Berlin 10 km www.hotel-lindenufer.com Michels Aparthotel S-Bahn (030) 300 00 60 Heerstr. 80, 14055 Berlin Olympiastadion www.aparthotelberlin.de 10,5 km Novum Select Hotel Berlin im Spiegelturm Nähe Altstadt (030) 33 09 80 Freiheit 5, 13597 Berlin Spandau www.novum-hotels.de/hotel-spiegelturm-berlin/ 9,5 km Hotel Kapitän's Kajüte Gatow 0172 / 80 266 80 Alt-Gatow 23, 14089 Berlin 3 km www.kapitaenskajuete.de Imchen Boardinghouse Kladow (030) 339 364 37 Imchenallee 46, 14089 Berlin 2 km www.imchenboardinghouse.de/ Gästehaus Quinta Spandau (030) 30 20 51 23 Weinmeisterhornweg 79, 13593 Berlin 6 km www.gaestehaus-quinta.de Gästevilla Blindenfreunde Kladow (0 30) 8 23 43 28 Krampnitzer Weg 27, 14089 Berlin 3,2km www.blindenfreunde.de Umwelt Bildungszentrum Gatow 030-20096400 Kladower Damm 57, 14089 Berlin 2,5km Arcus Hotel Spandau (030) 362 89 369 Heerstr. -
Insel Schwanenwerder
Insel Schwanenwerder Eine Insel als Villenkolonie Friedrich Wilhelm Wessel, ein wohlhabender Petroleumlampenfabrikant, der eine Villa am hoch gelegenen Wannseeufer besaß und täglich auf die damals noch „Cladower Sandwerder“ genannte Insel herabblicken konnte, erwarb 1882 das von der Havel umgebene Eiland vom Rittergutsbesitzer Parzellierungsplan Hugo von Platen. Er ließ die Inselfläche erheblich aufschütten um 1900 und parzellieren. Die Einzelgrundstücke bot er zum Kauf und zum Bau von Landhäusern an. Schwanenwerder war ein typisches Spekulationsprojekt der Gründerzeit. Gleichzeitig wollte Wessel etwas Einmaliges schaffen. Die gesamte Insel sollte dem Zeitgeschmack entsprechend zu einem Ort romantischer Inszenierung in üppiger Natur werden. Zu diesem Zweck gab der Insel- besitzer den Bau eines großflächig ange- legten Gemeinschaftsparks mit abwechs- lungsreichem Baum- und Strauchbestand in Auftrag. Er ließ Skulpturen aufstellen, darunter auch ein Fragment aus dem Familie Wessel Pariser Schloss, die „Tuilerien-Säule“. Sichtachsen bezogen die um 1890 umgebende Havellandschaft in die künstlich geschaffene Natur- szenerie ein. Friedrich Wilhelm Wessel beantragte, seine Insel „Schwanenwerder“ nennen zu dürfen, was ihm erst 1901 vom Kaiser genehmigt wurde. Der neue Name entsprach der Exklusivität des Ortes. Die Insel sollte das bürgerliche Gegenstück zur gegenüber- liegenden kaiserlichen Pfaueninsel sein. Die künftigen Bauherren durften die Grund - stücke nur zu privaten Wohnzwecken nutzen, selbst der Betrieb von Gaststätten oder Heilanstalten war untersagt. Dadurch Inselzufahrt wurde der Charakter der Insel als Rückzugsraum unterstrichen. mit Wasserturm um 1910 Wegen der Abgeschiedenheit und fehlender Infrastruktur kam der Grundstücksverkauf jedoch nur schleppend voran. Um 1900 waren nur vier Parzellen bebaut. Obwohl Wessel eine hölzerne Brücke als Verbindung zum Festland erbauen und einen Straßen- zubringer anlegen ließ, blieb die Kutschfahrt nach Berlin ein unbequemes und zeitauf- wändiges Unterfangen. -

Berlin by Sustainable Transport
WWW.GERMAN-SUSTAINABLE-MOBILITY.DE Discover Berlin by Sustainable Transport THE SUSTAINABLE URBAN TRANSPORT GUIDE GERMANY The German Partnership for Sustainable Mobility (GPSM) The German Partnership for Sustainable Mobility (GPSM) serves as a guide for sustainable mobility and green logistics solutions from Germany. As a platform for exchanging knowledge, expertise and experiences, GPSM supports the transformation towards sustainability worldwide. It serves as a network of information from academia, businesses, civil society and associations. The GPSM supports the implementation of sustainable mobility and green logistics solutions in a comprehensive manner. In cooperation with various stakeholders from economic, scientific and societal backgrounds, the broad range of possible concepts, measures and technologies in the transport sector can be explored and prepared for implementation. The GPSM is a reliable and inspiring network that offers access to expert knowledge, as well as networking formats. The GPSM is comprised of more than 150 reputable stakeholders in Germany. The GPSM is part of Germany’s aspiration to be a trailblazer in progressive climate policy, and in follow-up to the Rio+20 process, to lead other international forums on sustainable development as well as in European integration. Integrity and respect are core principles of our partnership values and mission. The transferability of concepts and ideas hinges upon respecting local and regional diversity, skillsets and experien- ces, as well as acknowledging their unique constraints. www.german-sustainable-mobility.de Discover Berlin by Sustainable Transport This guide to Berlin’s intermodal transportation system leads you from the main train station to the transport hub of Alexanderplatz, to the redeveloped Potsdamer Platz with its high-qua- lity architecture before ending the tour in the trendy borough of Kreuzberg. -

Geschichtliches Zum Strandbad Wannsee
Geschichtliches zum Strandbad Wannsee Wie alles begann Nach dem Deutsch-Französischen Krieg wird 1871 Berlin die Residenz des Deutschen Kaisers und Reichshauptstadt, die Einwohnerzahl übersteigt 800.000. Der einsetzende Aufschwung durch das Geld aus den französischen Repara- tionen (5 Mrd. Goldfranken) wurde genutzt, um den Vor- sprung der anderen europäischen Nationen auf dem Gebiet der Industrialisierung aufzuholen. Immer mehr Menschen kamen nach Berlin, denn hier gab es Arbeit in Hülle und Fülle. Im Jahr 1900 hat Berlin fast 1,9 Millionen Einwohner; unter Einschluss der 23 Vororte leben insgesamt 2,5 Millionen Menschen im unmittelbaren Einzugsbereich der Stadt. Laut einer "Wohnungs-Enquête" von 1903 ist Berlin die größte Mietskasernenstadt der Welt: Eine Million Wohnungen, da- von 400.000 mit nur einem Raum und weitere 300.000 mit zwei Räumen. Unter diesen unwürdigen Wohnbedingungen zieht es die Berliner in Ihrer Freizeit hinaus in die Natur an die schönen Seen - wie auch den Wannsee. Doch halt - da war ja noch die Moral jener Zeit - prüde bis zum Abwinken. So begann der Badebetrieb vor den Toren der großen Stadt heimlich, still und leise, um ja die Pickelhau- ben-Obrigkeit der Jahrhundertwende nicht aufmerksam zu ma- chen. Es galt zu jener Zeit als äußerst unmoralisch, im Freien zu baden, und vielleicht die Damen und Herren noch auf Sichtweite. Und wer erwischt wurde, musste Strafe zahlen, wie hier auf dem Bild immerhin 5 Mark. Immer mehr bevölkerten die sonnenhungrigen Berliner in der Badezeit die Ufer des Wannsees. Sie fuhren zwar auch an die anderen Seen, aber das Ostufer des Großen Wannsee zog Hunderttausende an. Mit seinem ganz allmählich abfallenden Sandboden gab es einen vorzüglichen Badestrand. -
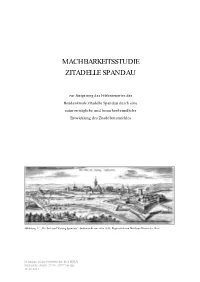
Machbarkeitsstudie Zitadelle Spandau
MACHBARKEITSSTUDIE ZITADELLE SPANDAU zur Steigerung des Erlebniswertes des Baudenkmals Zitadelle Spandau durch eine naturverträgliche und besucherfreundliche Entwicklung des Zitadellenumfeldes Abbildung 1 – „Die Statt und Vestung Spandaw“, Stadtansicht von zirka 1638, Kupferstich von Matthäus Merian der Ältere Henningsen Landschaftsarchitekten BDLA, Schlesische Straße 29/30, 10997 Berlin 18.12.2014 Machbarkeitsstudie Zitadelle Spandau AUFTRAGGEBER: BEZIRKSAMT SPANDAU VON BERLIN UMWELT- UND NATURSCHUTZAMT HERR WEISS CARL-SCHURZ-STR. 8 13597 BERLIN BEARBEITUNG: HENNINGSEN LANDSCHAFTSARCHITEKTEN BDLA JENS HENNINGSEN / EVA ZERJATKE SCHLESISCHE STRASSE 29/30 10997 BERLIN Berlin, den 18.12.2014 Seite 2 von 70 Machbarkeitsstudie Zitadelle Spandau INHALTSVERZEICHNIS 1 Einleitung 6 2 Anlass und Ziel der Machbarkeitsstudie 8 3 Betrachtungsbereiche 9 4 Schutzgebiete 10 4.1 Landschaftsschutzgebiet 10 4.2 Flora-Fauna-Habitat Gebiet 11 4.3 Denkmalbereiche 12 5 Bestehende Planungen 14 5.1 Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 17 14 5.2 Planwerk Westraum Berlin 15 5.3 Steganlagenkonzeption Spandau 16 6 Klärung der Eigentumsverhältnisse und Zuständigkeiten 18 6.1 Entwicklungsziele 18 6.2 Zusammenfassung Maßnahmen 18 6.3 Bestand 19 6.3.1 Tabelle Eigentümer – Bundeswasserstraßenverwaltung 19 6.3.2 Tabelle Eigentümer – Land Berlin 20 6.3.3 Tabelle Eigentümer – Liegenschaftsfonds Berlin GmbH & Co. KG 21 6.3.4 Tabelle Eigentümer – Private 22 7 Standortfindung Fußgängerbrücke und Stege 24 7.1 Entwicklungsziele 24 7.2 Bestandsanalyse 24 7.3 Bestehende Planungen -

Vom Reuterkiez Bis Kladow - Von Karow Bis Lankwitz Mobile Jugendarbeit in Berlin
Vom Reuterkiez bis Kladow - von Karow bis Lankwitz Mobile Jugendarbeit in Berlin Bericht 2009 Inhalt Vom Reuterkiez bis Kladow - von Karow bis Lankwitz Mobile Jugendarbeit in Berlin Übersicht über die Einsatzorte 2009 Zielgruppen • Erreichbarkeit und adäquate Zugänge • Regelmäßig erreichte Jugendliche • Die altersmäßige Mischung der erreichten Zielgruppen • Ausbildung, Arbeit, Arbeitslosigkeit • Migrationshintergund der erreichten Zielgruppen (Berlinweite Übersicht) Zielstellungen Abbau gesellschaftlicher Benachteiligung und individueller Beeinträchtigung junger Menschen • Erkennen und Analyse von Problemlagen • Individuelle Unterstützung und Erarbeitung von Handlungsstrategien • Übersicht: Themenbereiche der Hilfs- und Unterstützungsangebote 2009 Erweiterung der Handlungskompetenz durch Förderung der persönlichen Entwicklung und Gemeinschaftsfähigkeit • Ermöglichung positiver Gruppenerfahrungen • Übersicht: Gruppenangebote Mobile Jugendarbeit Berlin 2009 • Unterstützung informeller Bildungsprozesse • Übersicht: Veranstaltungen Mobile Jugendarbeit Berlin 2009 Erschließung von sozialräumlichen Ressourcen für die Zielgruppen und Verbesserung des nachbarschaftlichen Dialogs • Einwirken auf Umfeldbedingungen • Schaffung von Räumen • Bildung und Pflege funktionaler Netzwerke und Schaffung von Begegnungsanlässen Verstärkung der Jugendarbeit: Network • Jugendserver Spinnenwerk, Kiezatlas, Netti • Orientexpress • Mobiles Tonstudio Finanzierung(-en) • Übersicht über Finanzierungsquellen der Mobilen Jugendarbeit Berlin 2009 Öffentlichkeitsarbeit -

Konzept (ISEK) Altstadt Spandau Bericht
Berlin Integriertes Städtebauliches Entwicklungs- konzept (ISEK) Altstadt Spandau Bericht BEZIRKSAMT SPANDAU STADTENTWICKLUNGSAMT CARL-SCHURZ-STRASSE 2-6 13578 BERLIN HERWARTH + HOLZ PLANUNG UND ARCHITEKTUR SCHLESISCHE STRASSE 27 10997 BERLIN Bezirksamt Spandau von Berlin Abt. Bauen, Planen, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Stadtplanung Altstadt Spandau Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) Berlin ISEK Altstadt Spandau Bericht Impressum Auftraggeber: Bezirksamt Spandau von Berlin Abt. Bauen, Planen, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung Stadtentwicklungsamt Fachbereich Stadtplanung Carl-Schurz-Straße 2/6, 13597 Berlin Tel. 030 / 90279 - 2663, Fax 030 / 90279 - 2947 E-Mail: [email protected] Markus Schulte, Nadine Deiwick, Markus Anders in Zusammenwirken mit: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Referat IV C – Städtebauförderung / Stadterneuerung Württembergische Straße 6, 10707 Berlin Tel. 030 90139 – 4936, Fax 030 90139 - 4901 E-Mail: [email protected] Maria Berning, Petra Nothdorf, Martina Mineif, Kai Reichelt Auftragnehmer: Herwarth + Holz Planung und Architektur Schlesische Straße 27, 10997 Berlin Tel. 030 / 61 654 78-0, Fax 030 / 61 654 78-28 E-Mail: [email protected] Carl Herwarth v. Bittenfeld Brigitte Holz Bearbeitung: Victoria Hoedt, Carl Herwarth v. Bittenfeld, Thomas Fenske, Lara Nixdorf, Marion Bauthor, Thea Rath Berlin, 30.04.2015 Die deutsche Sprache bietet keine flüssigen Begriffe, die den weiblichen und männlichen -

Description Basic Data
[ Weitere Angaben: https://brandenburg.museum-digital.de/index.php?t=objekt&oges=47140 vom 28.09.2021 ] Objekt: ”Alt-Spandau” (Flutrinne am Kolk) Museum: MuseumundGalerieFalkensee Falkenhagener Straße 77 14612 Falkensee 03322-22288 Sammlung: Kunstsammlung Museum und Galerie Falkensee / Lorenz Kienzle/Ronka Inventarnummer: K-9.1-8 Oberhammer [CC BY-NC-SA] Beschreibung Die Lithografie ”Alt-Spandau” (Flutrinne am Kolk) ist unten rechts mit ”H. Zank” [Hans Zank] signiert. Der ”Kolk” ist das ¨alteste Siedlungsgebiet und eine Ortslage im Berliner Ortsteil Spandau, nahe der im Ortsteil Haselhorst gelegenen Zitadelle Spandau. Der Kolk grenzt unmittelbar an die Altstadt Spandau. Heute wird das Gebiet Behnitz (fr¨uher auch B¨ahnitz) und Kolk genannt. Kolk heißt dar¨uber hinaus eine Straße innerhalb dieses Gebietes (neben M¨ollentordamm, Hohen Steinweg und Behnitz). Trotzdem hat sich die Bezeichnung Kolk im Volksmund durchgesetzt. Die Straße Kolk liegt auf der fr¨uheren Insel Behnitz, einem der ¨altesten Siedlungsgebiete des Bezirks Spandau. Der Titel des Bildes ”Alt-Spandau” ist postum vergeben und konnte bisher nicht zweifelsfrei dem Werkeverzeichnis von Heinrich Wolter aus dem Jahr 1987 zugeordnet werden. Die vorliegende Arbeit (67,3 cm x 51,5 cm) entspricht in einer Variante den Werkeverzeichnis Nr.: 1744, 1746 und 1747 (Wolter, Heinrich (1987): Hans Zank und Willi Gericke - Zwei bedeutsame Berliner Maler in einer bewegten Zeit der Welt- und Kunstgeschichte, Verlag Galerie Pro Art, Auflage 1, Seite 217-218, Werkeverzeichnis Nr.: 1744, 1746 und 1747). Grunddaten Maße HxB:67,3cmx51,5cm [Rahmengr¨oße] Material/Technik Lithografie Ereignisse Wurde abgebildet (Ort) ... wo Berlin-Spandau Druckplatte hergestellt ... wann 20. Jahrhundert wer Hans Zank (1889-1967) Schlagworte ❼ Altstadt ❼ Druckgrafik ❼ Insel Literatur ❼ Wolter, Heinrich (1987): Hans Zank und Willi Gericke - Zwei bedeutsame Berliner Maler in einer bewegten Zeit der Welt- und Kunstgeschichte, Verlag Galerie Pro Art, Auflage 1. -

Wegeabschnitt Große Steinlanke – S Nikolassee 5 „Auf Dem Südlichen Havelhöhenweg”
Wegeabschnitt Große Steinlanke – S Nikolassee 5 „Auf dem südlichen Havelhöhenweg” P S-Bahn Bus F Fähranleger P P Parkplatz 24 24 Infotafel F Revierförsterei G Gaststätte 25 B S Spielplatz B Badestrand 26 Havelhöhenweg Rollstuhlgerechter Weg Zubringerweg Waldwegeschleife andere Waldwege 29 28 Zeichen entlang des Weges: 27 Havelhöhenweg Zubringerpfeil zum Havelhöhenweg Wasserzugang 25 Wissenspunkt P Waldwegeschleife B P 1 30 30 2 3 4 S-Bahnhof Nikolassee 5 0 250m 500m Wegeabschnitt Große Steinlanke – S Nikolassee „Auf dem südlichen Havelhöhenweg” 5 Infos und Wissenswertes Der südlichste Abschnitt des Havelhöhenweges führt in seiner ganzen Länge die Havelhöhe entlang und eröffnet einige spektakuläre Ausblicke über die Havel. Sie sind besonders intensiv erlebbar, da der Weg ansonsten auf diesem Abschnitt im geschlossenen Wald verläuft. Am Großen Fenster trifft der Weg auf die rollstuhlgerecht ausgebaute Wegeschleife zum S-Bahnhof Nikolassee. Entfernung: 2,15 km Dauer: ca. 60 Minuten bei gemäßigtem Tempo Rundwege: vom Startpunkt Havelhöhenweg 4 km, vom S-Bahnhof Nikolassee 5,6 km Anreise: Bus 218, S Nikolassee (1,42 km) und S Wannsee (2,5 km), Parkplatz Schwierigkeitsgrad: mittel, viele Treppen G Am S Nikolassee, AVUS-Raststätte 24 Die mächtige alte Eiche neben der DLRG-Station „Großes Fenster“ gehört ebenfalls zu den ‚Urwald’-Bäumen aus den Zeiten vor der intensiven forstlichen Nutzung des Grunewaldes. Dieses mehrere 100 Jahre alte Exemplar ist ein geschütztes Naturdenkmal und die stärkste Alteiche des Grunewaldes. 25 Das große Fenster erhielt seinen Namen wegen des freien Ausblicks nach Spandau. Einige hohe Gebäude von Spandau sind gut zu erkennen. Nicht nur der Turm des 1910/13 nach Entwürfen von Heinrich Reinhard und Georg Süßenguth erbauten Rathauses ist weithin sichtbar. -

Unternehmensservice Steglitz-Zehlendorf
Standortvorteile: Unternehmensservice · Wirtschaftsfreundlicher und forschungsnaher Standort Steglitz-Zehlendorf · Bedeutender Life-Sciences-Standort mit Kliniken, Instituten, produzierenden und entwickelnden Unternehmen · Enge Kooperation von Universitäten, Instituten und Wirtschaft · Aktive Gründerszene durch Spin Offs bzw. Jungunternehmen, Forschen und leben im Berliner Südwesten u. a. im Umfeld der Freien Universität Berlin Steglitz-Zehlendorf so groß und vielfältig wie eine mittlere Großstadt – · Regionale Unternehmensnetzwerke zur Förderung kleinerer ein Bezirk mit Lebensqualität. Der Bezirk gliedert sich in die Ortsteile und mittlerer Unternehmen Wannsee, Dahlem, Nikolassee, Zehlendorf, Lankwitz, Lichterfelde, · 77 ha großes historisches Gewerbeareal „Goerzallee / Zehlen- Steglitz und Südende. Dank einer guten Autobahn- und S-Bahn-Anbin- dorfer Stichkanal“ mit 170 Firmen dung ist man in nur wenigen Minuten entweder in der Innenstadt oder im Berliner Umland. Der Bezirk Steglitz-Zehlendorf wird auch „grüner Bezirk“ genannt. Steglitz-Zehlendorf bietet · Otto Lilienthal Gedenkstätte Ihre Ansprechpartner zum Unternehmensservice · Gutshaus Steglitz, eines der letzten Bauzeugnisse des preußischen in Steglitz-Zehlendorf Frühklassizismus · Schlosspark Klein-Glienicke – UNESCO Weltkulturerbe Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf Berlin Partner für Wirtschaft · Botanischer Garten, das höchste Gewächshaus der Welt ist mit 42 ha von Berlin und Technologie Gesamtfläche und ca. 18.000 Pflanzensorten die größte Anlage Michael Pawlik Marc Pappert dieser -

SPANDAU Berlin
FIND US IN THE OLD TOWN - SPANDAU We‘re near the market place and above the hobbyshop Rüther. The best way to reach us is: - U-Bahn Altstadt Spandau or Rathaus Spandau - - Berlin-Spandau - -Bus M32, M45, X33, 134, 136, 137 - In addition, there are nearby parking facilities or a multi-storey parking lot (within 5 minutes walking distance at 1 EUR parking fee / hour). OFFICE HOURS YOUR SPECIALIST PRACTICE From April 1st, 2021 FOR CHILD AND Monday to Thursday 9.00 - 12.00 and 14.00 - 18.00 Friday ADOLESCENT PSYCHIATRY 9.00 - 12.00 h and 13.00 - 14.00 & PSYCHOTHERAPY Consultation hours by appointment only. Appointments can be made via e-mail. Breite Str. 30 D – 13597 Berlin www.praxis-schajan.de [email protected] Berlin Tel.: +49 030.351 333 00 WE SUPPORT YOU OUR TEAM The development of children and adolescents is a dynamic We are a team with years of clinical experience. We work process. It can be challenging at times and sometimes also with a team of medical specialists, psychologists and social overwhelming for those involved. workers. We are very familiar with the care and support system in Berlin and Brandenburg. We offer children, adolescents and their families a compre- hensive and holistic treatment concept within the framework of the social psychiatric agreement. Parishad Schajan Specialist for Child and Adolescent Psychiatry & Psychotherapy Anja Teschner Psychologist „Diego“ We first discuss the current situation in a personal meeting. Our trained and certified Together we develop an individual and needs-based treat- therapy dog ment plan. -

In Gatow / Kladow Überarbeitete Auflage 2020 Spandaus Schönste Spielplätze!
in Gatow / Kladow Überarbeitete Auflage 2020 Spandaus schönste Spielplätze! Gatow / Kladow In dieser Reihe „Meine Spielplätze“ gibt es noch sechs weitere Hefte: Hallo, Euer Spielplatzheft zeigt Euch heute, Hakenfelde dass Kinder in Spandau gut spielen kön- Falkenhagener Feld nen. Das ist uns sehr wichtig. In diesem Heft findet Ihr eine Übersicht der verschiedenen Staaken Spielangebote in Eurem Kiez. Spandaus Mitte Viel Spaß beim Erkunden und „Erspielen“ Wilhelmstadt Euer Straßen- und Grünflächenamt Haselhorst/Siemensstadt und das Projekt „Raum für Kinderträume“ KKS: Kleinkinder-Spielplatz (0-5 Jahre) KS: Kinder-Spielplatz (6-12 Jahre) JS: Jugend-Spielplatz (ab 12 Jahre) BS: Ball-Spielplatz B2 Landschaftsfriedhof Gatow Gatower Str. Gatower l e v a 5 H Gatow / Kladow Potsdamer Chaussee 6 Feldflur Gatow/ 1 Verlängerte Uferpromenade Kladow GATOW am Glienicker See / Moorloch B2 7 Groß-Glienicker Weg 2 George-Caylay-Straße / Landstadt Gatow 3 Saint-Exupéry-Straße / Landstadt Gatow 4 Gatow, Kladow Am Flugplatz / Landstadt Gatow und Groß-Glienicke 5 Havelblick / Gustav-Haestskau-Straße 6 Am Windmühlenberg M A ex-Waite-Str.2 D R w S 4 ato T G 7 „Dorf-Land-Fluss“ Kleine Badewiese / Alt-Gatow gplatz Am Flu B2 PO 3 8 Waldschluchtpfad General-Steinhoff- Breitehornweg8 9 Imchenallee Kaserne Seekorso R i 10 „Räuberspielplatz im Zauberwald“ Runebergweg t te Uferpromenade r fe adower Damm ld Kl d 11 a Cladow-Center Kladower Damm / Ritterfelddamm m m Havelhöhe 12 zwischen Dechtower Steig und Katzwanger Steig Sakrower Landstraße 1 KLADOW V g e e r w l ä n e n t g a e lm r t e e h c U i E Gutspark Neukladow f e r p r o m e Havel n a 11 d e 10 12 9 r.