Download Heft 3/4 – 2007, 33. Jahrgang (Pdf)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Northern Gothic: Werner Haftmann's German
documenta studies #11 December 2020 NANNE BUURMAN Northern Gothic: Werner Haftmann’s German Lessons, or A Ghost (Hi)Story of Abstraction This essay by the documenta and exhibition scholar Nanne Buurman I See documenta: Curating the History of the Present, ed. by Nanne Buurman and Dorothee Richter, special traces the discursive tropes of nationalist art history in narratives on issue, OnCurating, no. 13 (June 2017). German pre- and postwar modernism. In Buurman’s “Ghost (Hi)Story of Abstraction” we encounter specters from the past who swept their connections to Nazism under the rug after 1945, but could not get rid of them. She shows how they haunt art history, theory, the German feuilleton, and even the critical German postwar literature. The editor of documenta studies, which we founded together with Carina Herring and Ina Wudtke in 2018, follows these ghosts from the history of German art and probes historical continuities across the decades flanking World War II, which she brings to the fore even where they still remain implicit. Buurman, who also coedited the volume documenta: Curating the History of the Present (2017),I thus uses her own contribution to documenta studies to call attention to the ongoing relevance of these historical issues for our contemporary practices. Let’s consider the Nazi exhibition of so-called Degenerate Art, presented in various German cities between 1937 and 1941, which is often regarded as documenta’s negative foil. To briefly recall the facts: The exhibition brought together more than 650 works by important artists of its time, with the sole aim of stigmatizing them and placing them in the context of the Nazis’ antisemitic racial ideology. -
Introduction
Cambridge University Press 978-0-521-14571-8 - German Intellectuals and the Nazi Past A. Dirk Moses Excerpt More information Introduction The proposition that the Federal Republic of Germany has developed a healthy democratic culture centered around memory of the Holocaust has almost become a platitude.1 Symbolizing the relationship between the Federal Repub- lic’s liberal political culture and honest reckoning with the past, an enormous Memorial to the Murdered Jews of Europe adjacent to the Bundestag (Federal Parliament) and Brandenburg Gate in the national capital was unveiled in 2005. States usually erect monuments to their fallen soldiers, after all, not to the vic- tims of these soldiers. In the eyes of many, the West German and, since 1990, the united German experience has become the model of how post-totalitarian and postgenocidal societies “come to terms with the past.”2 Germany now seemed no different from the rest of Europe – or, indeed, from the West generally. Jews from Eastern Europe are as happy to settle there as they are to emigrate to Israel, the United States, or Australia.3 1 Bill Niven, Facing the Nazi Past: United Germany and the Legacy of the Third Reich (London and New York, 2002). For an excellent overview of postwar memory politics, see Andrew H. Beattie, “The Past in the Politics of Divided and Unified Germany,” in Max Paul Friedman and Padraic Kenney, eds., Partisan Histories: The Past in Contemporary Global Politics (Houndmills, 2005), 17–38. 2 For example, Daniel J. Goldhagen, “Modell Bundesrepublik: National History, Democracy and Internationalization in Germany,” Common Knowledge, 3 (1997), 10–18. -

GEFÄHRLICH, ABER GUT Die Lange Nacht Mit Dieter Hildebrandt Und
GEFÄHRLICH, ABER GUT Die Lange Nacht mit Dieter Hildebrandt und Volker Kühn Autor: Oliver Kranz Regie: Rita Höhne Redaktion: Monika Künzel Sendedatum: Deutschlandradio am 2.11.2013, 0.05-3.00 Uhr Deutschlandfunk am 2./3.11.2013, 23.05-2.00 Uhr Die Lange Nacht mit Dieter Hildebrandt und Volker Kühn Opener / 1.Stunde Titelmusik des Films "Kir Royal" 10 sec frei stehend, dann leise geblendet Volker Kühn: Wir wollten eine andere Republik. Wir wollten alles verändern, uns auch ein bisschen, aber doch mehr die anderen. Hildebrandt: "Es wird in Zukunft in unserer Republik keine Polizei mehr geben, weil bei uns dann keiner mehr kriminell sein muss. Es wird keiner mehr stehlen müssen. Es wird keiner mehr einen anderen betrügen müssen. In unserer Republik ist das nicht nötig, also brauchen wir keine Polizei." Adenauer: Wir haben einen Abgrund von Landesverrat im Lande. Volker Kühn: Dann hat heftig die Bild-Zeitung und Springer mitgeholfen, dass das Kabarett sich etablieren konnte, weil die ja das erst mal mit Schweigen übergangen haben, und dann haben sie gesagt: "ganz gefährlich. Reichskabarett/"Der Guerilla lässt grüßen": Also dann: Vorwärts mit der Berliner Parole "Lieber tot als rot!" Genauer: "Lieber Tote, als Rote." Volker Kühn: Und dann gab es ein Programm "Der Guerilla lässt grüßen", wo die dann geschrieben haben: "sehr gefährlich, aber leider sehr gut." Titelmusik des Films "Kir Royal", kurz hoch, dann Schlussakkord Oliver Kranz Wie haben Sie beide sich eigentlich kennen gelernt? Dieter Hildebrandt Ich weiß nicht, wer wen kennengelernt hat, aber ich glaube, er hat mich kennen gelernt, ich weniger ihn. -

BR-ONLINE | Das Online-Angebot Des Bayerischen Rundfunks
Sendung vom 23.5.2012, 21.00 Uhr Dieter Hildebrandt Autor und Kabarettist im Gespräch mit Dr. Johannes Grotzky Grotzky: Herzlich willkommen zum alpha-Forum. Unser heutiger Gast ist Kabarettist, Schauspieler, Buchautor und stand weit über ein halbes Jahrhundert auf der Bühne. Herzlich willkommen, Dieter Hildebrandt. Hildebrandt: Guten Tag. Grotzky: Sie sind Mitte 80, gehen rüstig auf die 90 zu und sind immer noch, wie Sie mir vorhin erzählt haben, 140, 150 Tage im Jahr auf der Bühne. Wie erklären Sie Ihren Enkelkindern, was Sie da eigentlich machen, und vor allem, warum Sie das als alter Opa noch machen? Hildebrandt: Da täuschen Sie sich in meinen Enkelkindern. Meine Enkelkinder sind 16, 14 und 12 Jahre alt und sind bereits bei mir in der Vorstellung gewesen. Sie haben all das, worüber ich rede, gewusst. Sie haben auch richtig gelacht, obwohl doch der Zugang zur Satire und zur Ironie angeblich erst so mit Mitte 20 irgendwie funktioniert. Bei ihnen funktioniert das bereits in diesem Alter. Das scheint an den Genen zu liegen. Das haben sie aber nicht von mir, sondern von meinem Vater. Die Enkelkinder fragen mich also keineswegs, warum ich das mache, sondern sagen: "Das musst du machen!" Grotzky: Haben sich das Ihre Eltern eigentlich auch so vorgestellt, als Sie ein junger Kabarettist waren? Haben Ihre Eltern auch gesagt: "Ja, das ist der Weg, den du gehen musst!"? Hildebrandt: Nein, mein Vater hat mich ganz anders gesehen. Er hat mich als Großbauern gesehen, und zwar in dem Großbauernbetrieb, den er gegründet hatte in Niederschlesien: mit Kartoffel- und Roggenanbau, denn etwas anderes ist dort gar nicht gewachsen. -
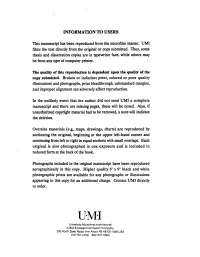
Information to Users
INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand corner and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Each original is also photographed in one exposure and is included in reduced form at the back of the book. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Higher quality 6" x 9" black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. University Microfilms International A Bell & Howell Information Company 300 North Z eeb Road. Ann Arbor. Ml 48 1 0 6 -1 3 4 6 USA 313/761-4700 800/521-0600 Order Number 0201757 German writers and the Intermediate-range Nuclear Forces debate in the 1980s Stokes, Anne Marie, Ph.D. -

Introduction
Cambridge University Press 978-0-521-86495-4 - German Intellectuals and the Nazi Past A. Dirk Moses Excerpt More information Introduction The proposition that the Federal Republic of Germany has developed a healthy democratic culture centered around memory of the Holocaust has almost become a platitude.1 Symbolizing the relationship between the Federal Repub- lic’s liberal political culture and honest reckoning with the past, an enormous Memorial to the Murdered Jews of Europe adjacent to the Bundestag (Federal Parliament) and Brandenburg Gate in the national capital was unveiled in 2005. States usually erect monuments to their fallen soldiers, after all, not to the vic- tims of these soldiers. In the eyes of many, the West German and, since 1990, the united German experience has become the model of how post-totalitarian and postgenocidal societies “come to terms with the past.”2 Germany now seemed no different from the rest of Europe – or, indeed, from the West generally. Jews from Eastern Europe are as happy to settle there as they are to emigrate to Israel, the United States, or Australia.3 1 Bill Niven, Facing the Nazi Past: United Germany and the Legacy of the Third Reich (London and New York, 2002). For an excellent overview of postwar memory politics, see Andrew H. Beattie, “The Past in the Politics of Divided and Unified Germany,” in Max Paul Friedman and Padraic Kenney, eds., Partisan Histories: The Past in Contemporary Global Politics (Houndmills, 2005), 17–38. 2 For example, Daniel J. Goldhagen, “Modell Bundesrepublik: National History, Democracy and Internationalization in Germany,” Common Knowledge, 3 (1997), 10–18. -
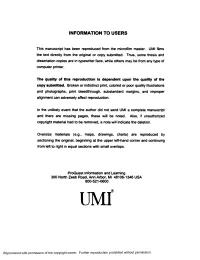
Information to Users
INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand comer and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. ProQuest Information and Learning 300 North Zeeb Road, Ann Arbor, Ml 48106-1346 USA 800-521-0600 Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission. Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission. WINDOW AND WALL: BERLIN, THE THIRD REICH, AND THE GERMAN QUESTION IN THE UNITED STATES, 1933-1999 DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of the Ohio State University By Brian Craig Etheridge, M.A. The Ohio State University 2002 Dissertation Committee: Approved by Dean Michael J. Hogan, Adviser Professor Peter Hahn / Adviser Professor Alan Beyerchen History Grad Reproduced with permission of the copyright owner. -

Q27 Casadevall EN.Pdf 103.65 KB
Political satire in Germany: from the political Kabarett of the thirties to Comedy TV Gemma Casadevall . Political satire in Germany is related to a tradition in- 1. Introduction herited from French cabaret but taken on as their own by a handful of intellectuals, principally left-wing, in the In Germany, talking about political humour means referring twenties and thirties of the last century: the so-called to a past quite a time before the birth of television and, political . Its roots in the political avant garde Kabarett essentially, to one word: Kabarett. This is a term adopted give it a prestige that survives to the present day as well from the original French word cabaret, also with connota- as a certain immunity to the media impact of other tions of a subculture, bohemian life and musicals but which mass TV products, such as Comedy TV. Hitler made in Germany, more than in other countries where this genre Kabarett the “political enemy” of the Third Reich, but the capitulation of Nazism also saw the rebirth of the genre, has also been taken on board, has a political aspect and is stronger than ever. Cabarets sprung up like mush- related to intellectuality, whether it takes place at night or rooms throughout Germany, although mainly in the two not. cities that had been the cradle for the genre, Berlin and The formula is the same: a small stage, an equally small Munich. A good cabaret artist knows no taboos: every- company with just a few actors, often monologue experts, thing is allowed, provided the subject is handled with and a mix of humour and satire with a certain carte blanche talent and they do not resort to silliness. -

Dieter Hildebrandt Dieter Hildebrandt Wirft Ein
Leseprobe Dieter Hildebrandt Dieter Hildebrandt wirft ein "Die Lesung zielt mitten ins Herz jedes Fans und erwischt auch das Hirn jedes kritischen Betrachters. Volltreffer!" Wetzlarer Neue Zeitung Bestellen Sie mit einem Klick für 9,95 € ca. Erscheinungstermin: 01. Juli 2006 Lieferstatus: Lieferbar Mehr Informationen zum Buch gibt es auf www.randomhouse.de Inhalte Buch lesen Mehr zum Autor Zum Buch Dass Dieter Hildebrandt immer schon ein Fußballfan und Spieler war, wissen nur wenige. So gründete er parallel zur Lach- und Schießgesellschaft den Fußballclub FC Schmiere, der mit sämtlichen Bundesligamannschaften trainierte. Zum wechselnden Kader gehörte auch die gesamte Weltmeistermannschaft von 1954. Dieter Hildebrandt erzählt mit Begeisterung von seiner Leidenschaft – und deutsche Geschichte. • Fußball, das Thema Nummer eins im WM-Jahr 2006, aus Sicht von Dieter Hildebrandt – amüsant und tiefsinnig. • Bisher unbekannte Geschichten und Anekdoten aus dem Leben des großen deutschen Kabarettisten exklusiv als Hörbuch! Autor Dieter Hildebrandt Dieter Hildebrandt, geboren 1927 in Bunzlau, Niederschlesien, studierte in München Theaterwissenschaften. Zusammen mit Sammy Drechsel gründete er die Münchner Lach- und © Rudolf Klaffenböck Schießgesellschaft, deren Ensemble er bis 1972 angehörte. Von 1974 bis 1982 arbeitete er mit dem Kabarettisten Werner Schneyder zusammen. Seine TV-Serien Notizen aus der Provinz und Scheibenwischer wurden große Erfolge. Berühmtheit erlangte er auch durch seine Rollen in Kinoproduktionen wie Kir Royal und Kehraus. Hildebrandt erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Grimme-Preis in Gold, Silber und Bronze. Viele erfolgreiche Bücher bei Blessing, darunter Nie wieder achtzig! (2007) und Letzte Zugabe (2014). Bis zu seinem Tod im November 2013 lebte Dieter Hildebrandt mit seiner zweiten Frau, der Kabarettistin Renate Küster- Hildebrandt, in München. -

UNIVERSITY of CALGARY Mocking Hitler: Nazi Speech & Humour In
UNIVERSITY OF CALGARY Mocking Hitler: Nazi Speech & Humour in Contemporary German Culture by Annika Orich A THESIS SUBMITTED TO THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE INTERDISCIPLINARY DEGREE OF MASTER OF ARTS DEPARTMENT OF GERMANIC, SLAVIC AND EAST ASIAN STUDIES and DEPARTMENT OF ENGLISH CALGARY, ALBERTA DECEMBER, 2008 © Annika Orich 2008 ISBN: 978-0-494-51133-6 UNIVERSITY OF CALGARY FACULTY OF GRADUATE STUDIES The undersigned certify that they have read, and recommend to the Faculty of Graduate Studies for acceptance, a thesis entitled “Mocking Hitler: Nazi Speech & Humour in Contemporary German Culture” submitted by Annika Orich in partial fulfilment of the requirements of the interdisciplinary degree of Master of Arts. 6XSHUYLVRUDr. Florentine Strzelczyk, GSEA &R6XSHUYLVRU, Dr. Adrienne Kertzer, English Dr. Michael Taylor, GSEA Dr. Lorraine Markotic, Faculty of Humanities 'DWH ii $EVWUDFW Mocking Hitler is by now an integral part of Germany’s contemporary culture of remembrance. Germans ridicule their former leader and his fellow myrmidons in jokes, films, comics, plays, cabaret, and anti-neo-Nazi satire. Yet, instead of making fun of the historic individual, Germans generally deride Hitler’s (self-)portrayal as the )KUHU and his mythological afterlife as the incarnation of absolute evil – a perception that is embodied by representations of Hitler the orator and Nazi speeches in general. On the basis of different examples of humour about Nazi speechmaking, this thesis identifies the reasons and functions that ridicule plays in Germans’ coming to terms with the Nazi past as well as its problematic and beneficial implications. While humour, on the one hand, demythologizes and exposes Hitler, it serves Germans, on the other hand, as a medium to normalize the memory of Hitler and to distance themselves from their perpetrator past. -

Memory of the Third Reich in Hitler Youth Memoirs
Memory of the Third Reich in Hitler Youth Memoirs Tiia Sahrakorpi A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy of University College London. Department of German University College London August 21, 2018 2 3 I, Tiia Sahrakorpi, confirm that the work presented in this thesis is my own. Where information has been derived from other sources, I confirm that this has been indicated in the work. Abstract This thesis examines how the Hitler Youth generation represented their pasts in mem- oirs written in West Germany, post-unification Germany, and North America. Its aim is two-fold: to scrutinise the under-examined source base of memoirs and to demonstrate how representations of childhood, adolescence and maturation are integral to recon- structing memory of the Nazi past. It introduces the term ‘collected memoryscape’ to encapsulate the more nebulous multi-dimensional collective memory. Historical and literary theories nuance the reading of autobiography and memoirs as ego-documents, forming a new methodological basis for historians to consider. The Hitler Youth generation is defined as those individuals born between 1925 and 1933 in Germany, who spent the majority of their formative years under Nazi educa- tional and cultural polices. The study compares published and unpublished memoirs, along with German and English-language memoirs, to examine constructions of per- sonal and historical events. Some traumas, such as rapes, have only just resurfaced publicly – despite their inclusion in private memoirs since the 1940s. While on a pub- lic level West Germans underwent Vergangenheitsbewältigung (coming to terms with the past), these memoirs illustrate that, in the post-war period, private and generational memory reinterpretation continued in multitudinous ways. -
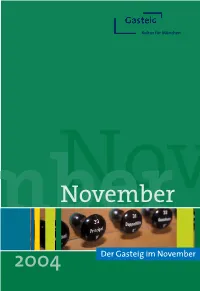
GAS 234234-Progheft 11.04 Korr
mberNovNovember 2004 Der Gasteig im November Das Programm der Stadtbibliothek konnte nicht, wie gewohnt, ins Kalendarium aufgenommen werden. Alle Internet- und PC-Einführungen, Video-Nachmittage,Veranstaltungen für Kinder etc. finden Sie ausführlich unter www.muenchner-stadtbibliothek.de/veranstaltungen. Highlights dieses Monats: 11. Donnerstag – 10. 12. Freitag Ausstellung: Jüdisches Leben in Au und Haidhausen Bibliothek, Ebene 1.1 Die Ausstellung zeigt Lebensschicksale von früher in Au und Haidhausen Eröffnung: ansässigen jüdischen Familien und erinnert damit an den Beitrag dieser 10.11., 19.30 Uhr Familien zur Münchner Stadtgeschichte. KL. KONZERTSAAL 11. Donnerstag – 22. Montag 18. Griechische Filmwoche Vortragssaal der Bibliothek mit deutschen Erstaufführungen, aber auch Klassikern wie Alexis Sorbas € 5.50; erm. € 4.50 VVK: ab 28.10 Lesung und Gespräch mit dem Krimiautor Petros Markaris 22.11., 19.00 Uhr Sein Athener Kommissar Kostas Charitos hat mittlerweile Kultstatus! BLACK BOX 26. Freitag – 30. Dienstag Tschechow-Filmfestival Vortragssaal der Bibliothek Zwei Filme von Nikita Michalkow, Louis Malles »Vanya on 42nd Street«, € 5.50; erm. € 4.50 »Die Möwe« mit Vanesse Redgrave und Simone Signoret und eine aktuelle VVK: ab 10.11. Produktion mit dem Schauspielkollektiv Berlin stehen auf dem Programm. 28. Sonntag Tag der offenen Tür der Zentralbibliothek 11.00-18.30 mit dem Kabarettisten Jörg Maurer, Musik,Theater,Workshops, Zentralbibliothek Führungen, Filmen, Flohmarkt und vielem mehr. Weitere Informationen im Kalendarium 30. Dienstag Begleitprogramm zur Ausstellung »Jüdisches Leben in Au 20.00 Uhr und Haidhausen« Prof. Dr. Michael Brenner (Lehrstuhl für jüdische BLACK BOX Geschichte und Kultur, LMU) präsentiert neueste Forschungsarbeiten zum Thema »Jüdisches Leben« (Bibl) 3 1 Montag 4 Donnerstag bis 7.11.