Entnazifizierung Im Regionalen Vergleich
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Schuschnigg in Paris Und London 1935“
Diplomarbeit Titel der Diplomarbeit „Die Antrittsbesuche des Bundeskanzlers Dr. Kurt Schuschnigg in Paris und London 1935“ Verfasser Otto Josef Gustav Anton Heinzl angestrebter akademischer Grad Magister der Philosophie (Mag. phil.) Wien, 2013 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A312 Studienrichtung lt. Studienblatt: Geschichte Betreuer: Hofrat Univ.-Doz. Dr. Erwin A. Schmidl Inhaltsverzeichnis: 1.) Vorwort …………………………………………...6 2.) Einleitung …………………………………………6 2.1.) Forschungsthesen ………………………………10 3.) Die Außenpolitik der Regierung Dollfuß/Schuschnigg ……………………………12 4.) Rahmenbedingungen und Gründe der Reise ….23 4.1.) Rahmenbedingungen …………………………...24 4.2.) Gründe der Reise ……………………………….28 4.2.1.) Österreichs internationale Reputation ………..29 4.2.2.) Probleme mit dem Deutschen Reich seit dem Regierungsantritt Adolf Hitlers …………31 4.2.3.) Ökonomische Probleme Österreichs durch die Weltwirtschaftskrise ………………………..33 4.2.3.1.) Die Völkerbundanleihe von 1922/23 und die Anleihe von Lausanne 1932 ………………34 4.2.3.1.1) Die Völkerbundanleihe von 1922/23 …………….35 4.2.3.1.2) Die Anleihe von Lausanne 1932 …………………35 2 4.2.3.2.) Finanzielle Probleme durch den Zusammenbruch der Credit-Anstalt …………..37 4.2.3.3.) Probleme der österreichischen Tourismuswirtschaft ……………………………39 5.) Die „Reisegesellschaft“ …………………………40 5.1.) Bundeskanzler Dr. Kurt Alois Josef Johann Edler von Schuschnigg …………………………41 5.2.) Außenminister Egon Maria Eduard Oskar Freiherr Berger von Waldenegg am Perg und am Reunperg ........................................................44 5.3.) ao. Gesandter und bev. Minister Theodor Emil Ritter von Hornbostel…………………………...47 5.4.) Dr. Viktor Freiherr Frölich von Frölichsthal ...49 5.5.) Ministerialoberkommissär Dr. Berthold Freiherr von Heardtl …………………………...51 5.6.) Amtssekretär Franz Androszowski …………...51 5.7.) ao. Gesandter und bev. Minister in Paris Dr. Lothar Ritter Egger von Möllwald …………….53 3 5.8.) ao. -

Zur Entnazifizierung in Österreich: Der Vergleich Mit (West-)Deutschland Und Das Beispiel Linzer Stadtverwaltung 1
Walter Schuster Zur Entnazifizierung in Österreich: der Vergleich mit (West-)Deutschland und das Beispiel Linzer Stadtverwaltung 1 Im Unterschied zur Bundesrepublik Deutschland, wo zum Thema Entnazifizierung eine Reihe von allgemeinen Darstellungen2 sowie- vermehrt gerade in den letzten zehn Jahren- mehrere ausführliche Regionalstudien 3 entstanden sind, fußt die Österreichische Forschung nach wie 4 vor auf der Monografie von Dieter Stiefel aus dem Jahr 1981 • Neben- in der Regel kleineren -Arbeiten mit regionalem oder lokalem Bezug5 ist darüber hinaus vor allem der Sammelband 1 Die in dieser Arbeit verwendeten Bezeichnungen gelten sinngemäß auch in derweiblichen Form. Vgl. etwa Clemens Vollnhals (Hg.), Entnazifizierung. Politische Säuberung und Rehabilitierung in den vier Besatzungszonen 1945-1949, München 1991; Klaus-Dietmar Henke, Die Trennung vom National sozialismus. Selbstzerstörung, politische Säuberung, "Entnazifizierung", Strafverfolgung, in: Klaus-Diet mar Henke/Hans Woll er (Hg.), Politische Säuberung in Europa. Die Abrechnung mit Faschismus und Kollaboration nach dem Zweiten Weltkrieg, München 1991, S. 21-83. Trotzdem das Bundesland Bayern im Mittelpunkt der Untersuchung steht, ist die ausführliche "Pionierarbeit" von Lutz Niethammer, Die Mitläuferfabrik Die Entnazifizierung am Beispiel Bayerns, Berlin!Bonn 1982, unter den Übersichtswerken anzuführen. Auch die Studie von Norbert Frei, Vergangenheitspolitik Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit, 2. Aufl. München 1997, beschäftigt sich über weite Strecken -

Der 12. Februar 1934 in Urfahr Und Im Mühlviertel
Der 12. Februar 1934 in Urfahr und im Mühlviertel 80 Jahre ist es am 12. Februar 2014 her, dass in Linz Weltgeschichte geschrieben wurde: Zum ersten Mal setzten sich Arbeiter mit Waffengewalt gegen die drohende Gefahr einer faschistischen Machtergreifung zur Wehr. Nationen mit mächtigeren Arbeiterparteien, wie in Deutschland oder Italien, hatten vorher die Vernichtung der Demokratie ohne Gegenwehr hinnehmen müssen. „Linz gab der demokratischen Welt das Zeichen, dass Faschismus und Diktatur keineswegs das unvermeidliche Schicksal bedeuteten, um aus der Weltwirtschafts- krise der zwanziger und dreißiger Jahre herauszukommen“ schreibt Josef Weidenholzer in dem Buch „Es wird nicht mehr verhandelt – Der 12. Februar 1934 in Oberösterreich“. Auch das Scheitern der sozialdemokratischen Februarkämpfer schmälert nicht deren historisches Verdienst, für Demokratie und Freiheit gekämpft zu haben. 1920 wurde die „christlichsoziale“ Heimwehr gegründet, obwohl schon das Berufs- Bundesheer christlich-sozial dominiert war. Die Sozialdemokraten riefen als Gegengewicht 1923/24 den Republikanischen Schutzbund ins Leben, der die republikanischen Einrichtungen der Demokratie, wie die Versammlungsfreiheit, schützen sollte. SA-Schlägertrupps traten bereits in Erscheinung. Alle Gruppierungen waren bewaffnet, auch der Schutzbund unterhielt geheime Waffenlager, nach denen die Heimwehr und die Exekutive nach dem Verbot des Schutzbundes durch Dollfuss (Ende Mai 1933) fieberhaft fahndete. Eine dieser Waffen- suchaktionen in der sozialdemokratischen Parteizentrale im Hotel Schiff an der Linzer Landstraße löste schließlich den Februaraufstand aus. Die Linzer Schutzbundführung mit Richard Bernaschek an der Spitze, provoziert durch die maß- losen Übergriffe der Heimwehr, war die für den Ausbruch der Kämpfe aus- schlaggebende Kraft. Die politischen und wirtschaftlichen Ereignisse, die zur „Februarrevolte“ führten, und ihr Scheitern (nicht zuletzt durch das Ausbleiben des ausgerufenen Generalstreiks), sind in zahllosen Publikationen geschildert. -

Clemens Jöbstl
Kontinuitäten und Brüche im Dritten Lager vom Kriegsende bis zur Gründung der FPÖ Unter besonderer Berücksichtigung der Biographien der Gründer des VdU und der FPÖ Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades eines Magisters der Philosophie an der Karl-Franzens-Universität Graz vorgelegt von Clemens Jöbstl am Institut für Geschichte Begutachter: Professor Dr. phil. Dr. h.c. Helmut Konrad Graz, 2014 2 Graz, am 05. September 2014 Eidesstattliche Erklärung Ich, Clemens Jöbstl, erkläre eidesstattlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst habe, andere als die angegebenen Quellen nicht verwendet habe und die den benutzten Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe. Die Arbeit wurde in gleicher oder ähnlicher Form bisher noch keiner anderen Prüfungskommission vorgelegt und auch nicht veröffentlicht. 3 4 Gleichheitsgrundsatz Ich habe in dieser Arbeit auf die geschlechtsspezifische Form Wert gelegt. Sollte jedoch an einer Stelle die feminine Form fehlen, geschah dies aus Gründen der Lesbarkeit oder aus Versehen. 5 6 Inhalt 1. Abkürzungsverzeichnis ............................................................................................... 11 2. Einleitung .................................................................................................................... 12 2.1 Warum das Dritte Lager? Eine Erklärung zum persönlichen Zugang ................ 12 3. Hypothese und implizite Theorie ............................................................................... -

Hermann Neubacher and Austrian Anschluss Movement, 1918-40 Harry Ritter Western Washington University, [email protected]
Western Washington University Masthead Logo Western CEDAR History Faculty and Staff ubP lications History 12-1975 Hermann Neubacher and Austrian Anschluss Movement, 1918-40 Harry Ritter Western Washington University, [email protected] Follow this and additional works at: https://cedar.wwu.edu/history_facpubs Part of the European History Commons Recommended Citation Ritter, Harry, "Hermann Neubacher and Austrian Anschluss Movement, 1918-40" (1975). History Faculty and Staff Publications. 33. https://cedar.wwu.edu/history_facpubs/33 This Article is brought to you for free and open access by the History at Western CEDAR. It has been accepted for inclusion in History Faculty and Staff Publications by an authorized administrator of Western CEDAR. For more information, please contact [email protected]. Conference Group for Central European History of the American Historical Association Hermann Neubacher and the Austrian Anschluss Movement, 1918-40 Author(s): Harry R. Ritter Source: Central European History, Vol. 8, No. 4 (Dec., 1975), pp. 348-369 Published by: Cambridge University Press on behalf of Conference Group for Central European History of the American Historical Association Stable URL: http://www.jstor.org/stable/4545754 . Accessed: 29/10/2014 13:36 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. -

Kurt Bauer / Gerhard Botz / Wolfgang Meixner, Die Sozialstruktur Der
Ludwig Boltzmann-Institut für Historische Sozialwissenschaft Projektberichte Die Sozialstruktur der illegalen NS- Bewegung in Österreich 15 (1933–1938) Projektleiter: Gerhard Botz Kurt Bauer, Gerhard Botz und Wolfgang Meixner unter Mitarbeit von Heinrich Berger, Alexander Prenninger und Gerhard Siegl Jubiläumsfondsprojekt Nr. 12061 Wien April 2011 Ludwig Boltzmann-Institut für Historische Sozialwissenschaft, Wien Cluster Geschichte der LBG Projektberichte 15 Die Sozialstruktur der illegalen NS- Bewegung in Österreich (1933–1938) von Kurt Bauer, Gerhard Botz und Wolfgang Meixner unter Mitarbeit von Heinrich Berger, Alexander Prenninger und Gerhard Siegl Projektleiter: Gerhard Botz Abschlussbericht Jubiläumsfondsprojekt Nr. 12061 Wien 2011 2 3 Inhalt Abkürzungen ................................................................................................................................... 7 A Vorbemerkungen ................................................................................................................... 9 A.1 Exposee .......................................................................................................................... 9 A.1.1 Einleitung ................................................................................................................. 9 A.1.2 Forschungsstand .................................................................................................... 10 A.1.3 Problemfelder ....................................................................................................... -

Italy, Austria and the Anschluss: Italian Involvement in Austrian Political and Diplomatic Affairs, 1928-1938
RICE UNIVERSITY ITALY, AUSTRIA AND THE ANSCHLUSS: ITALIAN INVOLVEMENT IN AUSTRIAN POLITICAL AND DIPLOMATIC AFFAIRS, 1928-1938 by Frederick R. Zuber A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS Thesis Director's signature: /£?. 6taZ)As Houston, Texas Hay, 1973 ABSTRACT ITALY, AUSTRIA AUD THE ANSCHLUSS: ITALIAN INVOLVEMENT IN AUSTRIAN POLITICAL AND DIPLOMATIC AFFAIRS, 1928-1938 Frederick R. Zuber Italy's involvement in Austrian political and dip¬ lomatic affairs during the interwar period generally has been studied in light of her acquiesence in the Austro-German Anschluss of March 15* 1938. Mussolini's acceptance of the union of these two German states is frequently interpreted as yet another manifestation of the growing cooperation between Fascist Italy and Nazi Germany which, beginning with their collaboration during the Spanish Civil War, eventually led to the events of Munich and the Second World War. While not without a degree of validity, this approach to Italy's involvement in the Anschluss tends to ignore the basic differences in policy and interests that existed between these two states. The resulting image, therefore, overemphasizes the closeness of the affinity between Rome and Berlin. ' This study seeks to present a balanced view of Italy's involvement in the Anschluss by tracing the rather complex course of Italian foreign policy in Austria during the period from 1928 to 1938. The examination of Austro-Italian relations is divided into three phases. The first, extending from the initial Italian contacts with various rightist groups in Austria in 1928 to the assassination of the Austrian chancellor, Engelbert Dollfuss, in July, 1931+j marked the development of an Italian "protectorate" over Austria and the expansive phase of Italy*s quest for hegemony in Central Europe. -

DÖW Jahrbuch 2008
www.doew.at Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (Hg.) JAHRBUCH 2008 Schwerpunkt Antisemitismus Redaktion: Andreas Peham Christine Schindler Karin Stögner Wien: LIT Verlag 2008 Inhalt – Jahrbuch 2008 www.doew.at Redaktionelle Vorbemerkung 7 Alice Teichova Der „Anschluss“ Österreichs an Hitlerdeutschland –Erinnerungen an den März 1938 14 Schwerpunkt Antisemitismus Frank Stern Gibt es einen neuen Antisemitismus – oder nur neue Antisemiten? Kulturgeschichtlicher Einwurf 20 Elisabeth Klamper Antisemitismus – ein Ritual der Zivilisation? 31 Andreas Peham Die erste Lüge. Eine psychoanalytisch orientierte Kritik des Antisemitismus 46 Karin Stögner Zum Verhältnis von Antisemitismus und Geschlecht im Nationalsozialismus 70 Elisabeth Kübler „Als Individuen alles, als Nation nichts.“ Postnationales Europa und nationalistisches Israel? 86 Thomas Schmidinger Zur Islamisierung des Antisemitismus 103 Inhalt Heinz Wassermann – Jahrbuch 2008 www.doew.at Empirische Antisemitismusforschung in Österreich. Ein Überblick 140 Werner Dreier Ach ging’s nur zu wie in der Judenschul! Anregungen für eine Auseinandersetzung mit Antisemitismus in der Schule 166 Matthias Falter „Die vollendete Sinnlosigkeit.“ Hannah Arendts politische Theorie des Antisemitismus. Eine Rezension 185 Varia Hans Schafranek / Andrea Hurton Die Österreichische Legion und der „Anschluss“ 1938. „Arisierungen“ als Versorgungs- und Karrierestrategien „verdienter Kämpfer“ im politischen Abseits 189 Gerhard Botz Die geplante territoriale „Endlösung“ der Wiener „Tschechenfrage“ -
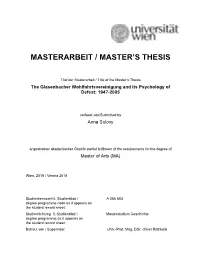
Masterarbeit / Master's Thesis
MASTERARBEIT / MASTER’S THESIS Titel der Masterarbeit / Title of the Master‘s Thesis The Glasenbacher Wohlfahrtsvereinigung and its Psychology of Defeat: 1947-2005 verfasst von/Submitted by Anna Solovy angestrebter akademischer Grad/In partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts (MA) Wien, 2018 / Vienna 2018 Studienkennzahl lt. Studienblatt / A 066 803 degree programme code as it appears on the student record sheet: Studienrichtung lt. Studienblatt / Masterstudium Geschichte degree programme as it appears on the student record sheet: Betreut von / Supervisor: Univ.-Prof. Mag. DDr. Oliver Rathkolb Abstract Bis heute konzentriert sich die überwiegende Forschung zur Nachkriegszeit in Deutschland und Österreich auf Fragen zu Schuld, Justiz, Bruch und Kontinuität. Mit der Absicht die Wirkungsweise von Gerichtsentscheiden und Denazifizierung beziehungsweise die Beweggründe und die Erbarmungslosigkeit zahlreicher Nationalsozialisten zu untersuchen, gingen Wissenschaftler bislang davon aus Nationalsozialisten seien in der Nachkriegszeit bestrebt gewesen, sich von ihrer Naziidentität und -vergangenheit zu distanzieren. Wie die vorliegende Masterarbeit jedoch zeigen wird, können Wissenschaftler nicht a priori annehmen, dass alle Nationalsozialisten ihre Verbindung zum Dritten Reich nach dessen Kapitulation verdrängen wollten. So identifizierten sich beispielsweise die Anhänger der Glasenbacher Wohlfahrtsvereinigung, eine Organisation früherer Nationalsozialisten zum Gedenken und Beistand der von den Alliierten im Camp Marcus W. Orr Inhaftierten, im Zeitraum von 1957 bis 2005 auch weiterhin öffentlich als Nationalsozialisten und verfassten Schriften, welche ihren Glauben an den Fortbestand der nationalsozialistischen Ideologie bekräftigten. Mit dem Abstreiten des Scheiterns Zusammenbruchs des Dritten Reiches gelang es den Mitgliedern der Vereinigung eben jene Selbstwahrnehmung aufrechtzuerhalten, welche sie in der Zeit des Dritten Reiches gepflegt hatten und die ihren Leben eine gewisse Bedeutung und einen Sinn gab. -
5 Ausgewählte Adelsgeschlechter Und Das Ns-Regime 71
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Abseits von Flucht und Widerstand Der ehemalige österreichische Adel in der NS-Zeit. Verfasser Marian Wimmer angestrebter akademischer Grad Magister der Philosophie (Mag. phil.) Wien, 2012 Studienkennzahl lt. A 312 Studienblatt: Studienrichtung lt. Geschichte Studienblatt: Betreuerin / Betreuer: A.o. Univ.-Prof. Mag. Dr. Marija Wakounig, M.A.S. 2 Für Stephie – Danke für alles! 3 4 Inhaltsverzeichnis INHALTSVERZEICHNIS 5 1 EINLEITUNG UND FRAGESTELLUNG 7 2 METHODE, DEFINITIONEN UND EINSCHRÄNKUNG 10 2.1 Definition des Untersuchungsbereichs 10 2.2 Die Forschungsmethode 14 3 AKUTELLER FORSCHUNGSSTAND UND PROBLEMFELDER 18 3.1 Problemfelder der Adelsforschung 18 3.2 Der aktuelle Forschungsstand 19 4 VORGESCHICHTE UND HISTORISCHER KONTEXT 30 4.1 Die Erste Republik: 1918–1920 30 4.2 Die Erste Republik: Die 1920er Jahre 35 4.3 Die Erste Republik: Von der Demokratie in die Diktatur 38 4.4 Bundesstaat Österreich: „Ständestaat“ – „Austrofaschismus“ 42 4.4.1 Der Kampf gegen den Nationalsozialismus – mit Hauptaugenmerk auf das Juliabkommen von 193644 4.5 Das NS-Regime in Österreich 53 4.5.1 Vom „Bundesstaat Österreich“ über die „Ostmark“ zu den „Alpen- und Donau-Reichsgauen“ 54 4.5.2 Österreich und das NS-Regime 55 4.6 Der Adel und die Republik 59 4.6.1 Ausrufung der Republik und das Gesetz zur Aufhebung des Adels 59 4.6.2 Reorganisation und Neuorientierung in der Republik 61 4.7 Der Adel unter den Regimen von Dollfuß und Schuschnigg 64 4.8 Der Adel und das NS-Regime 65 5 AUSGEWÄHLTE ADELSGESCHLECHTER UND DAS NS-REGIME -

Diplomarbeit
DIPLOMARBEIT zur Erlangung des akademischen Grades Mag.a iur. der Rechtswissenschaften an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Paris Lodron Universität Salzburg NS-Rassengesetzgebung im Eherecht Eingereicht von: Ina Koppler Betreuerin: Aichhorn, Ulrike, Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. MSc. Fachbereich: Sozial- und Wirtschaftswissenschaften Salzburg, Jänner 2020 Eidesstaatliche Erklärung Ich erkläre hiermit eidesstattlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Alle Stellen, die wörtlich oder inhaltlich den angegebenen Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht. Die vorliegende Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form noch nicht als Bachelor-/ Master-/ Diplomarbeit/ Dissertation eingereicht. _________________________________ Datum, Unterschrift 1 Abstract Die Diplomarbeit behandelt das Eherecht zur Zeit des Nationalsozialismus sowie die Auswirkungen der Rassengesetzgebung auf die Ehe. Zunächst wird die nationalsozialistische Weltanschauung sowie Zweck und Bedeutung der Ehe erläutert, um ein Verständnis dafür zu entwickeln, mit welchem Hintergrund eine Änderung des Eherechts erfolgte. Dann wird das österreichische Eherecht vor der Machtübernahme dargestellt und in Folge einige wesentliche Bestimmungen, die mit dem neuen Ehegesetz 1938 in Kraft traten. Hier stellen das Scheidungsrecht sowie die Eheverbote einen wesentlichen Teil dar, da sich in diesem Bereich die Bevölkerungspolitik des NS-Regimes sehr stark auf das Recht -

Das „Braune Netzwerk“ in Linz. Die Illegalen Nationalsozialistischen
21 THOMAS DOSTAL DAS „BRAUNE NETZWERK“ IN LINZ Die illegalen nationalsozialistischen Aktivitäten zwischen 1933 und 1938 INHALTSÜBERSICHT Einleitung 22 Der Weg der Nationalsozialisten in die Illegalität 24 Strukturelle Probleme einer Parteiorganisation in der Illegalität 43 Die NS-Propaganda- und Terrorwelle in Linz 47 Der Juliputsch 1934 in Linz 66 Vom Juliputsch zur so genannten „Selbstauflösung“ 73 Das braune Netzwerk 79 Die großdeutschen NS-Honoratioren 79 Die Parteiorganisation (PO) 90 Die Sturmabteilung (SA) 98 Die Schutzstaffel (SS) 106 Die Hitler-Jugend (HJ) 110 Die Folgen des Juliabkommens 1936 113 Anschlusstaumel und lokale „Machtergreifung“ 131 Du bist eben leider ein Kriegskind, die haben alle nichts Ordentliches gelernt, immer nur alles versäumt, entweder warens zu früh dran oder zu spät –… Immer wieder hören müssen: „Vor dem Krieg, das war eine schöne Zeit!“ – da werd ich ganz wild. Mir hätt sie nicht gefallen, deine schöne Zeit! … Es war eine verfaulte Zeit. Ich hasse sie. Jeder konnte arbeiten, verdienen, niemand mußte hungern, keiner hatte Sorgen – eine widerliche Zeit! Ich hasse das bequeme Leben! Ich bin doch auch ein anständiger Mensch und es war ja nur die Hoffnungslosigkeit meiner Lage, daß ich so schwankte wie das Schilf im Winde – sechs trübe Jahre lang. Die Ebene wurde immer schiefer und das Herz immer trauriger. Ja, ich war schon sehr verbittert. Aber heut bin ich wieder froh! Denn heute weiß ichs, wo ich hingehör … Jetzt ist alles fest. Endlich in Ordnung … Ordnung muß sein! Wir lieben die Disziplin. Sie ist für uns ein Paradies nach all der Unsicherheit unserer arbeitslosen Jugend – Ödön von Horváth1 1 Ödön von Horváth, Ein Kind unserer Zeit.