Forschungen Zur Baltischen Geschichte
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Konrad Mägi 9
SISUKORD CONTENT 7 EESSÕNA 39 KONRAD MÄGI 9 9 FOREWORD 89 ADO VABBE 103 NIKOLAI TRIIK 13 TRADITSIOONI 117 ANTS LAIKMAA SÜNNIKOHT 136 PAUL BURMAN 25 THE BIRTHPLACE OF 144 HERBERT LUKK A TRADITION 151 ALEKSANDER VARDI 158 VILLEM ORMISSON 165 ENDEL KÕKS 178 JOHANNES VÕERAHANSU 182 KARL PÄRSIMÄGI 189 KAAREL LIIMAND 193 LEPO MIKKO 206 EERIK HAAMER 219 RICHARD UUTMAA 233 AMANDUS ADAMSON 237 ANTON STARKOPF Head tartlased, Lõuna-Eesti väljas on 16 tema tööd eri loominguperioodidest. 11 rahvas ja kõik Eesti kunstisõbrad! Kokku on näitusel eksponeeritud 57 maali ja 3 skulptuuri 17 kunstnikult. Mul on olnud ammusest ajast soov ja unistus teha oma kunstikollektsiooni näitus Tartu Tänan väga meeldiva koostöö eest Tartu linnapead Kunstimuuseumis. On ju eesti maalikunsti sünd 20. Urmas Klaasi ja Tartu linnavalitsust, Signe Kivi, sajandi alguses olnud olulisel määral seotud Tartuga Hanna-Liis Konti, Jaanika Kuznetsovat ja Tartu ja minu kunstikogu tuumiku moodustavadki sellest Kunstimuuseumi kollektiivi. Samuti kuulub tänu perioodist ehk eesti kunsti kuldajast pärinevad tööd. meie meeskonnale: näituse kuraatorile Eero Epnerile, kujundajale Tõnis Saadojale, graafilisele Tartuga on seotud mitmed meie kunsti suurkujud, disainerile Tiit Jürnale, meediaspetsialistile Marika eesotsas Konrad Mägiga. See näitus on Reinolile ja Inspiredi meeskonnale, keeletoimetajale pühendatud Eesti Vabariigi 100. juubelile ning Ester Kangurile, tõlkijale Peeter Tammistole ning Konrad Mägi 140. sünniaastapäeva tähistamisele. koordinaatorile Maris Kunilale. Suurim tänu kõigile, kes näituse õnnestumisele kaasa on aidanud! Näituse kuraator Eero Epner on samuti Tartus sündinud ja kasvanud ning lõpetanud Meeldivaid kunstielamusi soovides kunstiajaloolasena Tartu Ülikooli. Tema Enn Kunila nägemuseks on selle näitusega rõhutada Tartu tähtsust eesti kunsti sünniloos. Sellest mõttest tekkiski näituse pealkiri: „Traditsiooni sünd“. -

Lisaks on Koostatud Eraldiseisva Dokumendina Tegevuskava, Mis Kajastab Planeeritavaid Tegevusi Ja Investeeringuid Vähemalt Neljaks Järgnevaks Eelarveaastaks
LÄÄNE MAAKONNA ARENGUSTRATEEGIA 2035+ HAAPSALU, JAANUAR 2019 SISUKORD 1 Sissejuhatus ......................................................................................................... 3 2 Lühendid .............................................................................................................. 4 3 Läänemaa üldandmed ......................................................................................... 5 4 Visioon ja strateegilised eesmärgid aastaks 2035+ ............................................. 8 5 Lähteolukorra kirjeldus ja arenguvajadused ....................................................... 10 5.1 Elukeskkond ................................................................................................ 10 5.1.1 Looduskeskkond ................................................................................... 12 5.1.2 Haridus ................................................................................................. 18 5.1.3 Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid ........................................................... 22 5.1.4 Rahvatervis ........................................................................................... 28 5.1.5 Kultuur .................................................................................................. 31 5.1.6 Kodanikuühiskond ................................................................................. 35 5.1.7 Sport ..................................................................................................... 37 5.1.8 Siseturvalisus ....................................................................................... -

Artistic Alliances and Revolutionary Rivalries in the Baltic Art World, 1890–1914
INTERNATIONAL JOURNAL FOR HISTORY, CULTURE AND MODERNITY www.history-culture-modernity.org Published by: Uopen Journals Copyright: © The Author(s). Content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licence eISSN: 2213-0624 Artistic Alliances and Revolutionary Rivalries in the Baltic Art World, 1890–1914 Bart Pushaw HCM 4 (1): 42–72 DOI: 10.18352/hcm.503 Abstract In the areas now known as Estonia and Latvia, art remained a field for the Baltic German minority throughout the nineteenth century. When ethnic Estonian and Latvian artists gained prominence in the late 1890s, their presence threatened Baltic German hegemony over the region’s culture. In 1905, revolution in the Russian Empire spilled over into the Baltic Provinces, sparking widespread anti-German violence. The revolution also galvanized Latvian and Estonian artists towards greater cultural autonomy and independence from Baltic German artistic insti- tutions. This article argues that the situation for artists before and after the 1905 revolution was not simply divisive along ethnic lines, as some nationalist historians have suggested. Instead, this paper examines how Baltic German, Estonian and Latvian artists oscillated between com- mon interests, inspiring rivalries, and politicized conflicts, question- ing the legitimacy of art as a universalizing language in multicultural societies. Keywords: Baltic art, Estonia, Latvia, multiculturalism, nationalism Introduction In the 1860s a visitor of the port towns of Riga or Tallinn would have surmised that these cities were primarily German-speaking areas of Imperial Russia. By 1900, however, one could hear not only German, but Latvian, Estonian, Russian, as well as Yiddish on the streets of Riga 42 HCM 2016, VOL. -

Haapsalu & Lääne County
Haapsalu & Lääne County Rich history and exciting culture embraced by untouched nature i • Haapsalu was granted city status in 1279. Romantic Haapsalu • Haapsalu is the oldest resort in Estonia, famous for its healing sea mud; in the The resort of Haapsalu, with its digni ed style, leaves one with the impression of summer of 2010, a total of 51 people set a new world record by simultaneously taking another era. Wooden lace architecture in the a mud bath on the promenade. old town, a gorgeous beach promenade, cosy • In Haapsalu cathedral, the notes ring for eleven seconds, which makes it a concert cafes, warm sea water, famous therapeutic hall of unique acoustics. mud, and the most famous ghost in Estonia, the White Lady who resides in the episcopal • The 216 metre-long platform at the historic Haapsalu railway station is fully covered castle, are always happy to welcome anyone by a train shed roof. on a health or cultural holiday. • The Haapsalu shawl, a wondrous piece of handcraft work, is so ne that it can be pulled through a ring. • Ilon Wikland’s drawing of Ronia’s castle in the Astrid Lindgren book was inspired by the episcopal castle of Haapsalu. • The Haapsalu Town Hall exhibits the oldest preserved monument in the world by Friedrich Schiller. • The largest collection of sun crosses in the world - over 300 sun crosses – can be found in Olavi Cemetery on Vormsi Island. • Nõva Church (13.6 x 7.1m) is one of the smallest in Estonia. • The sand on Nõva beach sings, as the grains of sand make a sound resembling a violin being played when stepped on. -
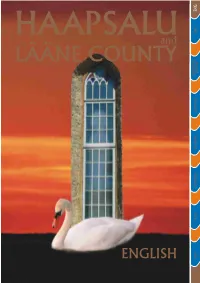
Haapsaluand - O N LÄÄNE COUNTY M O I M T O a C D C a G N I R E T a C S M U E S U M S E I T I V I T C a E D a R T S P a ENGLISH M HAAPSALU and LÄÄNE COUNTY 2 SIGNS
HA LÄÄNE COUNTY APSAL ENGLISH U and ACCOMMO- MAPS TRADE ACTIVITIES MUSEUMS INFO CATERING DATION ENG HAAPSALU and LÄÄNE COUNTY 2 SIGNS 155 Lodging WIFI WIFI WC 160 Catering WC for disabled Bar Sports activities WC Water Closet VISA Credit cards accepted SAUNA Sauna Skiing Shower Billiards Telephone 2 Rooms for disabled TV TV Campfire Silence Boat 50 m Bus stop Fireplace 300 m Beach 40 Caravans P Parking Tent places 7 Bicycles Tennis Gym Yacht harbour Golf Hot drink Hunting Luggage room Domestic ENG animals FIN languages RUS Fishing SWE GER G N HAAPSALU and LÄÄNE COUNTY 3 CONTENTS E O DEAR GUEST, CONTENTS F N I Welcome to the most romantic and mythical spot in Signs 2 Estonia - Haapsalu and Läänemaa. Contents 3 Travel Agencies 4 INFO It is easy to fall in love with Haapsalu: once here, 5 Transport 5 the winding streets ending up at the sea, the old Taxi 5 town with houses adorned with wooden lace and Ports 6 the mysterious White Lady appearing in a chapel Petrol-stations 6 window on moonlit nights will keep the visitor Internet 7 spellbound. WIFI 8 ACCOMMODATION The pebble beaches, squealing seabirds, grassy Rehabilitation centres 9 meadows and peaceful groves will appeal to Hotels in Haapsalu 10 Guesthouses & hostels visitors fond of nature and serenity. Matsalu's in Haapsalu 11-12 abundant bird sanctuary draws visitors from all Accommodation in Lääne County: over the world - it is Europe's biggest and most Ridala Parish 13 diverse nesting area for migratory birds. Taebla Parish 14 Nõva Parish 14 History lovers should make time to look into Lihula Parish 14 medieval churches and castle ruins so typical to Oru Parish 14 Läänemaa. -

As of January 2012 Estonian Archives in the US--Book Collection3.Xlsx
Indexed by Title Estonian Archives in the US Book Collection Author Title Date Dewey # Collect Saar, J1. detsember 1924 Tallinnas 1925 901 Saa Eesti Vangistatud Vaba‐ dusvõitlejate 1. Kogud VII, 2. Kogud VIII‐XIII, 3. Kogud XIV‐XIX, 4. nd 323 Ees Abistamis‐ keskus Kogud XX‐XXV 1985‐1987 Simre, M1. praktiline inglise keele grammatika >1945 422 Sim DP Sepp, Hans 1. ülemaailmne eesti arstide päev 1972 610 Sep EKNÜRO Aktsioonikomitee 1.Tõsiolud jutustavad, nr. 1, 2. nr.2, 3. nr.3 1993 323 EKN Eesti Inseneride Liit 10 aastat eesti inseneride liitu: 1988‐1999 nd 620 Ees Reed, John 10 päeva mis vaputasid maailma 1958 923.1 Re Baltimore Eesti Selts 10. Kandlepäevad 1991 787.9 Ba Koik, Lembit 100 aastat eesti raskejõustikku (1888‐1988) 1966 791 Koi Eesti Lauljate Liit 100 aastat eesti üldlaulupidusid 1969 782 Ees Wise, W H 100 best true stories of World War II, The 1945 905 Wis Pajo, Maido 100 küsimust ja vastust maaõigusest 1999 305 Paj Pärna, Ants 100 laeva 1975 336.1 Pä Plank, U 100 Vaimulikku laulu 1945 242 Pla DP Sinimets, I 1000 fakti Nõukogude Eestist 1981 911.1 Si Eesti Lauljate Liit Põhja‐ Ameerikas 110.a. juubeli laulupeo laulud 1979 780 Ees 12 märtsi radadel 1935 053 Kak Tihase, K12 motiivi eesti taluehitistest 1974 721.1 Ti Kunst 12 reproduktsiooni eesti graafikast 1972 741.1 K Laarman, Märt 12 reproduktsiooni eesti graafikast 1973 741.1 La 12. märts 1934 1984 053 Kak 12. märts. Aasta riiklikku ülesehitustööd; 12. märts 1934 ‐ 12, 1935 053 Kak märts. 1935 Eesti Lauljate Liit Põhja‐ Ameerikas 120.a. -

Estonian Cultural Heritage. Preservation and Conservation Vol
VOL. 1 2005–2012 ESTONIAN CULTURAL HERITAGE PRESERVATION AND CONSERVATION CITYSCAPE / PUBLIC AND RESIDENTIAL BUILDINGS / CHURCHES / MANORS INDUSTRIAL HERITAGE / TECHNOLOGY / ARCHAEOLOGY INTERNATIONAL COOPERATION1 / MISCELLANY VOL. 1 2005–2012 ESTONIAN CULTURAL HERITAGE. PRESERVATION AND CONSERVATION AND CONSERVATION PRESERVATION HERITAGE. CULTURAL 1 ESTONIAN VOL. 2005–2012 Editors-in-chief: MARI LOIT, KAIS MATTEUS, ANNELI RANDLA ESTONIAN Editorial Board: BORIS DUBOVIK, LILIAN HANSAR, HILKKA HIIOP, MART KESKKÜLA, JUHAN KILUMETS, ILME MÄESALU, MARGIT PULK, CULTURAL HERITAGE TÕNU SEPP, OLEV SUUDER, KALEV UUSTALU, LEELE VÄLJA PRESERVATION AND CONSERVATION Translated by SYNTAX GROUP OÜ Graphic design and layout by TUULI AULE Published by NATIONAL HERITAGE BOARD, TALLINN CULTURE AND HERITAGE DEPARTMENT, DEPARTMENT OF CULTURAL HERITAGE AND CONSERVATION AT THE ESTONIAN ACADEMY OF ARTS Supported by THE COUNCIL OF GAMBLING TAX Front cover: The main stairway of the former Estländische adelige Credit-Kasse. Photo by Peeter Säre Fragment of the land use plan of the comprehensive plan of the old town of Narva 15 Seaplane hangars. Photo by Martin Siplane 29 Detail from a coat-of-arms epitaph in Tallinn Cathedral. Photo by the workshop for conserving the coats-of-arms collection of Tallinn Cathedral 65 Laupa Manor. Photo by Martin Siplane 93 Carpentry workshop of the Rotermann Quarter. 7 Rosen Str, Tallinn. Photo by Andrus Kõresaar 117 Lead sheet on the lantern at the façade of the Tallinn Great Guild Hall. Photo by Martin Siplane 133 13th c. merchant’s -

Riisipere-Haapsalu- Rohuküla Raudteetrassi Koridori Asukoha
AS MAVES Marja 4d, 10617 Tallinn, tel: 6567300, e-post: [email protected] Tellija: Lääne Maavalitsus Töö nr: 14139 Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Riisipere -Haapsalu - Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine" keskkonnamõju strateegiline hindamine aruanne Vastutav täitja Kadri Normak Juhatuse liige Karl Kupits Tallinn oktoober 2016 Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine" keskkonnamõju strateegiline hindamine MAVES SISUKORD 1 KOKKUVÕTE ............................................................................................................................................... 4 2 ÜLEVAADE MÕJUHINDAMISE PROTSESSIST ................................................................................ 6 2.1 KSH KÄIK ........................................................................................................................................... 6 2.2 PLANEERIJA , JÄRELEVALVAJA , OTSUSTAJA JA EKSPERT ................................................................. 6 2.3 HUVIGRUPID ...................................................................................................................................... 7 3 KAVANDATAV TEGEVUS JA EESMÄRK............................................................................................. 9 3.1 KAVANDATAV TEGEVUS ................................................................................................................... 9 3.2 REAALSED ALTERNATIIVID ............................................................................................................ -

TALLINN, ESTONIA 6- I I JULY 2003 Eft, ••�
A A B tit IAML ANNUAL CONFERENCE a a M B TALLINN, ESTONIA 6- I I JULY 2003 eft, ••�. • • ..� � 4. Ai • • • • • • • • • 11011 s • OP • • • t . M • • _ k City Center of Tallinn Terminal 'A'S Tenninal'B Port o' Tallinn Terminal 'C ' erminal Railway. Station � to Town Hall OLD TOWN Square TOOMPEA CASTLE ,ôN�gufrste Bus Terminal 1. Reval Hotel Olümpia and Conference Center 7. National Library of Estonia 2. Reval Hotel Central 8. Theatre Vanalinnastuudio 3. Hotel Lembitu 9. Estonian Academy of Music 4. Mustpeade Maja 10. Tallinn Central Library 5. Niguliste Museum-Concert Hall 11. Theatre and Music Museum 6. Kaarli Church International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres Association Internationale des Bibliothèques. Archives et Centres de Documentation Musicaux Internationale Vereinigung der Musikbibliotheken. Musikarchive und Musikdokumentationszentren ANNUAL CONFERENCE CONGRÈS ANNUEL JAHRESTAGUNG TALLINN, ESTONIA 6 - I I JULY 2003 ACKNOWLEDGEMENTS EESiI RAHYUSRAAMATUKOGU MAIIMMAI 1.I1Gl1' OF ISiOMIA � MDOOCU - 441111111•34 TARTUEN.N VI MC L U k L 1,1 WELCOME! BIENVENUE! WILLKOMMEN! We have a great pleasure in L'AIMB-Estonie a l'honneur de Wir heissen Sie nach Tallinn, welcoming you in Tallinn, Esto- vous saluter au congrès an- Estland zur Jahreskonferenz nia at the 2003 Annual Con- nuel 2003 de l'AIBM à Tallinn. 2003 von IVMB herzlich Will- ference of IAML. kommen. We have waited to this for Nous attendions depuis long- Wir haben darauf viele Jahre many years. Now we finally temps l'opportunité de vous gewartet. Endlich können wir have the chance to let you séduire avec l'ambiance médié- Ihnen die besondere Atmos- experience the very special vale et l'hospitalité de Tallinn. -

Baltic Heritage Network Newsletter 2016, No.3
BALTIC HERITAGE NETWORK Newsletter no. 3 (16) 2016 issn: 228-3390 In this issue: • New Estonian National Museum • Roman Toi’s 100th Birthday Celebration in Toronto • BHN Summer School • Conversations About Emigration 2 • Summer Guests in Lithuania • World Lithuanian Unity Day • Still Estonian Mai Raud-Pähn from Sweden and Anton Pärn, the director of the • Music in Estonian Life Foundation of Haapsalu and Läänemaa Museums at the Ants • Call for Papers & Laikmaa Museum – photo by Lea Kreinin Upcoming Conferences Estonian Cultural Heritage From Repository to Exhibition The Baltic Heritage Newsletter is distributed This year the 7th BaltHerNet Summer School titled From Repository quarterly, on-line. The newsletter is compiled to Exhibition took place from July 4th-7th in Haapsalu, Estonia. 34 and edited by Kristina Lupp. The next deadline for submissions is 18 November participants came together from 8 different countries from Estonian 2016. Please send all related enquiries and organizations, museums and archives located both in Estonia and submissions to abroad. Kristina Lupp: [email protected] On the way to Haapsalu we stopped at the Ants Laikmaa House The Non-Profit Association Baltic Heritage Museum, where the artist’s life and art were introduced. Among the Network was founded in Tartu on January 11, 2008. NPA BaltHerNet was established summer school participants was Mai Raud-Pähn from Sweden, who to foster cooperation between national and remembered visiting Ants Laikmaa when she was a child in 1930. Upon private archives, museums, libraries, and arriving in Haapsalu the summer school program continued in the institutions of research, public associations and organizations collecting and studying rooms of the vocational school. -

Estonian Literary Magazine Spring 2019
Estonian Literary Magazine Spring 2019 73 Nº48 elm.estinst.ee MORE INFORMATION: ESTONIAN INSTITUTE Eesti Instituut Suur-Karja 14, 10140 Tallinn, Estonia Phone: +372 631 4355 www.estinst.ee ESTONIAN LITERATURE CENTRE Eesti Kirjanduse Teabekeskus Sulevimägi 2-5 10123 Tallinn, Estonia www.estlit.ee ESTonian Writers’ UNION Eesti Kirjanike Liit Harju 1, 10146 Tallinn, Estonia Phone: +372 6 276 410, +372 6 276 411 [email protected] www.ekl.ee The current issue of ELM was supported by the Cultural Endowment of Estonia. © 2019 by the Estonian Institute. ISSN 1406-0345 Editorial Board: Tiit Aleksejev, Adam Cullen, Peeter Helme, Ilvi Liive, Helena Läks, Piret Viires Editor: Berit Kaschan · Translator: Adam Cullen · Language editor: Robyn Laider Layout: Piia Ruber On the Cover: Eda Ahi. Photo by Piia Ruber Estonian Literary Magazine is included in the EBSCO Literary Reference Center. Contents 2 Places of writing by Tiit Aleksejev 5 Hortus Conclusus by Tiit Aleksejev 8 Warmth and Peturbation. An interview with Eda Ahi by ELM 16 Poetry by Eda Ahi 20 A Brief Guide to Toomas Nipernaadi's Estonia by Jason Finch 24 The 2018 Turku Book Fair: Notes from the organiser by Sanna Immanen 28 Translator Danutė Giraitė: work = hobby = lifestyle. An interview by Pille-Riin Larm 34 Poète maudit? An interview with Kristjan Haljak by Siim Lill 40 Poetry by Kristjan Haljak 42 Lyrikline – Listen to the poet. 20 years of spoken poetry by Elle-Mari Talivee 44 Reeli Reinaus: From competition writer to true author by Jaanika Palm 48 Marius, Magic and Lisa the Werewolf by Reeli Reinaus 52 Ene Mihkelson: “How to become a person? How to be a person?” by Aija Sakova 56 Book reviews by Peeter Helme, Krista Kumberg, Elisa-Johanna Liiv, Siim Lill, Maarja Helena Meriste, and Tiina Undrits 70 Selected translations 2018 Places of writing by Tiit Aleksejev Places of writing can be divided into two: the ancient Antioch, which I had been those where writing is possible in general, attempting, unsuccessfully, to recreate for and those that have a direct connection to quite a long time already. -

Highlights Itineraries Current Events
© Lonely Planet Publications 43 www.lonelyplanet.com ESTONIA •• Highlights 44 HIGHLIGHTS ESTONIA HOW MUCH? Tallinn ( p64 ) Wander the medieval streets, and drink in lovely cafés, eclectic restau- Coffee 30Kr ESTONIA rants and steamy nightclubs. Estonia Taxi fare (10 minutes) 50Kr Pärnu ( p155 ) Join this party town, home to sandy beaches, spa resorts and plenty Bus ticket (Tallinn to Tartu) 80Kr of night-time distractions. Bicycle hire (daily) 150Kr Saaremaa ( p142 ) Escape to Estonia’s larg- Although the smallest of the Baltic countries, Estonia (Eesti) makes its presence felt in the est island, with lovely, long stretches Sauna 65Kr region. of empty coastline and medieval ruins, and abundant opportunities for outdoor LONELY PLANET INDEX Lovely seaside towns, quaint country villages and verdant forests and marshlands set adventure. Litre of petrol 14Kr the scene for discovering many cultural and natural gems. Yet Estonia is also known for Tartu ( p106 ) Discover the magic of this magnificent castles, pristine islands and a cosmopolitan capital amid medieval splendour. splendid town, gateway to the beautiful Litre of bottled water 15Kr land of the mystical Setu community, It’s no wonder Estonia is no longer Europe’s best-kept secret. Half-litre of Saku beer in a store/bar with myriad lakes and forests. 15/28Kr Tallinn, Estonia’s crown jewel, boasts cobbled streets and rejuvenated 14th-century dwell- Lahemaa National Park ( p95 ) Relish the nat- ural beauty of this area’s lush landscape Souvenir T-shirt 150Kr ings. Dozens of cafés and restaurants make for an atmospheric retreat after exploring historic and immaculate coastline. packet of roasted nuts 25Kr churches and scenic ruins, as well as its galleries and boutiques.