Todesurteil Wegen Brandstiftung DDR-Strafprozess Gegen Walter Praedel 1961
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

15. Tätigkeitsbericht
15. Tätigkeitsbericht des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik für die Jahre 2019 und 2020 www.bstu.de 15. Tätigkeitsbericht des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik für die Jahre 2019 und 2020 Inhaltsverzeichnis Seite Vorwort des Bundesbeauftragten ................................................................ 7 1 Zusammenfassung ......................................................................... 8 1.1 Die Zukunft der Stasi-Unterlagen ................................................... 8 1.2 Aus den Arbeitsbereichen ............................................................... 9 1.2.1 Archivarbeit .................................................................................... 9 1.2.2 Verwendung von Stasi-Unterlagen .................................................. 9 1.2.3 Kommunikation und Wissen ........................................................... 11 2 Die Behörde des BStU ................................................................... 13 2.1 Organisation .................................................................................... 13 2.2 Beirat ............................................................................................... 13 2.3 Personal ........................................................................................... 14 2.3.1 Personalbestand .............................................................................. -

33/Vogel-Serie (Page
Geheimdienst-Diplomatie (I): Mitten im Kalten Krieg ließen 1962 die USA den KGB-Oberst Abel, die Sowjetunion den CIA-Piloten Powers und die DDR einen inhaftierten US-Stu- denten frei. Ende 1966 wurde ∏SSR-Spion Frenzel gegen eine deutsche Journalistin ausge- tauscht. Hinter den Kulissen makelte diskret DDR-Anwalt Vogel. Von Norbert F. Pötzl Der Makler der Agenten ine lange Blutspur zieht sich durch die Geschichte der Spionage. Die legendenumwobene Holländerin Mata Hari, Edie als Nackttänzerin Furore gemacht und liebend Deutsch- lands Weltkrieg-I-Feinde ausgehorcht hatte, wurde 1917 füsiliert. Der Oberst Alfred Redl vom Wiener k.u.k. Evidenzbureau wurde 1913 zum Selbstmord mit der Pistole gezwungen. Er hat- te zwölf Jahre lang Geheimnisse an die Russen verraten. Der KGB-Agent Richard Sorge, Moskaus wohl erfolgreichster Spion aller Zeiten, wurde 1944 von den Japanern gehenkt. Er hatte dem sowjetischen Diktator Stalin die Angriffspläne Hitlers verraten (die der Kreml-Herr allerdings nicht ernst nahm) und acht Jahre lang in Tokio spioniert. Das letzte Todesurteil über Sowjetagenten, die im Westen wirk- ten, wurde im April 1951 über das amerikanische Ehepaar Julius und Ethel Rosenberg verhängt. Von einem in Los Alamos be- schäftigten Bruder Ethels hatten die Rosenbergs Informationen über die Atombomben-Versuchsstation der Amerikaner erhalten und an das KGB weitergeleitet. Die Atomspione starben am 19. Juni 1953 auf dem elektrischen Stuhl. Auch in der DDR mußten enttarnte Landesverräter mit dem Schlimmsten rechnen. Sie endeten entweder unter der Guilloti- ne, hier zur „Fallschwertmaschine“ eingedeutscht, oder später, von 1968 an, durch „unerwarteten Nahschuß in den Hinterkopf“, wie es in der Vollstreckungsordnung hieß. So wurden am 23. -

7. Tätigkeitsbericht (2013/2014)
7. Tätigkeitsbericht (2013/2014) Herausgegeben von der Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen „Wir lernen aus der Vergangenheit, weil uns die Zukunft nicht gleichgültig ist.“ Bundespräsident Joachim Gauck Oktober 2013 3 Inhalt Vorab 5 Besucherbetreuung 7 Besucherdienst 11 Prominente Besucher 13 Buchhandlung 17 Besucherreaktionen 18 Besucherforschung 19 Ausstellungen 26 Musealer Rundgang 26 Sonderobjekte 30 Dauerausstellung 31 Wechselausstellungen 35 Veranstaltungen 37 Ausstellungseröffnungen 38 Sonderveranstaltungen 40 Podiumsdiskussionen und Vorträge 44 Literatur- und Filmveranstaltungen 47 Opfergedenken 49 Gedenkstättenpädagogik 51 Seminare und Projekttage 52 Mobiles Learning Center 53 Projekt „Linksextremismus in Deutschland heute“ 53 Projekt „Koordinierendes Zeitzeugenbüro“ 55 Lehrerfortbildung 58 Kooperationen 59 Forschung 60 Zeitzeugenbüro 60 Projekte 64 4 Sammlungen 67 Objektsammlung 67 Fotoarchiv 69 Zeitzeugenarchiv 70 Dokumentenarchiv 71 Bibliothek 71 Mediathek 72 Öffentlichkeitsarbeit 73 Medienbetreuung 74 Publikationen 77 Werbung 79 Internationale Zusammenarbeit 80 Projekt „Contre l’oubli“ 81 Projekt „Zivilcourage würdigen“ 82 Weitere Kooperationen 83 Bautätigkeit 85 Bauunterhalt 85 Investive Maßnahmen 86 Haushalt 89 Personal 92 Stiftungsorgane 94 Förderverein 95 Anhang 97 Chronik 97 Stiftungsgesetz 99 Gremienmitglieder 102 Mitarbeiter 103 Besucherreferenten 104 Besucherstimmen 105 Vorab 5 Vorab 15 Jahre sind vergangen, seitdem die Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen im Juli 2000 ins Leben gerufen wurde – anderthalb -

Historischer Kalenderdienst“ 6/2020 (November – Dezember 2020 – Januar 2021)
Presseinformation Erinnerung als Auftrag: „Historischer Kalenderdienst“ 6/2020 (November – Dezember 2020 – Januar 2021) Die 96. Ausgabe des „Historischen Kalenderdienstes“ der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Dikta- tur weist auf Jahrestage ausgewählter historischer Ereignisse in den Monaten November/Dezember/Ja- nuar hin. Im Erinnerungsjahr 2020 setzt der Kalenderdienst einen Schwerpunkt auf die Ereignisse und Entwicklungen des Jahres der deutschen Einheit 1990 in Deutschland und Europa, die sich zum 30. Mal jähren. Auf der Homepage http://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de finden Sie weiterhin täglich ein histori- sches Datum in der Rubrik „heute vor …“ und weitere Ereignisse im historischen Kalendarium. Sollten Sie Fragen zu den angeführten Daten haben, stehen wir Ihnen mit Hintergrundinformationen gerne zur Ver- fügung. Die nächste Ausgabe des „Historischen Kalenderdienstes“ erscheint am 30. November 2020. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Tilman Günther | Fon: 030 31 98 95 225 | E-Mail: [email protected]. „Historischer Kalenderdienst“ 6/2020 November – Dezember 2020 – Januar 2021 Vor 75 Jahren 04.11.1945 Ungarn: Bei den freien Parlamentswahlen erreichen die Kommunisten, die auf einer getrennten Liste gegen die Sozialisten antreten, nur 16,9 Prozent der Stimmen. 06.11.1945 Der Thüringer Sozialdemokrat und Überlebende des KZ Buchenwalds, Hermann Brill, bis Juli 1945 unter amerikanischer Besatzung Regierungspräsident von Thüringen, warnt seine Partei vor der KPD. 20.12.1945 Die SMAD setzt den CDU-Vorsitzenden Andreas Hermes ab. Er hatte sich gegen die Übergriffe und Ungerechtigkeiten bei der Umsetzung der Bodenreform in der SBZ ausgesprochen. 10.01.1946 In London tritt zum ersten Mal die Generalversammlung der UNO zusammen. 11.01.1946 Ausrufung der Volksrepublik Albanien. -

Siebenter Tätigkeitsbericht Der Bundesbeauftragten Für Die Unterlagen Des Staatssicherheitsdienstes Der Ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik – 2005
Siebenter Tätigkeitsbericht der Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik – 2005 Inhaltsverzeichnis Seite Vorwort . 7 1 Die Behörde der Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (BStU). 10 1.1 Gesetzliche Grundlage: Das Stasi-Unterlagen-Gesetz . 10 1.2 Die Behörde der BStU . 10 1.2.1 Organisationsstruktur . 10 1.2.2 Wechsel in den Geschäftsbereich der Beauftragten der Bundes- regierung für Kultur und Medien (BKM) . 11 1.2.3 Der Beirat der Bundesbeauftragten. 12 1.2.4 Personalbestand und Personalentwicklung. 13 1.2.5 Haushalt . 13 1.2.6 Modernisierung der Verwaltung. 13 1.2.7 Datenschutz. 14 1.2.8 Leitbild . 14 1.3 Regionalkonzept der BStU . 15 1.4 Wichtige Ereignisse im Berichtszeitraum. 16 1.4.1 Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Sachen Dr. Helmut Kohl./.Bundesrepublik Deutschland und dessen Folgen für die Arbeit der BStU. 16 1.4.1.1 Der Rechtsstreit mit Dr. Helmut Kohl . 16 1.4.1.2 Inhaltliche Vorgaben des Bundesverwaltungsgerichts . 16 – 2 – Seite 1.4.1.3 Folgen für die Antragsbearbeitung durch die BStU . 18 1.4.1.4 Folgen für die wissenschaftliche Aufarbeitung durch die BStU . 19 1.4.2 Der 15. Jahrestag der friedlichen Revolution . 20 1.4.2.1 Berliner Hauptveranstaltung . 20 1.4.2.2 Interregionale Veranstaltungsreihe . 20 1.4.2.3 Ausstellungen und andere Aktivitäten zum 15. Jahrestag . 20 1.4.2.4 Tag der offenen Tür im ehemaligen MfS-Archiv . 21 1.4.2.5 Trilaterale Arbeitsgruppe/Flyer und Plakat zum 15. Jahrestag . 22 2 Archivbestände . 22 2.1 Grundsätzliche Arbeitsschwerpunkte . -

Analysen Und Dokumente Wissenschaftliche Reihe Des
Analysen und Dokumente Wissenschaftliche Reihe des Bundesbeauftragten Band 11 Analysen und Dokumente Wissenschaftliche Reihe des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik Herausgegeben von der Abteilung Bildung und Forschung Redaktion: Siegfried Suckut, Ehrhart Neubert, Clemens Vollnhals, Walter Süß, Roger Engelmann Karl Wilhelm Fricke Roger Engelmann „Konzentrierte Schläge“ Staatssicherheitsaktionen und politische Prozesse in der DDR 1953–1956 Ch.LinksVerlag,Berlin Die Meinungen, die in dieser Publikationsreihe geäußert werden, geben ausschließlich die Auffassungen der Autoren wieder. Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. 1. Auflage, März 1998 © Christoph Links Verlag GmbH Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin, Tel. (030) 44 02 32-0 Internet: www.linksverlag.de; [email protected] Umschlaggestaltung: KahaneDesign, Berlin ISBN 978-3-86284-035-9 Inhalt 1. Einleitung 7 1.1. Zum Verhältnis von SED und Staatssicherheit 9 1.2. Die Rolle der sowjetischen Berater 24 1.3. Persönlichkeit und Rolle Ernst Wollwebers als Chef der Staatssicherheit 30 1.4. Wollwebers neue Strategie und Taktik 36 2. Großaktionen der Staatssicherheit 42 2.1. Aktion „Feuerwerk“ – im Visier die Organisation Gehlen 42 2.2. Aktion „Pfeil“ – Ausweitung des Aktionsspektrums 47 2.3. Aktion „Blitz“ – der politische Widerstand im Zentrum der Operationen 52 3. Spionage und Widerstand 61 3.1. Berlin – Brennpunkt des Kalten Krieges und der Ost-West- Spionage 62 3.2. Die Organisation Gehlen 68 3.3. Die Ostbüros der demokratischen Parteien und des DGB 71 3.4. Die Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit 80 3.5. Der Untersuchungsausschuß Freiheitlicher Juristen 89 4. -

'Hospitality Is the Best Form of Propaganda': German Prisoners Of
The Historical Journal of Massachusetts “Hospitality Is the Best Form of Propaganda”: German Prisoners of War in Western Massachusetts, 1944-1946.” Author: John C. Bonafilia Source: Historical Journal of Massachusetts, Volume 44, No. 1, Winter 2016, pp. 44-83. Published by: Institute for Massachusetts Studies and Westfield State University You may use content in this archive for your personal, non-commercial use. Please contact the Historical Journal of Massachusetts regarding any further use of this work: [email protected] Funding for digitization of issues was provided through a generous grant from MassHumanities. Some digitized versions of the articles have been reformatted from their original, published appearance. When citing, please give the original print source (volume/number/date) but add "retrieved from HJM's online archive at http://www.westfield.ma.edu/historical-journal/. 44 Historical Journal of Massachusetts • Winter 2016 German POWs Arrive in Western Massachusetts Captured German troops enter Camp Westover Field in Chicopee Falls, Massachusetts. Many of the prisoners would go on to work as farmhands contracted out to farms in the Pioneer Valley. Undated photo. Courtesy of Air Force Historical Research Agency, Maxwell Air Force Base. 45 “Hospitality Is the Best Form of Propaganda”: German Prisoners of War in Western Massachusetts, 1944–1946 JOHN C. BONAFILIA Abstract: In October 1944, the first German prisoners of war (POWs) arrived at Camp Westover Field in Chicopee Falls, Massachusetts. Soon after, many of these prisoners were transported to farms throughout Hampshire, Franklin, and Hampden Counties to help local farmers with their harvest. The initial POW workforce numbered 250 Germans, but farmers quickly requested more to meet the demands of the community and to free up American soldiers for international service. -

Der Stacheldraht 7/2014
FÜR FREIHEIT, RECHT UND DEMOKRATIE 13017 Nr. 7/2014 Anmerkungen zur deutschen Einheit Der charmante Rowdy BGH stärkt Rechte von Heimkindern Gegründet 1991 vom BSV-Landesverband Berlin Aktuell2 Inhalt Als der deutsche Michel aufstand Aktuell Von Rainer Wagner 3 Roter Adlerorden für Horst Schüler Gespräch mit Sigmar Gabriel In wenigen Wochen begeht Deutschland Nun, ein Vierteljahrhundert nach diesen Herausgabe eingeklagt den 25. Jahrestag der Friedlichen Revo- Ereignissen, schläft er scheinbar wieder. Erinnerung und Vermächtnis lution. Der Mut und die Kraft, die damals Hin und wieder meldet er sich jedoch, von der Bevölkerung Mitteldeutschlands wenn auch noch zaghaft. Seit einigen Recht aufgebracht wurden, waren enorm und Monaten z.B. gehen in Berlin, organisiert 4 BGH stärkt Rechte der Heimkinder bis heute bewunderungswürdig. von der UOKG und vor allem von der „Scheinrechtsnachfolger“ Opfergruppe der ehemaligen DDR-Heim- Seit dem 19. Jahrhundert bezeichnet der kinder, Kameraden und andere Demo- International „deutsche Michel“ sprichwörtlich den kraten auf die Straße. Das Unrecht läßt 5 Ein ungewöhnliches Museum verschlafenen Untertan. Geschmückt mit sie nicht schlafen. Sie setzen damit ein Wollen die Koreaner die Wiedervereinigung? einer Nachtmütze, muckt er kaum auf Zeichen, daß wir noch da sind. Es ist er- Hohe Selbstmordrate bei Schülern und läßt sich von den jeweils Herrschen- freulich, daß Vertreter unterschiedlicher den geduldig leiten. Anfang der 80er Opfergruppen aus der UOKG und der Thema Jahre des 20. Jahrhunderts schien Michel VOS mit einer Stimme sprechen. Bis zu 6 Anmerkungen zur deutschen Einheit diese Einschätzung erneut zu bestätigen. 150 Demonstranten haben auf die immer Während unsere polnischen Nachbarn noch bestehenden DDR-Altlasten und die Aufarbeitung mit der Gewerkschaft Solidarno´s´c den bleibenden Folgen des SED-Unrechts hin- 8 Der charmante Rowdy Kommunisten bereits mutig widerstan- gewiesen. -

Bundesnachrichtendienst Und Mauerbau, Juli–September 1961
681 Geheimdienste haben es bekanntlich schwer, öffentliche Akzeptanz zu gewinnen – vor allem dann, wenn eine historische Zäsur sie nicht zur Öffnung ihrer Archive zwingt. Denn im Grunde können nur Eingeweihte die Relevanz ihrer Arbeit bewerten. Um so größer ist die Bedeutung der hier publizierten sensationellen Dokumente einzuschätzen, mit denen sich erstmals die Rolle des Bundesnachrichtendienstes in der Krise um den Mauerbau vom August 1961 rekonstruieren lässt. Der BND wusste, was sich anbahnte, und traf entsprechende Vorkehrungen. Matthias Uhl und Armin Wagner „Die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen nachrichtendienstlicher Aufklärung“ Bundesnachrichtendienst und Mauerbau, Juli–September 1961 Der vierzigste Jahrestag des Mauerbaus, die Abriegelung des Westteils der Stadt Berlin vom Umland und den östlichen Stadtbezirken, hat einen beträchtli- chen Forschungsschub ausgelöst. Das sich in zahlreichen Publikationen artiku- lierende Interesse der Historiker richtete sich vorrangig auf die bis dahin quellenmäßig kaum erforschten Entscheidungsprozesse in der DDR und in der Sowjetunion, auf das Verhalten der ostdeutschen Bevölkerung und auf spekta- kuläre Flucht- und Todesfälle1. Aber auch die Haltung der Westmächte und die bundesdeutsche Politik hat man nochmals untersucht, weil nun zahlreiche neue Akten zugänglich wurden. Deutlich wurde etwa, wie weit die britische Regierung zu gehen bereit war: Nach der Errichtung der Mauer regte Premierminister Harold Macmillan an, mit Moskau über die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie, die faktische Anerkennung der DDR und die Unterbrechung der politischen Bindung zwischen West-Berlin und dem Bundesgebiet zu diskutieren2. Aufmerk- samkeit fanden in diesem Zusammenhang auch Fragen einer unter anderem kul- turgeschichtlich inspirierten Diplomatiegeschichte3. Wenig Konkretes allerdings ist bislang bekannt über das Wissen der westlichen Geheimdienste im Vorfeld 1 Eine Auswahlbibliographie findet sich in www.chronik-der-mauer.de/index.php/material/ literatur. -

Sozialdemokraten Als Opfer Im Kampf Gegen Die Rote Diktatur Arbeitsmaterialien Zur Politischen Bildung
Sozialdemokraten als Opfer im Kampf gegen die rote Diktatur Arbeitsmaterialien zur politischen Bildung Dieter Rieke (Hg.) Herausgeber: Dieter Rieke Stellv. Vorsitzender des Sozialdemokratischen Arbeitskreises ehemaliger politischer Häftlinge der SBZ/DDR © 1994 by Friedrich-Ebert-Stiftung, Godesberger Allee 149, 53175 Bonn Layout: Pellens Kommunikationsdesign GmbH, Bonn Fotos: Frauendorf, Reiss, FES Lithografie: Schreck & Jasper GmbH, Bonn Druck: satz & druck gmbh, Düsseldorf Papier. Zanders Mega matt, aus 100% chlorfrei ge- bleichten Zellstoffen (TCF) und aus wiederauf- bereiteten Recyclingfasern im Verhältnis 50:50 Printed in Germany 1994 Inhalt 5 Dieter Rieke Sozialdemokraten als Opfer im Kampf gegen die rote Diktatur 7 Sozialdemokraten, die in der SBZ und frühen DDR zu hohen Freiheitsstrafen verurteilt wurden Beispiele für viele Tausende 12 Die zwangsweise Vereinigung von KPD und SPD Eine Argumentation der Grundwertekommission beim Vorstand der SPD 17 Wolfgang Leonhard Ein Kronzeuge der damaligen Zeit 22 Kurt Schumachers Manifest Freiheit in Europa und demokratische Selbstbehauptung 25 Aus der Zeit des Widerstandes 27 Wolfgang Buschfort Gefoltert und geschlagen 31 Gegner und Opfer der Zwangsvereinigung berichten 37 Der Brief aus Bautzen 42 Gedenkfeier und Vermächtnis 44 Dokumente über sowjetische Internierungslager und Strafanstalten 46 Kongreß der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 1961 Deutscher Freiheitskampf in der Sowjetzone - Begrüßungsansprache von Erich Ollenhauer - Aus der Ansprache Willy Brandts 50 Anhang mit Literaturverzeichnis 3 Sozialdemokraten als Opfer im Kampf gegen die rote Diktatur „Diese Worte sind mit Herzblut geschrieben. Man kann dies auf zweierlei Weise tun: Der Sie sind jenen Menschen gewidmet, die den Mensch „vergißt" und ignoriert die Qualen der politischen Wandel der neuen Bundesländer Vergangenheit, oder er versucht, die Etappen nicht mehr erleben und mitgestalten können. -

Ronny Heidenreich Die Organisation Gehlen Und Der Volksaufstand Am 17
Studien Nr. 1 Ronny Heidenreich Die Organisation Gehlen und der Volksaufstand am 17. Juni 1953 Unabhängige Historikerkommission zur Erforschung der Geschichte des Bundesnachrichtendienstes 1945–1968 Herausgegeben von Jost Dülffer, Klaus-Dietmar Henke, Wolfgang Krieger, Rolf-Dieter Müller Inhalt Einleitung 4 1. Die Krise in der DDR in der Berichterstattung 14 der Organisation Gehlen 2. Informationsbeschaffung während 24 des Volksaufstandes 3. Interpretationen und Erkenntnisse 41 3.1. Interpretationen: Inszenierter Aufstand 42 3.2. Erkenntnisse über den Aufstand 51 4. Manöverkritik 58 5. Zur Frage einer Beteiligung an den Unruhen 70 Schlussbemerkung 81 er durchblicken, die Diffamierungskampagne sei ein indirekter Beweis für die Einleitung Schlagkraft seiner Organisation.4 Andere Autoren, die sich mit der Geschichte des Bundesnachrichtendienstes beschäftigten, griffen diesen Aspekt bei der Darstellung des 17. Juni auf. Die Spiegel-Journalisten Hermann Zolling und Heinz Höhne schilderten erstmals in ihrer 1971 erschienenen Artikelserie Seit dem frühen Morgen des 17. Juni 1953 demonstrierten zehntausende ࡐ3XOODFKLQWHUQ´ZLHGHUEHUUDVFKHQGH9RONVDXIVWDQGGHQJU|WHQQDFKULFK- 0HQVFKHQLQGHQ6WUDHQ2VWEHUOLQV%LQQHQZHQLJHU6WXQGHQHQWOXGVLFK tendienstlichen Coup des BND verhinderte: Mit Hermann Kastner sollte ein der in den zurückliegenden Jahren aufgestaute Unmut in einem landesweiten Agent der Organisation Gehlen auf Betreiben des damaligen sowjetischen VSRQWDQHQ9RONVDXIVWDQGJHJHQGDV6('5HJLPH=XUJOHLFKHQ=HLWIXKUGHU Hochkommissars in Ostberlin, Wladimir Semjonow, -
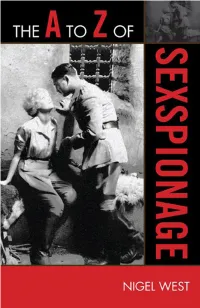
Nigel West, 2009
OTHER A TO Z GUIDES FROM THE SCARECROW PRESS, INC. 1. The A to Z of Buddhism by Charles S. Prebish, 2001. 2. The A to Z of Catholicism by William J. Collinge, 2001. 3. The A to Z of Hinduism by Bruce M. Sullivan, 2001. 4. The A to Z of Islam by Ludwig W. Adamec, 2002. 5. The A to Z of Slavery & Abolition by Martin A. Klein, 2002. 6. Terrorism: Assassins to Zealots by Sean Kendall Anderson and Stephen Sloan, 2003. 7. The A to Z of the Korean War by Paul M. Edwards, 2005. 8. The A to Z of the Cold War by Joseph Smith and Simon Davis, 2005. 9. The A to Z of the Vietnam War by Edwin E. Moise, 2005. 10. The A to Z of Science Fiction Literature by Brian Stableford, 2005. 11. The A to Z of the Holocaust by Jack R. Fischel, 2005. 12. The A to Z of Washington, D.C. by Robert Benedetto, Jane Dono- van, and Kathleen DuVall, 2005. 13. The A to Z of Taoism by Julian F. Pas, 2006. 14. The A to Z of the Renaissance by Charles G. Nauert, 2006. 15. The A to Z of Shinto by Stuart D. B. Picken, 2006. 16. The A to Z of Byzantium by John H. Rosser, 2006. 17. The A to Z of the Civil War by Terry L. Jones, 2006. 18. The A to Z of the Friends (Quakers) by Margery Post Abbott, Mary Ellen Chijioke, Pink Dandelion, and John William Oliver Jr., 2006 19.