Wissenschafts- Und Technikforschung
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Deutscher Bundestag
Deutscher Bundestag 44. Sitzung des Deutschen Bundestages am Freitag, 27.Juni 2014 Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 4 Entschließungsantrag der Abgeordneten Caren Lay, Eva Bulling-Schröter, Dr. Dietmar Bartsch, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. zu der dritten Beratung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur grundlegenden Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und zur Änderung weiterer Bestimmungen des Energiewirtschaftsrechts - Drucksachen 18/1304, 18/1573, 18/1891 und 18/1901 - Abgegebene Stimmen insgesamt: 575 Nicht abgegebene Stimmen: 56 Ja-Stimmen: 109 Nein-Stimmen: 465 Enthaltungen: 1 Ungültige: 0 Berlin, den 27.06.2014 Beginn: 10:58 Ende: 11:01 Seite: 1 Seite: 2 Seite: 2 CDU/CSU Name Ja Nein Enthaltung Ungült. Nicht abg. Stephan Albani X Katrin Albsteiger X Peter Altmaier X Artur Auernhammer X Dorothee Bär X Thomas Bareiß X Norbert Barthle X Julia Bartz X Günter Baumann X Maik Beermann X Manfred Behrens (Börde) X Veronika Bellmann X Sybille Benning X Dr. Andre Berghegger X Dr. Christoph Bergner X Ute Bertram X Peter Beyer X Steffen Bilger X Clemens Binninger X Peter Bleser X Dr. Maria Böhmer X Wolfgang Bosbach X Norbert Brackmann X Klaus Brähmig X Michael Brand X Dr. Reinhard Brandl X Helmut Brandt X Dr. Ralf Brauksiepe X Dr. Helge Braun X Heike Brehmer X Ralph Brinkhaus X Cajus Caesar X Gitta Connemann X Alexandra Dinges-Dierig X Alexander Dobrindt X Michael Donth X Thomas Dörflinger X Marie-Luise Dött X Hansjörg Durz X Jutta Eckenbach X Dr. Bernd Fabritius X Hermann Färber X Uwe Feiler X Dr. Thomas Feist X Enak Ferlemann X Ingrid Fischbach X Dirk Fischer (Hamburg) X Axel E. -

Plenarprotokoll 15/115
Plenarprotokoll 15/115 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 115. Sitzung Berlin, Freitag, den 18. Juni 2004 Inhalt: Erweiterung der Tagesordnung . 10501 A eines Gesetzes zur Neuordnung des Gentechnikrechts Nachträgliche Ausschussüberweisungen . 10501 A (Drucksachen 15/3088, 15/3344) . 10502 A Glückwünsche zum Geburtstag des Abgeord- b) Beschlussempfehlung und Bericht des neten Wolfgang Zöller . 10507 D Ausschusses für Verbraucherschutz, Er- nährung und Landwirtschaft Zusatztagesordnungspunkt 18: – zu dem Antrag der Abgeordneten Helmut Heiderich, Gerda Hasselfeldt, Erste Beratung des vom Bundesrat einge- Peter H. Carstensen (Nordstrand), wei- brachten Entwurfs eines … Gesetzes zur terer Abgeordneter und der Fraktion Beschleunigung von Verfahren der Justiz der CDU/CSU: Grüne Gentechnik in (… Justizbeschleunigungsgesetz) Deutschland nutzen – Verlässliche (Drucksache 15/1491) . 10501 B Rahmenbedingungen für einen ver- antwortungsvollen Einsatz in der Landwirtschaft schaffen Zusatztagesordnungspunkt 19: – zu dem Antrag der Abgeordneten Beschlussempfehlung des Ausschusses nach Dr. Christel Happach-Kasan, Hans- Art. 77 des Grundgesetzes (Vermittlungsaus- Michael Goldmann, Ulrike Flach, wei- schuss) zu dem Zwölften Gesetz zur Ände- terer Abgeordneter und der Fraktion rung des Arzneimittelgesetzes der FDP: Chancen der Grünen Gen- (Drucksachen 15/2109, 15/2360, 15/2849, technik nutzen – Gentechnikgesetz 15/3164, 15/3384) . 10501 B und Gentechnik-Durchführungsge- setz grundlegend korrigieren Zusatztagesordnungspunkt 20: (Drucksachen 15/2822, 15/2979, 15/3344) 10502 A Beschlussempfehlung des Ausschusses nach c) Beschlussempfehlung und Bericht des Art. 77 des Grundgesetzes (Vermittlungsaus- Ausschusses für Verbraucherschutz, Er- schuss) zu dem Gesetz zur Neuregelung des nährung und Landwirtschaft Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich – zu dem Antrag der Abgeordneten (Drucksachen 15/2327, 15/2539, 15/2593, Dr. Christel Happach-Kasan, Hans- 15/2845, 15/2864, 15/3162, 15/3385) . -

Mdbs Seite 1
MdBs Name Partei Ort/Wahlkreis Wahlkreisbüro bzw. Büro Berlin (jeweils Platz der Republik 1; 11011 Berlin) Anmerkung Stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Parlamentarischer Staatssekretär beim Wahlkreisbüro Dr. Michael Meister, Gartenstr. 19, 64625 Bensheim Bundesminister der Dr. Michael Meister CDU Bergstraße Tel: 06251 - 680 274, Fax: 06251 - 610 100 [email protected] Finanzen Franconvilleplatz 2, 68519 Viernheim, Telefon: (06204) 975748, Christine Lambrecht, MdB SPD Bergstraße Fax: (06204) 913778, [email protected] Wahlkreisbüro Charles M. Huber, Oberer Reutersberg 15, 64397 Modautal Telefon: 06167 269 0128, Fax: 06167 939 863, E-Mail: Charles M. Huber CDU Darmstadt [email protected], [email protected] (Wahlkreis) Parlamentarische Staatssekretärin beim Wahlkreisbüro Darmstadt: 06151 - 360 50 78 Bundestagsbüro Berlin: 030 - Bundesminister für Brigitte Zypries SPD Darmstadt 227 74099 [email protected] Wirtschaft und Energie Wahlkreisbüro Dr. Matthias Zimmer, c/o CDU-Frankfurt, Hanauer Landstraße 7, 60314 Frankfurt/Main, Telefon: 0160 / 785 66 02, Mitarbeiter: Frank Mohr: Dr. Matthias Zimmer CDU Frankfurt am Main I [email protected] [email protected] http://www.ulli-nissen.de/ Mit Kontaktformular Ulli Nissen, MdB, Fischerfeldstr. 7- 11, 60311 Frankfurt am Main, Ulrike Nissen SPD Frankfurt am Main II [email protected], [email protected] Hanauer Landstraße 7 – Zoopassage, 60314 Frankfurt/Main Tel.: 069 / 15 30 990, Fax: 069 / 15 30 99-20 -

Plenarprotokoll 15/56
Plenarprotokoll 15/56 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 56. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 3. Juli 2003 Inhalt: Begrüßung des Marschall des Sejm der Repu- rung als Brücke in die Steuerehr- blik Polen, Herrn Marek Borowski . 4621 C lichkeit (Drucksache 15/470) . 4583 A Begrüßung des Mitgliedes der Europäischen Kommission, Herrn Günter Verheugen . 4621 D in Verbindung mit Begrüßung des neuen Abgeordneten Michael Kauch . 4581 A Benennung des Abgeordneten Rainder Tagesordnungspunkt 19: Steenblock als stellvertretendes Mitglied im a) Antrag der Abgeordneten Dr. Michael Programmbeirat für die Sonderpostwert- Meister, Friedrich Merz, weiterer Ab- zeichen . 4581 B geordneter und der Fraktion der CDU/ Nachträgliche Ausschussüberweisung . 4582 D CSU: Steuern: Niedriger – Einfa- cher – Gerechter Erweiterung der Tagesordnung . 4581 B (Drucksache 15/1231) . 4583 A b) Antrag der Abgeordneten Dr. Hermann Zusatztagesordnungspunkt 1: Otto Solms, Dr. Andreas Pinkwart, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Abgabe einer Erklärung durch den Bun- der FDP: Steuersenkung vorziehen deskanzler: Deutschland bewegt sich – (Drucksache 15/1221) . 4583 B mehr Dynamik für Wachstum und Be- schäftigung 4583 A Gerhard Schröder, Bundeskanzler . 4583 C Dr. Angela Merkel CDU/CSU . 4587 D in Verbindung mit Franz Müntefering SPD . 4592 D Dr. Guido Westerwelle FDP . 4596 D Tagesordnungspunkt 7: Krista Sager BÜNDNIS 90/ a) Erste Beratung des von den Fraktionen DIE GRÜNEN . 4600 A der SPD und des BÜNDNISSES 90/ DIE GRÜNEN eingebrachten Ent- Dr. Guido Westerwelle FDP . 4603 B wurfs eines Gesetzes zur Förderung Krista Sager BÜNDNIS 90/ der Steuerehrlichkeit DIE GRÜNEN . 4603 C (Drucksache 15/1309) . 4583 A Michael Glos CDU/CSU . 4603 D b) Erste Beratung des von den Abgeord- neten Dr. Hermann Otto Solms, Hubertus Heil SPD . -
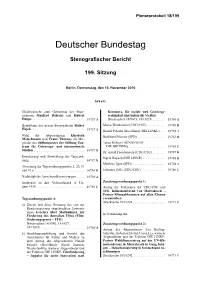
Plenarprotokoll 18/199
Plenarprotokoll 18/199 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 199. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 10. November 2016 Inhalt: Glückwünsche zum Geburtstag der Abge- Kommerz, für soziale und Genderge- ordneten Manfred Behrens und Hubert rechtigkeit und kulturelle Vielfalt Hüppe .............................. 19757 A Drucksachen 18/8073, 18/10218 ....... 19760 A Begrüßung des neuen Abgeordneten Rainer Marco Wanderwitz (CDU/CSU) .......... 19760 B Hajek .............................. 19757 A Harald Petzold (Havelland) (DIE LINKE) .. 19762 A Wahl der Abgeordneten Elisabeth Burkhard Blienert (SPD) ................ 19763 B Motschmann und Franz Thönnes als Mit- glieder des Stiftungsrates der Stiftung Zen- Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/ trum für Osteuropa- und internationale DIE GRÜNEN) ..................... 19765 C Studien ............................. 19757 B Dr. Astrid Freudenstein (CDU/CSU) ...... 19767 B Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Sigrid Hupach (DIE LINKE) ............ 19768 B nung. 19757 B Matthias Ilgen (SPD) .................. 19769 A Absetzung der Tagesordnungspunkte 5, 20, 31 und 41 a ............................. 19758 D Johannes Selle (CDU/CSU) ............. 19769 C Nachträgliche Ausschussüberweisungen ... 19759 A Gedenken an den Volksaufstand in Un- Zusatztagesordnungspunkt 1: garn 1956 ........................... 19759 C Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD: Klimakonferenz von Marrakesch – Pariser Klimaabkommen auf allen Ebenen Tagesordnungspunkt 4: vorantreiben Drucksache 18/10238 .................. 19771 C a) -
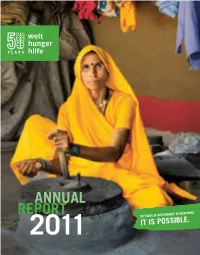
Report Ainable Development
ANNUAL REPORT 50 YEARS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 2011 IT IS POSSIBLE. WELTHUNGERHILFE FaCTS AND FIGURES By the end of 2011, Welthungerhilfe had supported with approxi- 4,656 mately EUR 2.39 billion: SUPPORTED ■ 4,656 self-help projects ■ 1,122 projects for children and SELF-HELP young people PROJECTS ■ 1,064 emergency aid programmes in 70 countries In 2011 alone, 321 projects were implemented in the following sectors: ■ 158 rural and regional development projects ■ 36 projects in the area of social integration and education ■ 31 projects to restore basic infra- structure ■ 27 emergency aid projects 158 rural ■ 27 projects related to other measures and regional ■ 21 projects in Germany develop ment ■ 13 projects to promote civil society projects structures ■ 6 supranational projects ■ 2 projects in the area of health, HIV & AIDS WELTHUNGERHILFE CONTENTS FaCTS Our vision 2 Work in Germany Advocacy 20 Conversation with the Marketing 22 Supervisory Board AND FIGURES The year 2011 24 and Executive Board 4 World map 26 Outlook 6 Project list 28 Work abroad Horn of Africa 8 Finances 30 Nepal 10 Foundation 38 Cuba 14 Liberia 16 Transparency 41 WASH 18 Welthungerhilfe 42 The seal of approval from the Central Institute for Social Issues (DZI) certifies the efficient and responsible Manage- ment of the resources that have been entrus- ted. Welthungerhilfe Welthungerhilfe has received numerous has received the seal awards for its transparent reporting of approval as a sign and excellent communication of of trust since 1992. in for mation. Member of Alliance2015, an association of European aid agencies Printing: Imprint Das Druckhaus Bernd Brümmer Printed on FSC-certified paper from Issued by: responsibly managed forests. -

Plenarprotokoll 15/138 (Einschließlich Nachtrag)
Plenarprotokoll 15/138 (einschließlich Nachtrag) Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 138. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 11. November 2004 Inhalt: Glückwünsche zum Geburtstag der Abgeord- Dr. Angelica Schwall-Düren (SPD) . 12588 A neten Eduard Lintner und Siegfried Scheffler . 12575 A Dr. Wolfgang Gerhardt (FDP) . 12590 C Ulrike Höfken (BÜNDNIS 90/ Begrüßung des neuen Abgeordneten Dr. Karl DIE GRÜNEN) . 12592 A Addicks . 12575 B Matthias Wissmann (CDU/CSU) . 12593 C Wahl der Abgeordneten Dorothee Mantel, Doris Meyer (Tapfheim), Marlene Mortler Fritz Kuhn (BÜNDNIS 90/ und Thomas Silberhorn als Schriftführer . 12575 B DIE GRÜNEN) . 12594 D Dietmar Nietan (SPD) . 12596 B Benennung der Abgeordneten Jutta Krüger- Jacob als ordentliches Mitglied für den Pro- Joseph Fischer (Frankfurt) (BÜNDNIS 90/ grammbeirat für die Sonderpostwertzeichen . 12575 B DIE GRÜNEN) . 12597 D Dr. Wolfgang Schäuble (CDU/CSU) . 12598 C Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- nung . 12575 B Joseph Fischer (Frankfurt) (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) . 12598 D Absetzung der Tagesordnungspunkte 15 a und b 12576 C Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) . 12599 B Nachträgliche Ausschussüberweisungen . 12576 C Jerzy Montag (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) . 12600 B Zur Geschäftsordnung Petra Pau (fraktionslos) . 12601 C Dr. Gesine Lötzsch (fraktionslos) . 12577 A Rüdiger Veit (SPD) . 12602 C Dr. Uwe Küster (SPD) . 12577 C Otto Schily (SPD) . 12604 C Tagesordnungspunkt 2: Dr. Georg Nüßlein (CDU/CSU) . 12605 A Jörg Vogelsänger (SPD) . Abgabe einer Erklärung der Bundesregierung 12607 A zu den Ergebnissen des Europäischen Dr. Andreas Schockenhoff (CDU/CSU) . 12608 B Rates in Brüssel am 4./5. November 2004 Joseph Fischer, Bundesminister AA . 12578 A Dr. Peter Ramsauer (CDU/CSU) . 12609 B Dr. Wolfgang Schäuble (CDU/CSU) . -

Literaturverzeichnis
Literaturverzeichnis Abels, Gabriele & Behrens, Maria (2005): ExpertInnen-Interviews in der Politikwissenschaft. Geschlech- tertheoretische und politikfeldanalytische Reflexion einer Methode. In: Bogner, Alexander; Littig, Beate & Menz, Wolfgang (Hrsg.): Das Experteninterview: Theorie, Methode, Anwendung (2. Aufla- ge). S. 173–190. Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften. Adloff, Frank & Mau, Steffen (2005): Zur Theorie der Gabe und Reziprozität. In: Adloff, Frank & Mau, Steffen (Hrsg.): Vom Geben und Nehmen: Zur Soziologie der Reziprozität. S. 9–11. Frankfurt am Main, New York, Campus Verlag Ahrens, Rupert (Hrsg.) (2003): Public Relations in der öffentlichen Diskussion. Die Affäre Hunzinger – ein PR-Missverständnis. Berlin, Media Mind Verlag. Ahrens, Rupert (2009): Politik ist nicht Persil. In: Balzer, Axel (Hrsg.): Politik als Marke: Politikvermitt- lung zwischen Kommunikation und Inszenierung. Public affairs und Politikmanagement: Band 3 (3. Auflage). S. 113–120. Berlin, Lit-Verlag. Alemann, Ulrich von (2000): Vom Korporatismus zum Lobbyismus? Die Zukunft der Verbände zwi- schen Globalisierung, Europäisierung und Berlinisierung. Abgerufen am 03. August 2008 von http://www.bpb.de/publikationen/G5AS3B,0,0,Vom_Korporatismus_zum_Lobbyismus.html#art 0. Alemann, Ulrich von & Marschall, Stefan (2002): Einleitung. Parteien in der Mediendemokratie – Medien in der Parteiendemokratie. In: Alemann, Ulrich von & Marschall, Stefan (Hrsg.): Parteien in der Me- diendemokratie. S. 15–41. Wiesbaden, Westdeutscher Verlag GmbH. Allensbach, Institut für Demoskopie GmbH (2009): Auf dem Weg von der persönlichen zur virtuelle Kommunikation? Veränderungen der Gesprächskultur in Deutschland (Allensbacher Berichte Nr. 3). Althaus, Marco (2002): Söldner der Politik. Vom Amateur zum Profi: Political Consultants in den USA und Deutschland. In: Becker-Sonnenschein, Stephan & Schwarzmeier, Manfred (Hrsg.): Vom schlichten Sein zum schönen Schein?: Kommunikationsanforderungen im Spannungsfeld von Public Relations und Politik. -

Deutscher Bundestag
Plenarprotokoll 18/130 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 130. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 15. Oktober 2015 Inhalt: Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Tagesordnungspunkt 5: nung. 12553 A a) – Zweite und dritte Beratung des von den Absetzung der Tagesordnungspunkte 5 f und Fraktionen der CDU/CSU und SPD 15. 12554 A eingebrachten Entwurfs eines Asylver- fahrensbeschleunigungsgesetzes Nachträgliche Ausschussüberweisungen .... 12554 A Drucksachen 18/6185, 18/6386 ...... 12576 D Begrüßung der Präsidentin des Seimas der – Bericht des Haushaltsausschusses ge- Republik Litauen, Frau Loreta Graužinienė . 12570 A mäß § 96 der Geschäftsordnung Drucksache 18/6387 .............. 12576 D Tagesordnungspunkt 4: b) Beschlussempfehlung und Bericht des In- Abgabe einer Regierungserklärung durch die nenausschusses Bundeskanzlerin: zum Europäischen Rat am – zu dem Antrag der Abgeordneten Ulla 15./16. Oktober 2015 in Brüssel Jelpke, Jan Korte, Sigrid Hupach, wei- terer Abgeordneter und der Fraktion Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin ....... 12554 D DIE LINKE: Flüchtlinge willkommen Dr. Sahra Wagenknecht (DIE LINKE) . 12559 A heißen – Für einen grundlegenden Wandel in der Asylpolitik Thomas Oppermann (SPD) .............. 12561 C – zu dem Antrag der Abgeordneten Ulla Jelpke, Jan Korte, Sabine Zimmermann Katrin Göring-Eckardt (BÜNDNIS 90/ (Zwickau), weiterer Abgeordneter und DIE GRÜNEN) ..................... 12564 B der Fraktion DIE LINKE: Alle Flücht- Volker Kauder (CDU/CSU) .............. 12566 A linge willkommen heißen – Gegen eine Politik -

Formatvorlage Unterrichtung (Ohne Enorm)
German Bundestag – 18th electoral term – 1 – Printed paper 18/12511 German Bundestag Printed paper 18/12511 18th electoral term 26 May 2017 Notification by the Parliamentary Advisory Council on Sustainable Development Report from the Parliamentary Advisory Council on Sustainable Development (Activity report for the 18th electoral term) Contents Page I. Basis of the reporting obligation 2 II. Mission, working methods and organisational structure 4 III. Proposal for enshrinement of the Parliamentary Advisory Council on Sustainable Development in the Rules of Procedure of the German Bundestag 5 IV. Activities 5 1. Parliamentary monitoring and support of the National Sustainability Strategy 5 (a) Opinion of the Parliamentary Advisory Council on Sustainable Development on the report of the 2013 Peer Review, entitled Sustainability – Made in Germany, of the National Sustainability Strategy 6 (b) 2014 indicator report on the state of the National Sustainability Strategy 6 (c) New 2016 edition of the German Sustainability Strategy – discussion paper on the draft of the German Sustainability Strategy 7 2. Parliamentary monitoring and support of the sustainability process in the EU framework 7 (a) Opinion on the public consultation process of the European Union on the Europe 2020 strategy 7 (b) Talks on the sustainability policy of the European Union 8 (c) Visit to Brussels 8 (d) Discussion paper – a long way to a sustainable future for the European Union 8 3. Parliamentary monitoring and support of the sustainability process in the United Nations framework 8 (a) Opinion on the global Sustainable Development Goals (SDGs) 9 (b) Moving resolutely forward, leaving no one behind – discussion paper for the meeting of the United Nations High-Level Political Forum on Sustainable Development 9 (c) Participation in the HLPF meeting 9 Printed paper 18/12511 – 2 – German Bundestag – 18th electoral term 4. -

Deutscher Bundestag
Deutscher Bundestag 152. Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 28.Januar 2016 Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 2 Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses (3. Ausschuss) zu dem Antrag der Bundesregierung Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte zur Ausbildungsunterstützung der Sicherheitskräfte der Regierung der Region Kurdistan-Irak und der irakischen Streitkräfte - Drucksachen 18/7207 und 18/7367 - Abgegebene Stimmen insgesamt: 572 Nicht abgegebene Stimmen: 58 Ja-Stimmen: 442 Nein-Stimmen: 82 Enthaltungen: 48 Ungültige: 0 Berlin, den 28.01.2016 Beginn: 14:01 Ende: 14:05 Seite: 1 Seite: 2 Seite: 2 CDU/CSU Name Ja Nein Enthaltung Ungült. Nicht abg. Stephan Albani X Katrin Albsteiger X Peter Altmaier X Artur Auernhammer X Dorothee Bär X Thomas Bareiß X Norbert Barthle X Günter Baumann X Maik Beermann X Manfred Behrens (Börde) X Veronika Bellmann X Sybille Benning X Dr. Andre Berghegger X Dr. Christoph Bergner X Ute Bertram X Peter Beyer X Steffen Bilger X Clemens Binninger X Peter Bleser X Dr. Maria Böhmer X Wolfgang Bosbach X Norbert Brackmann X Klaus Brähmig X Michael Brand X Dr. Reinhard Brandl X Helmut Brandt X Dr. Ralf Brauksiepe X Dr. Helge Braun X Heike Brehmer X Ralph Brinkhaus X Cajus Caesar X Gitta Connemann X Alexandra Dinges-Dierig X Alexander Dobrindt X Michael Donth X Thomas Dörflinger X Marie-Luise Dött X Hansjörg Durz X Iris Eberl X Jutta Eckenbach X Dr. Bernd Fabritius X Hermann Färber X Uwe Feiler X Dr. Thomas Feist X Enak Ferlemann X Ingrid Fischbach X Dirk Fischer (Hamburg) X Axel E. Fischer (Karlsruhe-Land) X Dr. -

Antrag Der Abgeordneten Wolfgang Börnsen (Bönstrup), Karin Evers-Meyer, Maria Michalk, Cornelia Behm, Serkan Tören, Dr
Deutscher Bundestag Drucksache 17/11638 17. Wahlperiode 26. 11. 2012 Antrag der Abgeordneten Wolfgang Börnsen (Bönstrup), Karin Evers-Meyer, Maria Michalk, Cornelia Behm, Serkan Tören, Dr. Hans-Peter Bartels, Norbert Barthle, Uwe Beckmeyer, Peter Beyer, Norbert Brackmann, Angelika Brunkhorst, Edelgard Bulmahn, Cajus Caesar, Gitta Connemann, Reiner Deutschmann, Mechthild Dyckmans, Sebastian Edathy, Hartwig Fischer (Göttingen), Axel E. Fischer (Karlsruhe-Land), Dr. Maria Flachsbarth, Herbert Frankenhauser, Ingo Gädechens, Hans-Michael Goldmann, Olav Gutting, Bettina Hagedorn, Dr. Christel Happach- Kasan, Helmut Heiderich, Hubertus Heil (Peine), Rudolf Henke, Ansgar Heveling, Gabriele Hiller-Ohm, Thomas Jarzombek, Hans-Werner Kammer, Memet Kilic, Ewa Klamt, Lars Klingbeil, Dr. h. c. Jürgen Koppelin, Ingbert Liebing, Matthias Lietz, Patricia Lips, Dr. Erwin Lotter, Kirsten Lühmann, Dr. Michael Luther, Caren Marks, Andreas Mattfeldt, Dr. Matthias Miersch, Jan Mücke, Petra Müller (Aachen), Burkhardt Müller-Sönksen, Dr. Philipp Murmann, Dr. Konstantin von Notz, Aydan Özog˘uz, Thomas Oppermann, Holger Ortel, Henning Otte, Rita Pawelski, Sibylle Pfeiffer, Christoph Poland, Eckhard Pols, Eckhardt Rehberg, Dr. Carola Reimann, Dr. Birgit Reinemund, Klaus Riegert, Sönke Rix, Georg Schirmbeck, Dr. Ole Schröder, Bernhard Schulte-Drüggelte, Dr. Carsten Sieling, Torsten Staffeldt, Erika Steinbach, Gero Storjohann, Karin Strenz, Thomas Strobl (Heilbronn), Kerstin Tack, Franz Thönnes, Dr. Johann Wadephul, Arfst Wagner (Schleswig), Peter Weiß (Emmendingen), Dr. Valerie Wilms, Josef Philip Winkler 20 Jahre Zeichnung der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen Der Bundestag wolle beschließen: I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: Am 5. November 1992 – vor genau 20 Jahren – wurde die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen vom Europarat zur Zeichnung aufge- legt. Mit der Charta werden die Regional- oder Minderheitensprachen als ge- fährdetes europäisches Kulturerbe geschützt und gefördert.