OK-Hörfunk OK-Fernsehen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
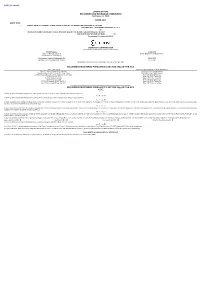
Downloading of Movies, Television Shows and Other Video Programming, Some of Which Charge a Nominal Or No Fee for Access
Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE FISCAL YEAR ENDED DECEMBER 31, 2011 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE TRANSITION PERIOD FROM TO Commission file number 001-32871 COMCAST CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) PENNSYLVANIA 27-0000798 (State or other jurisdiction of (I.R.S. Employer Identification No.) incorporation or organization) One Comcast Center, Philadelphia, PA 19103-2838 (Address of principal executive offices) (Zip Code) Registrant’s telephone number, including area code: (215) 286-1700 SECURITIES REGISTERED PURSUANT TO SECTION 12(b) OF THE ACT: Title of Each Class Name of Each Exchange on which Registered Class A Common Stock, $0.01 par value NASDAQ Global Select Market Class A Special Common Stock, $0.01 par value NASDAQ Global Select Market 2.0% Exchangeable Subordinated Debentures due 2029 New York Stock Exchange 5.50% Notes due 2029 New York Stock Exchange 6.625% Notes due 2056 New York Stock Exchange 7.00% Notes due 2055 New York Stock Exchange 8.375% Guaranteed Notes due 2013 New York Stock Exchange 9.455% Guaranteed Notes due 2022 New York Stock Exchange SECURITIES REGISTERED PURSUANT TO SECTION 12(g) OF THE ACT: NONE Indicate by check mark if the Registrant is a well-known seasoned issuer, as defined in Rule 405 of the Securities Act. Yes ☒ No ☐ Indicate by check mark if the Registrant is not required to file reports pursuant to Section 13 or Section 15(d) of the Act. -

Onlineangebote Für Jugendliche U
media perspektiven 2/2003 x50 ................................................................................................................................................................ Kern dieser Gruppe im Alter von etwa 14 bis 18 Jugend-Websites sind ideale Ergänzung Jahren zu verorten ist. Dabei ist zu berücksichti- zu den klassischen Medien gen, dass diese Zielgruppe sehr heterogen ist, nicht zuletzt in ihrer altersspezifischen Entwicklung wie U Onlineangebote für auch in Bezug auf Ausbildung, Hobbys und Inte- Jugendliche ressen. Von Christian Breunig* Im Vergleich zu den Onlineangeboten für Kinder Onlineangebote für ist es schwieriger, Websites für Jugendliche zu defi- Jugendliche sind nieren und einzugrenzen. (2) Zwar gibt es unzäh- schwieriger ein- Jugendliche verbringen vergleichsweise viel Zeit im lige Offerten, die sich explizit oder doch augen- zugrenzen als jene Internet. Laut ARD/ZDF-Online-Studie 2002 haben scheinlich an die Zielgruppe der Jugendlichen rich- für Kinder in Deutschland knapp 77 Prozent der Jugendlichen ten, was beispielsweise durch jugendspezifische im Alter von 14 bis 19 Jahren Zugang zum Inter- Inhalte (z.B. Musik für junge Zielgruppen, junge net. (1) Die Jugendlichen nutzen das Internet in- Mode, Lifestyle etc.), durch die (meistens in der zwischen durchschnittlich an knapp fünf Tagen in Duzform erfolgende) Ansprache auf der Homepage der Woche und verbringen täglich 145 Minuten im und an der (in der Regel lebendig bunten) Gestal- Netz, so lange wie keine andere Altersgruppe (vgl. tung der Internetseiten -

Sechster Jahresbericht
Sechster Jahresbericht der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) Berichtszeitraum 1. Juli 2002 bis 30. Juni 2003 Helene-Lange-Straße 18 a, 14469 Potsdam Tel: (03 31) 2 00 63 60, Fax: (03 31) 2 00 63 70 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.kek-online.de 1 Inhaltsverzeichnis Seite I Bericht über die Tätigkeit der KEK................................................................... 6 1 Zusammenfassung............................................................................................ 6 2 Medienkonzentrationskontrolle durch die KEK............................................... 7 2.1 Verfassungsrechtliche Grundlage........................................................................ 7 2.2 Aufgaben der KEK nach dem Rundfunkstaatsvertrag.......................................... 8 2.3 Mitglieder der KEK............................................................................................... 9 2.4 Geschäftsstelle.................................................................................................. 10 3 Verfahren im Berichtszeitraum....................................................................... 11 3.1 Zulassung von Fernsehveranstaltern ............................................................ 11 3.1.1 MultiThématiques GmbH – „Planet“, „Seasons“, „CineClassics“ und „Jimmy“ (Az.: KEK 146)................................................................................................... 11 3.1.2 GoldStar TV GmbH & Co. KG – „Heimatkanal“ (Az.: KEK 148) ........................ -

Sky Uk Limited
SKY UK LIMITED Annual report and financial statements For the year ended 31 December 2020 Registered number: 02906991 Directors and Officers For the year ended 31 December 2020 Directors Sky UK Limited’s (“the Company”) present Directors and those who served during the year are as follows: S J Van Rooyen (resigned 12 March 2021) C Smith A C Stylianou S Robson (appointed 15 March 2021) Secretary Sky Corporate Secretary Limited Registered office Grant Way Isleworth Middlesex United Kingdom TW7 5QD Auditor Deloitte LLP Statutory Auditor London United Kingdom 1 SKY UK LIMITED Strategic and Directors’ Reports Strategic Report The Directors present their Strategic and Directors’ report on the affairs of the Company, together with the financial statements and Auditor’s Report for the 12 month period ended 31 December 2020, with comparatives for the 18 months to 31 December 2019. The purpose of the Strategic Report is to inform members of the Company and help them assess how the Directors have performed their duty under section 172 of the Companies Act 2006 (duty to promote the Company). Business review and principal activities The Company operates together with Comcast Corporation’s other subsidiaries as a part of the Comcast Group. The Company is a wholly-owned subsidiary of Sky Limited (“Sky”) and is ultimately controlled by Comcast Corporation (“Comcast”). The Company operates the leading pay television broadcasting service in the United Kingdom (“UK”) and Ireland as well as broadband and telephony services. The Company’s principal activities consist of the operation and distribution of wholly-owned television channels via a direct-to-home (“DTH”) service and it supplies certain channels to cable operators for retransmission to their subscribers in the UK and Ireland. -

Siebter Jahresbericht
K E K Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich Siebter Jahresbericht Berichtszeitraum 1. Juli 2003 bis 30. Juni 2004 Helene-Lange-Straße 18 a 14469 Potsdam Tel: (03 31) 2 00 63 60 Fax: (03 31) 2 00 63 70 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.kek-online.de Inhaltsverzeichnis Seite 1 Überblick ................................................................................................................................. 4 2 Medienkonzentrationskontrolle durch die KEK .................................................................. 7 2.1 Verfassungsrechtliche Grundlagen .......................................................................................... 7 2.2 Aufgaben der KEK nach dem Rundfunkstaatsvertrag ............................................................. 8 3 Verfahren im Berichtszeitraum ............................................................................................. 9 3.1 Zulassung von Fernsehveranstaltern .................................................................................. 9 3.1.1 Hollywood Cinema.tv GmbH – „Hollywood Cinema“ (Az.: KEK 180)....................................... 9 3.1.2 NBC Europe GmbH – „NBC Europe“ (Az.: KEK 150) .............................................................. 9 3.1.3 TV.BERLIN NEU Produktionsgesellschaft mbH – „TV.BERLIN“ (Az.: KEK 190) .................. 10 3.1.4 VIVA Fernsehen GmbH – „VIVA“ (Az.: KEK 192) .................................................................. 11 3.1.5 LibertyTV.com S.A. – „LibertyTV Deutschland” -

Wirtschafts- Und Arbeitsmarktbericht Köln 2005/2006
Der Oberbürgermeister Wirtschafts- und Arbeitsmarktbericht Köln 2005/2006 Wirtschafts- und Arbeitsmarktbericht Köln 2005/2006 Wirtschafts- und Arbeitsmarktbericht Köln 2005/2006 Seite 1 Vorwort Standort gestärkt Die Situation am Wirtschaftsstandort Köln hat sich im Verlauf der beiden Jahre 2005 und 2006 kontinuierlich verbessert. Besonders erfreulich ist der stabile Umsatz der Kölner Industrie, der 2006 bereits im dritten Jahr in Folge auf dem Rekordniveau von über 25 Milliarden Euro notierte. Auch der mehrjährige Beschäftigungsrückgang im Produk- tionssektor ist 2006 zum Stillstand gekommen. In Bezug auf das Angebot an Arbeitsplätzen markierte das dritte Quartal 2006 eine deutliche Trendwende zum Positiven: Erstmals seit 2001 lag die Zahl der bei Kölner Unternehmen Beschäftigten über dem Vorjahreswert und erstmals seit sechs Jahren gab es in nur einem Quartal einen Zuwachs Dr. Norbert Walter-Borjans um mehr als 10.000 Arbeitsplätze. Dezernent für Wirtschaft und Liegenschaften Nach wie vor uneinheitlich verlief die Entwicklung des Kölner Einzelhandels. Während die Nebenlagen unverändert unter Anpassungsdruck stehen, ist die Aufmerksamkeit für die Spitzenlagen der City nochmals gestiegen und die Zone der hohen Ladenmieten hat sich deutlich vergrößert. Besucher- magneten wie das im Herbst 2005 eröffnete „Weltstadthaus“ von Peek & Cloppenburg oder das im März 2006 an den Start gegangene „größte Outdoor-Kaufhaus Europas“ von Globetrotter tragen zum mittlerweile inter- nationalen Renommee der Einkaufsstadt Köln bei. Weiterhin auf der Erfolgsspur ist der Kölner Büromarkt, auf dem 2006 ein neuer Rekordumsatz von 295.000 Quadratmetern erzielt wurde. Ein Großteil dieser Vermietungsleistung entfiel auf den Standort Deutz, wo unweit des KölnTriangle mit den Constantin Höfen ein weiteres attraktives Ensemble realisiert wurde. Die 2006 abgeschlossene Umsetzung des Masterplans der Koelnmesse tut ihr Übriges zur Positionierung des aufstrebenden rechtsrhei- nischen Dienstleistungsstandorts. -

Sky Uk Limited
SKY UK LIMITED Annual report and financial statements For the 18 month period ended 31 December 2019 Registered number: 02906991 Directors and Officers For the period ended 31 December 2019 Directors Sky UK Limited’s (“the Company”) present Directors and those who served during the period are as follows: A J Griffith (resigned 25 February 2019) C R Jones (resigned 25 February 2019) C J Taylor (resigned 5 June 2019) S J Van Rooyen (appointed 25 February 2019) C Smith (appointed 25 February 2019) A C Stylianou (appointed 25 February 2019) Secretary Sky Corporate Secretary Limited (appointed 5 June 2019) C J Taylor (resigned 5 June 2019) Registered office Grant Way Isleworth Middlesex United Kingdom TW7 5QD Auditor Deloitte LLP Statutory Auditor London United Kingdom 1 SKY UK LIMITED Strategic and Directors’ Reports Strategic Report The Directors present their Strategic and Directors’ report on the affairs of the Company, together with the financial statements and Auditor’s Report for the 18 month period ended 31 December 2019. During the period the Company changed its year-end from 30 June to 31 December, to align with that of Comcast Corporation, the ultimate controlling party of the Company. Accordingly, the financial statements comprise the 18 month period to 31 December 2019, with comparatives for the 12 months to 30 June 2018. The purpose of the Strategic Report is to inform members of the Company and help them assess how the directors have performed their duty under section 172 of the Companies Act 2006 (duty to promote the Company). Business review and principal activities The Company is a wholly-owned subsidiary of Sky Limited (“Sky”) (formerly Sky plc). -
Zulassungsantrag Der NBC Universal International Gmbh Für Die Fernsehprogramme DAS VIERTE Und NBC Europe
Zulassungsantrag der NBC Universal International GmbH für die Fernsehprogramme DAS VIERTE und NBC Europe Aktenzeichen: KEK 302 Beschluss In der Rundfunkangelegenheit der NBC Universal International GmbH, vertreten durch die jeweils alleinvertretungsbe- rechtigten Geschäftsführer Olaf Castritius, Patrick Vien und Wolfram Winter, There- sienstraße 47 a, 80333 München, - Antragstellerin - w e g e n Zulassung zur bundesweiten Veranstaltung des digitalen Fernsehspartenprogramms DAS VIERTE und des analogen Fernsehvollprogramms NBC Europe hat die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) auf Vorlage der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) vom 18.10.2005 aufgrund der Sit- zung vom 13.12.2005 am 21.12.2005 unter Mitwirkung ihrer Mitglieder Prof. Dr. Dörr (Vorsit- zender), Prof. Dr. Huber, Dr. Lübbert, Prof. Dr. Mailänder, Dr. Rath-Glawatz und Prof. Dr. Sjurts entschieden: Der von der NBC Germany GmbH namens der NBC Universal International GmbH mit Schreiben vom 07.10.2005 an die Landesanstalt für Medien Nord- rhein-Westfalen (LfM) beantragten Zulassung zur Veranstaltung der bundes- weit verbreiteten Fernsehprogramme DAS VIERTE und NBC Europe stehen Gründe der Sicherung der Meinungsvielfalt im Fernsehen nicht entgegen. 2 Begründung I Sachverhalt 1 Zulassungsantrag 1.1 Die NBC Germany GmbH („NBC Germany“), Düsseldorf, hält eine auf 10 Jahre befristete Zulassung der LfM vom 23.09.2005 für das digitale Fernsehspartenpro- gramm DAS VIERTE, das seit Ende September 2005 auf Sendung ist, und eine ebenfalls auf 10 Jahre befristete Zulassung der LfM vom 29.07./22.10.2003 für das analoge Fernsehvollprogramm NBC Europe. Mit Schreiben vom 07.10.2005 hat NBC Germany namens ihrer Obergesellschaft NBC Universal International GmbH („NBCU GmbH“, ehemals: Universal Studios International GmbH) beantragt, im Wege der Zulassungsänderung an ihrer Stelle die NBCU GmbH als Veranstalterin des Programms DAS VIERTE zuzulassen; dieser Antrag bezieht sich gemäß Schreiben der LfM vom 06.12.2005 auch auf das Programm NBC Europe. -

Monde.20000119.Pdf
LeMonde Job: WMQ1901--0001-0 WAS LMQ1901-1 Op.: XX Rev.: 18-01-00 T.: 11:11 S.: 111,06-Cmp.:18,11, Base : LMQPAG 21Fap: 100 No: 0362 Lcp: 700 CMYK LE MONDE INTERACTIF a La WebTV croit en son avenir ACTIVE:LMQPAG:W a Profession : busy maître des flux www.lemonde.fr 56e ANNÉE – No 17101 – 7,50 F - 1,14 EURO FRANCE MÉTROPOLITAINE MERCREDI 19 JANVIER 2000 FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY – DIRECTEUR : JEAN-MARIE COLOMBANI Après la L’européen Delors critique l’Europe marée noire b Dans un entretien au « Monde », l’ex-président de la Commission juge l’évolution de l’Europe a Bruxelles b Il regrette une « fuite en avant » dans un « grand marché unique » où le projet politique se dilue veut renforcer b Il souhaite qu’« une fédération des Etats-nations » soit à « l’avant-garde » de l’Union LE « PROJET des pères de l’Eu- l’évolution de la construction euro- membres ainsi qu’à la Turquie. Il de l’Est et en soulignant qu’ils ont les contrôles rope » est menacé de « dilution », péenne, et notamment la décision s’agit, dit-il, d’« une fuite en avant autant de légitimité que les Quinze estime Jacques Delors dans un en- prise par les gouvernements des incontournable » qui accroît « le di- à se vouloir européens, M. Delors sur le transport tretien exclusif au Monde. L’ancien Quinze, à Helsinki en décembre lemme entre élargissement et appro- estime que cette évolution dilue le président de la Commission de 1999, d’engager le processus d’élar- fondissement ». -

Fünfter Jahresbericht
Fünfter Jahresbericht der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) Berichtszeitraum 1. Juli 2001 bis 30. Juni 2002 Helene-Lange-Straße 18 a, 14469 Potsdam Tel: (03 31) 2 00 63 60, Fax: (03 31) 2 00 63 70 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.kek-online.de Inhaltsverzeichnis Seite I Bericht über die Tätigkeit der KEK................................................................... 5 1 Zusammenfassung............................................................................................ 5 2 Medienkonzentrationskontrolle durch die KEK............................................... 6 2.1 Verfassungsrechtliche Grundlage........................................................................ 6 2.2 Aufgaben der KEK nach dem Rundfunkstaatsvertrag.......................................... 7 2.3 Mitglieder der KEK............................................................................................... 8 2.4 Geschäftsstelle.................................................................................................... 9 3 Verfahren im Berichtszeitraum....................................................................... 10 3.1 Zulassungen von Fernsehveranstaltern ........................................................ 10 3.1.1 XXP TV Das Metropolenprogramm GbR – „XXP TV – Das Metropolen Programm“ (Az.: KEK 123)................................................................................ 10 3.1.2 GET ON AIR GmbH – „KidsGate“ (Az.: KEK 125) ............................................. 12 3.1.3 -

VIDEO GAMES: CLOUD INVADERS Bracing for the Netflix-Ization of Gaming
VIDEO GAMES: CLOUD INVADERS Bracing for the Netflix-ization of Gaming Citi GPS: Global Perspectives & Solutions June 2019 Citi is one of the world’s largest financial institutions, operating in all major established and emerging markets. Across these world markets, our employees conduct an ongoing multi-disciplinary conversation – accessing information, analyzing data, developing insights, and formulating advice. As our premier thought leadership product, Citi GPS is designed to help our readers navigate the global economy’s most demanding challenges and to anticipate future themes and trends in a fast-changing and interconnected world. Citi GPS accesses the best elements of our global conversation and harvests the thought leadership of a wide range of senior professionals across our firm. This is not a research report and does not constitute advice on investments or a solicitations to buy or sell any financial instruments. For more information on Citi GPS, please visit our website at www.citi.com/citigps. Authors Jason B Bazinet Thomas A Singlehurst, CFA U.S. Entertainment, Cable & Satellite Analyst Head of European Media Research Team +1-212-816-6395 | [email protected] +44-20-7986-4051 | [email protected] Kota Ezawa Mark May Co-Head of Global Technology Research U.S. Internet Analyst +81-3-6776-4640 | [email protected] +1-212-816-5564 | [email protected] Walter H Pritchard, CFA Alicia Yap, CFA U.S. Software Analyst Head of Pan-Asia Internet Research +1-415-951-1770 | [email protected] +852-2501-2773 | [email protected] Expert Commentators Luke Alvarez Ralf Reichart Wil Stephens Founding Managing Co-CEO of ESL CEO, Founder of Fusebox Partner, Hiro Capital Games Global Video Game Team Hillman Chan, CFA Arthur Lai China Internet & Media Analyst Greater China Technology Analyst +852-2501-2777 | [email protected] +852-2501-2758 | [email protected] Carrie Liu ` Atif Malik Taiwan Technology Hardware Analyst U.S. -

NBC Europe Gmbh Für Das Fernsehprogramm „NBC Europe“
Zulassungsantrag der NBC Europe GmbH für das Fernsehprogramm „NBC Europe“ Aktenzeichen: KEK 150 Beschluss In der Rundfunkangelegenheit der NBC Europe GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Helmut Keiser, Kaistra- ße 3, 40221 Düsseldorf, - Antragstellerin - Bevollmächtigte: xxx ... w e g e n Zulassung zur bundesweiten Veranstaltung des Fernsehvollprogramms „NBC Europe“ hat die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) auf Vorlage der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) vom 18.06.2002 in der Sitzung am 09.09.2003 unter Mitwirkung ihrer Mitglieder Prof. Dr. Mailänder (Vorsitzender), Prof. Dr. Huber, Dr. Lübbert und Dr. Rath-Glawatz entschieden: Der von der NBC Europe Ltd. für die NBC Europe GmbH mit Schreiben an die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) vom 11.06.2002 beantrag- ten Zulassung zur Veranstaltung eines bundesweit verbreiteten Fernsehvollpro- gramms „NBC Europe“ stehen Gründe der Sicherung der Meinungsvielfalt im Fernsehen nicht entgegen. 2 Begründung I Sachverhalt 1 Zulassungsantrag Die NBC Europe Ltd., London, hat mit Schreiben vom 11.06.2002 an die LfM für eine zwischenzeitlich erworbene 100%ige Tochtergesellschaft NBC Europe GmbH („NBC Europe“) die Zulassung zur Veranstaltung des bundesweiten Fernsehvollprogramms „NBC Europe“ beantragt. Mit GmbH-Anteils-Verkaufs- und Abtretungsvertrag vom 13.12.2002 hat die NBC Europe Ltd. sämtliche Anteile an der Petersberg 64. V V GmbH, Bonn, erworben. Sie wurde mit Gesellschafterbeschluss vom gleichen Tag in NBC Europe GmbH umbenannt und ihr Sitz mit Eintragung ins Handelsregister Düs- seldorf vom 03.04.2003 nach Düsseldorf verlegt. 2 Programmstruktur und -verbreitung Geplant ist ein 24-stündiges, frei empfangbares Vollprogramm. Die Muttergesellschaft der Antragstellerin, die NBC (Europe) Ltd., veranstaltet bereits europaweit ein gleich- namiges Programm auf der Grundlage einer von der englischen Aufsichtsbehörde ITC erteilten Lizenz.