Neukonzeption Des Lokalen Wanderwegenetzes in Der Region
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Weihnachtsgrüße Für Senioren
Pressemitteilung vom 08.01.2021 Weihnachtsgrüße für Senioren Bewohner des Seniorenstifts St. Katharina gerührt von Aufmerksamkeiten Treis-Karden – Auch in der Weihnachtszeit beschäftigte die Corona-Pandemie vor allem Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Umso schöner ist es, dass viele Menschen an die Bewohnerinnen und Bewohner sowie an die Mitarbeitenden im Seniorenstift St. Katharina in Treis-Karden gedacht haben. „Wir haben viele liebe Weihnachtsgrüße und Geschenke erhalten. Der DRK Ortsverband Treis-Karden hat unseren Senioren jeweils Gutscheine für Rossmann, Edeka und den Friseur geschenkt, zudem bekamen alle Bewohner und jeder Mitarbeitende einen Christstollen. Überreicht wurden sie von Jürgen Claßen, dem Ortsvorsitzenden des DRK“, erzählt Diana Retterath, Leiterin des Sozialen Dienstes der Seniorenreinrichtung. Die Schüler der Schulen in Lutzerath und Treis-Karden haben fleißig gebastelt und Briefe geschrieben. Die Kinder der KITA Treis-Karden haben 100 selbstgebastelte Engel geschickt. „Zwei Mädchen aus Treis haben uns 74 Karten gebastelt. Laut ihrer Mutter hatten sie die Idee, für jeden Bewohner und jede Bewohnerin einen kleinen Gruß zu senden“, ergänzt Retterath. „Die Enkelin einer ehemaligen Bewohnerin hat uns für Senioren und Mitarbeitende ein Überraschungspaket geschickt und wir haben viele Briefe über die Aktion Pinsel-Post des Sozialverbandes VdK Rheinland-Pfalz erhalten. Für all die lieben Grüße und Geschenke bedanken wir uns ganz herzlich. Einige Bewohnerinnen waren zu Tränen gerührt. Es ist ein wunderbares Gefühl, dass so viele Menschen an unsere Seniorinnen und Senioren und natürlich auch an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denken“, sagt Diana Retterath. Bildquelle: Seniorenstift St. Katharina Bildunterschrift: Mit Selbstgebasteltem haben viele Kinder den Bewohnerinnen und Bewohnern des Seniorenstifts St. Katharina eine große Freude bereitet. -

Schulchronik Kalenborn
- 1 - Schulchronik Kalenborn transkribiert und kommentiert von Peter Leuschen Stand: 17. November 2016 - 2 - Vorbemerkung Im Archiv der Grundschule Gerolstein wird als "Schulchronik Kalenborn" ein Satz von Dokumenten geführt, der ursprünglich in der Schule Kalenborn verwahrt wurde und die Jahre von 1.5.1919 bis zum 1.8.1973 umfasst, zu welchem Datum die Schule aufgelöst wurde und die Unterlagen an die Rechtsnachfolgerin übergingen, nämlich die Grundschule Gerolstein. Deren Hausmeister, Herr Dahm, stellte die Originale dankenswerterweise zur Einsicht zur Verfügung. Als ich meinen erwachsenen Kindern die älteren Bände zeigte, gab es nur verständnisloses Kopfschütteln – die Sütterlinschrift1 ist größtenteils schon für meine Generation nicht mehr entzifferbar. Insofern hätte ein einfaches Einscannen der Hefte zwar deren visuellen Zugang vorerst gesichert, aber keinesfalls deren Rezipierbarkeit. Daher entschloss ich mich zu der zeitraubenden Prozedur, die Texte zu transkribieren und digital für das Internet zugänglich zu machen. Bei der Texterfassung wurde deutlich, dass die Fülle des Materials durch Orts-2, Personen-3 und Sachregister4 erschließbar gemacht werden sollte, woraus folgerte, dass die sechs Einzelteile zu einem Gesamtband zusammenzufassen sind, damit die von der Software zur Textverarbeitung bereitgestellte automatische Indexierung Seitenreferenzen über den Gesamttext erstellen kann. Andererseits sollte der Seitenlauf beibehalten werden, damit an jeder Stelle zitierbar ist, um welche Seite aus welchem der sechs Teile es sich handelt. -
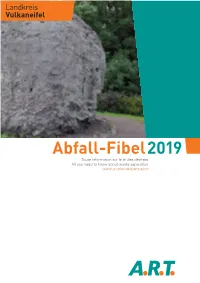
ART Fibel2019 VULKAN.Indd
Landkreis Vulkaneifel Abfall-Fibel2019 Toute information sur le tri des déchets All you need to know about waste separation www.art-trier.de/translation Liebe Kundinnen und Kunden, seit nunmehr drei Jahren sind wir Ihr Partner in allen Belangen der Abfall- und VERANTWORTUNG Kreislaufwirtschaft. Sei es bei der Abholung Ihrer Abfälle durch die von uns beauftragten Partnerunternehmen oder bei der Beratung und Betreuung durch unsere Mitarbeiter im Kundenzentrum – wir sind gerne für Sie da. Mit Ihnen machen wir die Abfallwirtschaft der Region fi t für die Zukunft. Denn auch beim „Müll“ bleibt die Zeit nicht stehen. Diskussionen um Mikroplastik, Verschmutzung der Weltmeere, Coffee-to-Go Becher sind DASEINS nur einige der Anzeichen für die Forderung nach mehr Bewusstsein im Umgang mit unseren Abfällen. Die Abfallwirtschaft und Ihre Wertstoffe sind ein zentraler Bestandteil der Ressourcenschonung. Nachhaltigkeit bedeutet in erster Linie Abfallvermeidung. Gemeinsam weniger Abfall zu produzieren, ist unser aller Pfl icht. Hierfür Anreize zu schaffen liegt in unserer Verantwortung. VORSORGE Abfälle sind Wertstoffe Die fachgerechte Verwertung der Abfälle aus der Region - jährlich über 200.000 Tonnen - und die verantwortungsvolle Nachsorge von mehr als 20 Deponien, stellen uns für die Zukunft vor große fi nanzielle Herausforderungen. Als unternehmerisch handelnder öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger ist es unsere Pfl icht und 2 Verantwortung, Preise zu vergleichen und kosteneffi zient zu handeln. 3 Nicht nur im privaten Bereich sind die Kosten für Dienstleistungen erheblich gestiegen. Diesen Kostensteigerungen wirken wir – soweit wie möglich - durch optimierte Prozesse und die Nutzung von Synergiepotenzialen entgegen. Wir möchten für Sie ein moderner, zukunftssicherer Zweckverband sein, der seinen Kundinnen und Kunden den bestmöglichen Service zu fairen Gebühren bietet. -

EIFELVEREIN Ortsgruppe Gillenfeld Gegründet 1888
EIFELVEREIN Ortsgruppe Gillenfeld gegründet 1888 Drei-Herren-Stein Wanderungen und Veranstaltungen 2020 0 1 Liebe Wanderfreunde, unsere Wanderführer bieten Ihnen auch im Jahr 2020 wieder schöne Wanderungen in unserer Region, an der Mosel und im Hunsrück an. Nehmen Sie dieses Angebot bitte an. Sie lernen so einen weiteren Teil unserer schönen Vulkaneifel und Landschaften unserer Nachbarregion kennen. Wir wünschen Ihnen viel Freude und angenehmes Wanderwetter in fröhlicher Gesellschaft. „Frisch auf!“ Der Vorstand 2 Anschriftenverzeichnis: Vorsitzender: Karl-Heinz Schlifter, Im Steinpesch 14a 54558 Gillenfeld, Tel.: 0 65 73 / 95 31 10 Stellv. Vorsitzender: Günter Schenk, Holzmaarstr. 27 54558 Gillenfeld, Tel.: 0 65 73 / 14 89 Schatzmeister: Dietmar Geib, Strohner Str. 15 54558 Gillenfeld, Tel.: 0 65 73 / 6 28 Schriftführer: Bärbel Busch, Schwalbenweg 10 54558 Gillenfeld, Tel.: 0 65 73 / 17 51 Wanderwart: Herbert Peck, Vulkanstraße (Feriendorf) 54558 Gillenfeld, Tel.: 0 162 / 428 2796 Vereinshauswart: Werner Busch, Bergweg 12 54558 Gillenfeld, Tel.: 0 65 73 / 18 13 Kulturwart: Hildegard Rauen, Holzmaarstr. 1 54558 Gillenfeld, Tel.: 0 65 73 / 2 14 3 Wanderführer: Hildegard Diewald, In der Lunn 15 54558 Gillenfeld, Tel.: 0 65 73 / 5 23 Lothar Posdziech, Keltenweg 15 54558 Gillenfeld, Tel.: 0 65 73 / 99 61 63 Dietmar Geib, Strohner Str. 15 54558 Gillenfeld, Tel.: 0 65 73 / 6 28 Helmut Lindner, Dauner Str. 3 54552 Strotzbüsch, Tel.: 0 65 73 / 14 37 Günter Schenk, Holzmaarstr. 27 54558 Gillenfeld, Tel.: 0 65 73 / 14 89 Karl-Heinz Schlifter, Im Steinpesch 14a 54558 Gillenfeld, Tel.: 0 65 73 / 95 31 10 Horst Thomas, Alfbachweg 6 54558 Gillenfeld, Tel.: 0 65 73 / 17 27 Michael Zimmer, Mühlenstr. -

Classifiche Comune Di Brockscheid
27/09/2021 Mappe, analisi e statistiche sulla popolazione residente Bilancio demografico, trend della popolazione e delle famiglie, classi di età ed età media, stato civile e stranieri Skip Navigation Links GERMANIA / Rheinland-Pfalz / Provincia di Vulkaneifel, Landkreis / Brockscheid Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAFIA ECONOMIA CLASSIFICHE CERCA GERMANIA Comuni Powered by Page 2 Arbach Affianca >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Hillesheim AdminstatBasberg logo DEMOGRAFIA ECONOMIA CLASSIFICHE CERCA Hinterweiler Beinhausen GERMANIA Höchstberg Bereborn Hohenfels- Berenbach Essingen Berlingen Horperath Berndorf Hörscheid Betteldorf Hörschhausen Birgel Immerath Birresborn Jünkerath Bleckhausen Kalenborn- Bodenbach Scheuern Bongard Kaperich Borler Katzwinkel Boxberg, Kr Kelberg Daun Kerpen (Eifel) Brockscheid Kerschenbach Brücktal Kirchweiler Darscheid Kirsbach Daun Kolverath Demerath Kopp Densborn Kötterichen Deudesfeld Kradenbach Dockweiler Lirstal Dohm-Lammersdorf Lissendorf Drees Mannebach, Dreis-Brück Eifel Duppach Mehren, Kr Ellscheid Daun Esch b Meisburg Gerolstein Mosbruch Feusdorf Mückeln Gefell, Kr Daun Mürlenbach Gelenberg Neichen Gerolstein Nerdlen Gillenfeld Neroth Gönnersdorf b Powered by Page 3 Gerolstein Niederstadtfeld L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Gunderath Nitz Adminstat logo DEMOGRAFIA ECONOMIA CLASSIFICHE CERCA Hallschlag GERMANIANohn Oberbettingen Oberehe- Stroheich Oberelz Province Oberstadtfeld Ormont Pelm Reimerath Retterath Reuth, -

Jahrbuch Landkreis Vulkaneifel
S. 1 / 25 Inhaltsverzeichnis zum Jahrbuch des Landkreises Vulkaneifel 2007-2020 Quelle: https://www.heimatjahrbuch-vulkaneifel.de/ und eigene Recherchen Bearbeitet von K. Baltus, 52353 Düren, mailto:[email protected] Autor(en): Titel des Beitrags Fundstelle ONNERTZ, Heinz: Vorwort in: Jg. 2007, S. 7 Ehrungen 2005 - 2006 in: Jg. 2007, S. 8 Visitenkarte - Kurzinformation Landkreis Vulkaneifel in: Jg. 2007, S. 10 HEINZEN, Thekla: Gedicht: Der Tag des Herrn in: Jg. 2007, S. 14 KLASSMANN, Helmut: Landkreis Vulkaneifel in: Jg. 2007, S. 15 WILLEMS, Carola: Ruanda-Tag 2006 in: Jg. 2007, S. 16 HIMMELS, Petra: Landwirtschaft im Umbruch in: Jg. 2007, S. 18 BAUER, Alfred: LEADER+ in: Jg. 2007, S. 20 MÜLLER, Rudolf: Zukunftsinitiative Eifel in: Jg. 2007, S. 24 HOFFMANN, Heinz-Peter: Aktuelles Kreisgeschehen in: Jg. 2007, S. 26 THÖMMES, Matthias: Kinderspiele im Jahreslauf - früher und heute in: Jg. 2007, S. 31 FREISINGER, Ingeborg: Gedicht: Halbmond in: Jg. 2007, S. 34 MATHAR, Jürgen: "Kriegerklären-Spiel" in: Jg. 2007, S. 35 WINTER, Gustav: Zeitvertreib beim Viehhüten in: Jg. 2007, S. 36 SCHÖNBERG, Marianne: Spielen als Zeitvertreib in: Jg. 2007, S. 37 KÖRNER-TE REH, Gretel: Eins, zwei,drei, vier Eckstein in: Jg. 2007, S. 39 FREISINGER, Ingeborg: Gedicht: Lachen und Weinen in: Jg. 2007, S. 40 RETTERATH, Tamara: Großes Vergnügen: Klickerspiel in: Jg. 2007, S. 41 PRÄMAßING, Maria: Spielesammlung in: Jg. 2007, S. 42 PINN, Maria-Agnes: Wettkämpfe in früherer Zeit in: Jg. 2007, S. 43 BENDER, Gisela: Kindheit im Dorf in: Jg. 2007, S. 46 EIS, Karl-Peter: Fußballspielen in: Jg. 2007, S. 48 MICHELS, Leo: Pèèpse un Pèifja - Pääpsen und Pfeifchen in: Jg. -

Motorradtour-Vulkaneifel.Pdf
Tourenkarte: Rund um den Nürburgring Burg Blankenheim (i.Pl.) Hümmel Ober- Rohr l Schuld Liers Tourenvorschlag schömbach Ahrquelle Ohlenhard Wershofen Blankenheimer- Dümpelfeld a Wolfert dorf Blankenheim Ahr t Alternative Route Vellerhof Fuchshofen Reetz Eichenbach Insul n Herschbach Schmidtheim 51 (i.Pl.) Ahr Winnerath Neuhaus Aremberg Niederadenau n SchlSchlossoss 258 Lommersdorf Lückenbach Neuhof Nonnenbach 257 e SSchmidtheimchmidtheim 623 Simmelerhof Reifferscheid Abtei Gertrudenhof Freilingen Aremberg Antweiler D Kaltenborn Maria Gilgenbach N 632 Frieden Hüngersdorf (i.Pl.) Rodder Leimbach Berk Ripsdorf Müsch Losheimergraben Ruine Waldorf Ruine Ahrhütte Jammelshofen Frauenkron Baasem Dorsel ADENAU Kronenburg Dahlem Dollendorf Neuhof Honerath Wirft Hohe Acht Kronenburg Dollendorf Hoffeld 258 747 Lanzerath Losheim Esch BREIDSCHEID Scheid Am Leger Alendorf Uedelhoven Kronenburger 421 Wimbach Herschbroich (i.Pl.) Hüllscheid Hallschlag See Mirbach Barweiler Ruine Nürburgring- Jünkerath Feusdorf Trierscheid Kotten- NürburgNürburg Nordschleife NORDRHEIN- born Stadtkyll Pomster Kehr Kerschenbach WESTFALEN Üxheim Quiddelbach Döttingen Wiesbaum RHEINLAND- Dankerath Meuspath Krewinkel Auf dem Nürburg Baar Ormont Schüller Nohn Drees Manderfeld Steinberg Kruchler PFALZ Senscheid Wiesemscheid Nitz E29 Birgel Nürburgring Ourtal Gönnersdorf Nollenbach Bauler Müllen- Roth bei Prüm 654 51 (i.Pl.) Lind Schönfeld Lissendorf Kerpen bach Kirsbach Neuenstein (Eifel) Borler Meisenthal Welcherath Auw bei Prüm Vulkaneifel Brücktal Lehnerath Boden- Kobscheid -

P F a R R B R I
Pfarrbrief für die Brockscheid - Darscheid - Demerath - Gillenfeld - Mehren - Schalkenmehren - Strohn - Strotzbüsch 52. Jahrgang, Nr. 4 www.pg-gillenfeld.de 27.03.2021 – 25.04.2021 „Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen.“ (Lk. 24,34) - 1 - Liebe Gemeindemitglieder, die letzten Monate waren für uns alle keine einfache Zeit. Die Corona-Pandemie hat nicht nur unser Land, sondern die ganze Welt aus ihrem normalen Trott ge- nommen. Wir alle mussten Einschränkungen hinnehmen und viele mussten durch die Lockdowns um ihre Existenz fürchten und einigen hat es diese sogar gekostet. Viele Menschen haben unter dem Virus körperlich gelitten und viele sind auch daran gestorben. Unser Leben hat in dieser Zeit viele unserer Pläne zerstört. Diese Zeit macht uns Angst. Im kirchlichen Leben dürfen wir nicht mehr singen, unsere festlichen Gottes- dienste an Ostern und Weihnachten nicht so feiern wie gewohnt, wenige Taufen und die meisten Hochzeiten wurden in der Hoffnung auf das Ende der Corona- zeit, verschoben. Doch unsere Toten haben wir beerdigt. Beim Tod gibt es kein Verschieben und auch kein Vertrösten. Er ist endgültig. Das wussten auch die Jünger Jesu, als ihnen klar wurde, dass er der Hinrichtung am Kreuz auf Golgotha nicht mehr entgehen konnte. Endgültig waren die Jünger auch in ihrer Enttäuschung und in ihren Träumen von dem Jesus, der sie erretten wird. Desillusioniert gingen sie nach Hause, mit dem Ziel, wieder in ihren Alltag als Fischer oder Handwerker in ihre Dörfer zurückzukehren. Ihnen war bestimmt auch bewusst, dass sie sich viele Fragen und Vorwürfe der anderen anhören müssen. Umso überraschter und erschrockener haben sie auf die Aussage der Frauen, dass das Grab leer sei, reagiert. -

Ausgabe 47/2020 Wir Lieben Karneval …
PA sämtl. HH MITTEILUNGSBLATT FÜR DEN BEREICH DER Verbandsgemeinde Daun GESUNDLAND VULKANEIFEL WOCHENBLATT MIT AMTLICHEN BEKANNTMACHUNGEN MODERN . GESUND . INNOVATIV Jahrgang 49 Freitag, den 20. November 2020 Ausgabe 47/2020 Wir lieben Karneval … Aber auch wir müssen uns der aktuellen Situation ... und haben stellen und in der daher die kommenden Session 2020/21 letzten Jahre auf öffentliche Vereins- bzw. Jahrzehnte veranstaltungen verzichten. kräftig mit euch gefeiert, geschunkelt und gelacht. Mit der Aktion „Eifel Karneval Digital“ werden wir in der Ganz 5. Jahreszeit ohne unser bei euch sein. Brauchtum Schaut auf Karneval? www.eifel-karneval-digital.de Nein, das geht oder den sozialen Netzwerken dann doch nicht. wie es weiter geht und lasst euch überraschen! Die teilnehmenden Vereine: KV Dockweiler Dauner Narrenzunft e.V. KV Kirchweiler Beuelspatzen e.V. Karnevalsverein Mehren e.V. KV Moareulen Üdersdorfer Aarleyspatzen e.V. Gillenfeld Daun - 2 - Ausgabe 47/2020 Bereitschaftsdienste in der Corona-Krise: Corona-Ambulanz Vulkaneifel - Standort Daun 0151 701 881 39 Hinweis zu Textveröfentlichungen E-Mail: corona-ambulanz-daun@gmxde während der Corona-Pandemie Zugang nur nach vorheriger Terminvereinbarung Corona- und Infekt-Praxis Daun (CIPD) An alle Einsender von Artikeln! der BAG Drs med Pitzen, Trierer Straße 12, Daun Aufgrund der immer noch akuten Lage, bitten wir Sie ein- Tel 0151 269 407 34 dringlich den Umfang Ihrer Textbeiträge auf das Nötigste zu Ärztlicher Bereitschaftsdienst beschränken und auf umfangreiche Berichterstattungen zu - wenn Hausbesuch erforderlich ist - verzichten. Wir geben unser Bestes Tel 116 117 das Erscheinen aller Amts- und Mitteilungsblätter auch weiter- 24-Stunden-Hotline hin sicherzustellen und zählen hierbei auf Ihre Mithilfe! Beratung und Weiterleitung zu Fieberambulanz/Corona-Test Wir bitten um Verständnis, sollten Texte nicht in dem einge- bei typischen Symptomen wie Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Muskel- sandten Umfang veröfentlicht werden. -

Niederstadtfeld & Oberstadtfeld
Niederstadtfeld & Oberstadtfeld Alphabetische Liste Familiennamen Ortschaften Alphabetische Liste Alphabetische Liste - 6.942 Personen Niederstadtfeld & Oberstadtfeld 1697-1903 Autor: Matthias Heinen A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z NN A ADAMS Anna Catharina *1824 Niederstadtfeld 1849 SCHRÖDER Christoph ADAMS Catharina *u1780 Seffern 1809 STEFFES Simon ADAMS Gertrud *1829 Niederstadtfeld ADAMS Heinrich *u1798 Leiwen 1823 THULL Susanna ADAMS Leonhard +<1809, Seffern <1780 FRIEDRICHS Otilia ADAMS Maria Catharina *1825 Niederstadtfeld 1862 JARDIN, GARDIN Johann Peter ADAMS Maria Catharina +1964, *Meisburg 1896 MÜLLER Anton ADAMS Matthias *1839 Niederstadtfeld ADAMS Peter *e1768, Leiwen <1798 KRICH Elisabeth ADAMS Sebastian *1828 Niederstadtfeld ADAMS Simon *1834 Niederstadtfeld ADAMS Susanna *e1734, Raum Bescheid u1764 KOLZ Georg ADAMS Susanna *1832 Niederstadtfeld AHLES Anna Maria *e1727, Raum Manderscheid <1757 KAIL Johann ALBERT Angela +1821 Gerolstein 1787 GITZEN Kaspar ALOFFS Johann +>1563, Niederstadtfeld ALTMEIER Andreas *1855 Oberstadtfeld ALTMEIER Barbara *1853 Oberstadtfeld ALTMEIER Elisabeth *1859 Oberstadtfeld ALTMEIER Elisabeth *1863 Oberstadtfeld ALTMEIER Heinrich +1850 Weiersbach <1827 KLEIN Anna Margaretha ALTMEIER Jakob *1827 Wenigerath 1852 THULL Elisabeth ALTMEIER Jakob *1865 Oberstadtfeld ALTMEIER Maria *1861 Oberstadtfeld AMAN Johann *1801 Niederstadtfeld AMAN Johann Matthias *1763 Manderscheid 1802 EVEN Anna Catharina AMAN Johann Philipp *1733 Manderscheid <1763 HEID Franziska AMAN Susanna *1795 Niederstadtfeld -

MAY 21 to 25, 2018
Abstracts Volume MAY 21 to 25, 2018 7th international OLOT - CATALONIA - SPAIN DL GI 743-2018 ISBN 978-84-09-01627-3 Cover Photo: ACGAX. Servei d’Imatges. Fons Ajuntament d’Olot. Autor: Eduard Masdeu Authors: Xavier Bolós and Joan Martí Abstracts Volume MAY 21 to 25, 2018 Scientific Committee Members IN ALPHABETICAL ORDER Patrick BACHÈLERY Károly NÉMETH Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand Massey University (New Zealand) and Laboratoire Magmas et Volcans (France) Oriol OMS Pierre BOIVIN Universitat Autònoma de Barcelona (Spain) Laboratoire Magmas et Volcans (France) Michael ORT Xavier BOLÓS Northern Arizona University (USA) Univesidad Nacional Autónoma de México (Mexico) Pierre-Simon ROSS Gerardo CARRASCO Institut National de la Recherche Scientifique (Canada) Universidad Nacional Autónoma de México (Mexico) Dmitri ROUWET Shane CRONIN Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Italy) The University of Auckland (New Zealand) Claus SIEBE Gabor KERESZTURI Universidad Nacional Autónoma de México (Mexico) Massey University (New Zealand) Ian SMITH Jiaqi LIU The University of Auckland (New Zealand) Chinese Academy of Sciences (China) Giovanni SOSA Didier LAPORTE Universidad Nacional Autónoma de México (Mexico) Laboratoire Magmas et Volcans (France) Gregg VALENTINE Volker LORENZ University at Buffalo (USA) University of Wuerzburg (Germany) Benjamin VAN WYK DE VRIES José Luís MACÍAS Observatoire de Physique de Globe de Clermont- Ferrand Universidad Nacional Autónoma de México (Mexico) and Laboratoire Magmas et Volcans (France) -
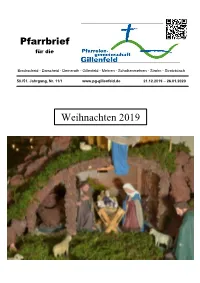
P F a R R B R I
Pfarrbrief für die Brockscheid - Darscheid - Demerath - Gillenfeld - Mehren - Schalkenmehren - Strohn - Strotzbüsch 50./51. Jahrgang, Nr. 11/1 www.pg-gillenfeld.de 21.12.2019 – 26.01.2020 Weihnachten 2019 - 1 - - 2 - Sternsinger in Brockscheid, Strotzbüsch, Gillenfeld, Schalkenmehren, Strohn Messdienerwochenende auf der Marienburg 2018 - 3 - Ehrenamtsweihnachtsfeier Kinderkrippenfeier Fronleichnamsaltäre - 4 - Weltgebetstag der Frauen in Strotzbüsch Vater-Kind-Wochenende im Naturerlebniszentrum Dar- scheid - 5 - Liebe Mitchristen, es scheint gerade, dass die romantische Weihnachtsstimmung nicht gerade zur aktuellen Situation der Kirche passt. Die Meldungen zum Missbrauch, zur Aufarbeitung und zur Entschädigung. Dann die Synode, die viele Leute verunsichert: Was bleibt noch von Kirche vor Ort? Werden die Ehrenamt- lichen noch gebraucht? Wird das nicht alles zu groß? Dann auch noch der Stopp aus Rom. Dazu kommt bei uns auch noch die schon lange andau- ernde Vakanz, die nun mal trotz aller Bemühungen eine Mangelsituation darstellt, in der auch so manches an Interesse und Engagement zurückgeht. Richten wir den Blick einmal auf die Krippe. Vielleicht war die Situation damals für Josef ähnlich unsicher: Seine Verlobte wurde plötzlich jung- fräulich schwanger. Zwar sagte der Engel ihm im Traum, dass dieses Kind der Erlöser ist, aber trotzdem war es wahrscheinlich schwer für ihn, ruhig zu bleiben. Schließlich folgte der lange beschwerliche Fußweg mit seiner schwangeren Frau nach Bethlehem und dann gab es auch noch keine freie Übernachtungsmöglichkeit. Am Ende folgte die Geburt im kalten, dunk- len, verlassenen Stall. Aus Josefs Sicht war das sicher alles andere als ro- mantisch, sondern eher besorgniserregend und deprimierend. Und trotz allem: Josef gibt nicht auf. Er trotzt den Widrigkeiten, hält durch.