Wettbewerblicher Dialog Stadtteil Grasbrook
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

„Zukunft Der Universität Hamburg“
Untersuchungsgebiet Bundesstraße Untersuchungsgebiet Von Melle Park Gesamtgebiet Rotherbaum Universitätshauptgebäude Gesamtgebiet Kleiner Grasbrook Untersuchungsgebiet A Überseezentrum U.- Geb. C1 Untersuchungsgebiet B1 Nördlicher O‘swaldkai U.- Geb. C2 Untersuchungsgebiet B2 südlicher O‘swaldkai Abschlussbericht der Online-Diskussion „Zukunft der Universität Hamburg“ Impressum Ergebnisbericht zur Online-Diskussion „Zukunft der Universität Hamburg“ www.zukunft-uni.hamburg.de Im Auftrag der Behörde für Wissenschaft und Forschung der Freien und Hansestadt Hamburg realisierte die TuTech Innovation GmbH vom 6. April - 29. April 2009 die Online-Diskussion „Zu- kunft der Universität Hamburg“. TuTech Innovation GmbH Rolf Lührs Birgit Hohberg Abteilung Interaktive Kommunikation Harburger Schloßstraße 6-12 21079 Hamburg Telefon: +49 40 76629-6371 Telefax: +49 40 76629-6379 E-Mail: [email protected] Internet: www.tutech.de/ik © TuTech Innovation GmbH 2009 Abschlussbericht der Online-Diskussion „Zukunft der Universität Hamburg“ Inhaltsverzeichnis Abschlussbericht der Online-Diskussion „Zukunft der Universität Hamburg“ 1 Inhaltsverzeichnis Kurzzusammenfassung .........................................................................................................3 Das Diskussionsthema .........................................................................................................3 Die Diskussionsstruktur und -elemente ...............................................................................4 Die Diskussionsergebnisse ..................................................................................................5 -

Was Bedeutet Olympia Für Die Elbinseln?
Stadtteilzeitung von Vielen für Alle Juni/Juli 2015 - 21. Jahrgang - Ausgabe 6 Schwerpunktthema: Was bedeutet Olympia für die Elbinseln? Der kleine Grasbrook soll „Olympic City“ werden - die Auswirkungen auf Wilhelmsburg und die Veddel wären immens. Foto: Bernhard Kaufmann EDITORIAL • AN DIESEM WOCHENENDE Liebe Leserinnen und Leser, durch den Ausverkauf bekommen wir jetzt Aus dem Inhalt zwei Computer für den Preis des einen, für Glück im Unglück – so nennt man das! den wir bereits ein Angebot eingeholt hat- Schwerpunktthema Statt dass wir uns nur um unser eigent- ten. Und wie gut, dass die Schreibstube Was bedeutet Olympia für die Elbinseln? liches Anliegen, über Wilhelmsburgensi- mit ihrem eigenen Computer bei uns ein- S. 3 - 6 en zu berichten, kümmern können, funkt gezogen ist. So war die Erstellung dieser uns die Technik immer wieder dazwischen. Kultur Aktuell Ausgabe gesichert. Als Sahnehäubchen Wir hatten gerade festgestellt, dass un- Das waren 48h Wilhelmsburg! S. 7 obendrauf kommt noch, dass unser tech- ser zweiter, älterer Computer ersetzt wer- nischer Fachmann, Klaus D. Müller, tat- CHANCEN den muss, da er mit den Bankdaten nicht Bericht aus einer Deutsch-Vorbe- sächlich aus Australien wieder zurück ist mehr kompatibel ist, da haute es vorige reitungsklasse für Flüchtlinge S. 8 - 9 und sich gleich wieder bei uns gemeldet Woche richtig rein und unser Hauptcom- Matheolympiade an der NMS S. 9 hat, um zu helfen. puter, auf dem der Wilhelmsburger Insel- Und obendrein haben sich auf unseren Aktuell Rundblick erstellt wird, gab den Geist auf. Aufruf im letzten WIR mehrere Damen zur Verdienstkreuz für H. Henatsch S. 10 Soweit das Unglück. -

After 88 Years - Four-Masted Barque PEKING Back in Her Homeport Hamburg
Four-masted barque PEKING - shifting Wewelfsfleth to Hamburg - September 2020 After 88 Years - Four-masted Barque PEKING Back In Her Homeport Hamburg Four-masted barque PEKING - shifting Wewelfsfleth to Hamburg - September 2020 On February 25, 1911 - 109 years ago - the four-masted barque PEKING was launched for the Hamburg ship- ping company F. Laeisz at the Blohm & Voss shipyard in Hamburg. The 115-metres long, and 14.40 metres wide cargo sailing ship had no engine, and was robustly constructed for transporting saltpetre from the Chilean coast to European ports. The ship owner’s tradition of naming their ships with words beginning with the letter “P”, as well as these ships’ regular fast voyages, had sailors all over the world call the Laeisz sailing ships “Flying P-Liners”. The PEKING is part of this legendary sailing ship fleet, together with a few other survivors, such as her sister ship PASSAT, the POMMERN and PADUA, the last of the once huge fleet which still is in active service as the sail training ship KRUZENSHTERN. Before she was sold to England in 1932 as stationary training ship and renamed ARETHUSA, the PEKING passed Cape Horn 34 times, which is respected among seafarers because of its often stormy weather. In 1975 the four-master, renamed PEKING, was sold to the USA to become a museum ship near the Brooklyn Bridge in Manhattan. There the old ship quietly rusted away until 2016 due to the lack of maintenance. -Af ter returning to Germany in very poor condition in 2017 with the dock ship COMBI DOCK III, the PEKING was meticulously restored in the Peters Shipyard in Wewelsfleth to the condition she was in as a cargo sailing ship at the end of the 1920s. -

Hamburg Hamburg Presents
International Police Association InternationalP oliceA ssociation RegionRegionIPA Hamburg Hamburg presents: HamburgHamburg -- a a short short break break Tabel of contents 1. General Information ................................................................1 2. Hamburg history in brief..........................................................2 3. The rivers of Hamburg ............................................................8 4. Attractions ...............................................................................9 4.1 The port.................................................................................9 4.2 The Airport (Hamburg Airport .............................................10 4.3 Finkenwerder / Airbus Airport..............................................10 4.4 The Town Hall .....................................................................10 4.5 The stock exchange............................................................10 4.6 The TV Tower / Heinrich Hertz Tower..................................11 4.7 The St. Pauli Landungsbrücken with the (old) Elbtunnel.....11 4.8 The Congress Center Hamburg (CCH)...............................11 4.9 HafenCity and Speicherstadt ..............................................12 4.10 The Elbphilharmonie .........................................................12 4.11 The miniature wonderland.................................................12 4.12 The planetarium ................................................................13 5. The main churches of Hamburg............................................13 -

Drs 21/19668
BÜRGERSCHAFT DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 21/19668 21. Wahlperiode 14.01.20 Antrag der Abgeordneten Michael Kruse, Jens Meyer, Jennyfer Dutschke, Anna-Elisabeth von Treuenfels-Frowein, Daniel Oetzel (FDP) und Fraktion zu Drs. 21/19439 (zu Drs. 21/18963) Betr.: Planungen für das Projekt Kleiner Grasbrook erfolgreich umsetzen Seit September 2017 ist bekannt, dass der östliche Bereich des Kleinen Grasbrooks zu einem gemischten Stadtteil mit Wohnbebauung, Büroarbeitsplätzen und neuen Gewerbegebäuden entwickelt werden soll. Das Projektgebiet soll aus den Flächen des heutigen Überseezentrums und den Uferbereichen von Moldau- und Saalehafen bestehen. Zunächst wurde am 1. August 2017 ein „Letter of intent über hafenwirt- schaftliche Fortentwicklung der Flächen des ehemaligen Überseezentrums sowie der unmittelbar angrenzenden Flächen“ zwischen BWVI, dem Unternehmensverband Hafen Hamburg und dem Industrieverband vereinbart, wonach eine wirtschaftliche Nutzung des Kleinen Grasbrooks und der Hafenwirtschaftsflächen sichergestellt wer- den sollte. In der Drs. 21/189631 vom 12.11.2019 sind hierzu nur wenig konkrete Inhalte zu fin- den. Zielsetzungen für das Projekt werden kaum definiert und Haushaltsmittelbedarfe sind nach derzeitigem Planungsstand nicht quantifizierbar. Ebenso ist angesichts der chronisch störungsanfälligen S-Bahn die ÖPNV-Anbindung aus dem Hamburger Süden unklar. Zwar gab es im Ausschuss Andeutungen von Senatsvertretern, dass man die U4 weiter planen wolle. Jedoch hatten Vertreter der Fraktionen von SPD und GRÜNEN noch im April 2019 – also zu einem Zeitpunkt, als die Planungen für den Kleinen Grasbrook bereits fortgeschritten waren – einen Vor- schlag der FDP-Fraktion abgelehnt, die Planung der U4 nach Süden Richtung Har- burg fortzuführen. Die Ablehnung wurde unter anderem mit mangelnden Planungska- pazitäten begründet (vergleiche Drs. -

Standpunkte Der Standort Der Universität Hamburg Im Chancen
Standpunkte Der Standort der Universität Hamburg im Chancen-Dreieck von Universitäts-, Hafen- und Stadtentwicklung Der Standort der Universität Hamburg im Chancen-Dreieck von Universitäts-, Hafen- und Stadtentwicklung Bearbeitung: Geschäftsbereiche Infrastruktur und Innovation & Umwelt Christine Beine, Anna Böhning, Ulrich Brehmer, Christoph Färber, Dr. Michael Kuckartz, Jan-Oliver Siebrand, Reinhard Wolf Telefon 040 36138-138 Fax 040 36138-401 [email protected] Städtebauliche Entwürfe und Standortsteckbriefe: ARGE büro luchterhandt, Carstensen, Weyland: Daniel Luchterhandt, Uwe A. Carstensen, Hanns-Jochen Weyland Visualisierungen: Gärtner + Christ GbR Grafiken: Michael Holfelder, Handelskammer Hamburg Fotos: Michael Zapf, Achim Liebsch, Mathias Friedel Luftbildfotografie Alle Grafiken © Handelskammer Hamburg Weitere Publikationen dieser Reihe finden Sie auf den Seiten 126 und 127. Stand: Oktober 2009 Vorwort Für die Wettbewerbsfähigkeit Hamburgs im internationalen Vergleich ist ein herausragendes Hochschulangebot unverzichtbar – Hamburg braucht eine exzellente Universität. Die Universität Hamburg, fünftgrößte in Deutschland und in Hochschulrankings nur in Einzelfällen auf den vorderen Plätzen, wird diesem Anspruch derzeit nur bedingt gerecht. Deshalb begrüßt die Handelskammer Hamburg ausdrücklich die von der Behörde für Wissenschaft und Forschung und der Universität initiierte Diskussion über deren zukünftige Entwicklung. Das Ergebnis der zu diesem Zweck erarbeiteten, im März 2009 von der Behörde für Wissenschaft und Forschung vorgelegten Studie zur baulichen Entwicklung der Universität ist jedoch ein nur unzureichender Beitrag und stellt keine ausreichende Grundlage für eine Entscheidung über den endgültigen Standort der Hamburger Universität dar. Der erst danach von der Universität vorge- legte Struktur- und Entwicklungsplan muss die Rahmenbedingungen für die bauliche Entwicklung der Universität setzen. Zugleich darf die unbestrittene Notwendigkeit der baulichen Entwicklung der Universität nicht für stadtentwicklungspolitische Ziele instrumentalisiert werden. -

Statistik Nord
Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein Statistik informiert ... Nr. VIII/2017 11. Oktober 2017 Lohn- und Einkommensteuerstatistik in Hamburg 2013 Große Unterschiede zwischen den Hamburger Stadtteilen Aus der bislang alle drei Jahre durchgeführten Lohn- und Einkommensteu- erstatistik resultieren nicht nur Angaben über die festgesetzte Steuer, son- dern auch über die Steuerpflichtigen und deren Einkünfte. Für das jetzt vor- liegende Jahr 2013 wurden 943 570 Hamburger Lohn- und Einkommen- steuerpflichtige ermittelt, die einen Gesamtbetrag der Einkünfte (im Folgen- den als „Einkommen“ bezeichnet) in Höhe von 36,85 Mrd. Euro erzielten. Rein rechnerisch ergibt sich damit für jeden Steuerpflichtigen ein Einkommen in Höhe von 39 054 Euro, so das Statistikamt Nord. Da einige Steuerpflichtige sehr hohe Einkommen haben – so gab es in der Hansestadt beispielsweise 867 „Einkommensmillionäre“ –, liegen die Werte der meisten Steuerpflichtigen (69 Prozent) unterhalb des Hamburger Durchschnitts. Der gegenüber Extremwerten robustere Median zeigt, dass die Hälfte aller Steuerpflichtigen ein Einkommen von höchstens 25 449 Euro hatte. Im Vergleich zu 2010 hat die Zahl der Steuerpflichtigen um 27 900 (plus 3,0 Prozent) zugenommen und das Einkommen um 4,28 Mrd. Euro (plus 13,1 Prozent). Das durchschnittliche Einkommen je Steuerpflichtigen ist dadurch ebenfalls gestiegen, und zwar um 3 487 Euro bzw. 9,8 Prozent. Auch die Zahl der „Einkommensmillionäre“ wuchs, und zwar um 143. Bei diesem Vergleich ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Werte für das Jahr 2010 u. a. durch die Finanz- und Wirtschaftskrise beeinflusst worden waren – im Jahr 2010 gab es beispielsweise 135 Einkommensmillionäre weniger als 2007. Werden die Durchschnittswerte für die einzelnen Stadtteile ermittelt, zeigen sich deutliche Unterschiede: Die Spanne reicht von 13 777 Euro bis 120 716 Euro je Steuerpflichtigen (siehe nachstehende Stadtteil-Karte und Tabelle). -

126 Große Freiheit & Reeperbahn | St
007 Vorwort 036 Treppenhäuser Stairwells 068 Fleetinsel | Neustadt 096 Hauseingänge Front doors I Eppendorf 009 Preface 070 Deichstraße | Altstadt 098 Holthusenbad | Eppendorf Innenstadt Inner city - Altstadt & Neustadt 072 „Michel" I Neustadt 100 St. Johannis | Eppendorf Rund um den Bahnhof Around the main railway Station - Kunstmeile art district, Kontorhausviertel & St. Georg 038 Mönckebergstraße I Altstadt 074 Krameramtswohnungen & Peterstraße I Neustadt 102 Alsterkanäle Alster canals 040 Rathausmarkt | Altstadt 104 Johanneum | Winterhude 010 Willy-Brandt-Straße I Altstadt Rund um die Außenalster Around the Outer Alster - 042 Hygieiabrunnen Hygieia Fountain & Rathaus I Altstadt Eppendorf, Grindel, Harvestehude, Hoheluft-Ost, 106 Backstein Brick 012 Der Spiegel | Altstadt 8 Hafencity Rotherbaum, Uhlenhorst & Winterhude 044 Rathaus | Altstadt 108 Kampnagel | Winterhude' 014 Fruchthof I Hammerbrook 046 Börse I Altstadt 076 Außenalster Outer Alster 110 Stadtpark | Winterhude 016 Hauptbahnhof & Dammtorbahnhof I Altstadt & Rotherbaum 048 Kleine Alster & Binnenalster Inner Alster I Neustadt 078 Alsteranleger Alster landingpier I Rotherbaum 112 City Nord | Winterhude 018 Kontorhausviertel I Altstadt 050 Alsterschwäne Alster Swans | Altstadt & Neustadt 080 Alstervorland | Harvestehude 114 Friedhof Ohlsdorf Ohlsdorf Cemetery | Ohlsdorf 020 Chilehaus I Altstadt 052 Jungfernstieg | Neustadt 082 Universität University & Grindelviertel I Rotherbaum 116 Imam-Ali-Moschee Imam Ali Mosque I Uhlenhorst 022 Deichtorhallen | Altstadt 054 Einkaufspassagen -

Statistisches Amt Für Hamburg Und Schleswig-Holstein Statistik Informiert
Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein Korrektur Statistik informiert ... Nr. VI/2017 14. Juni 2017 Struktur der Haushalte in den Hamburger Stadtteilen Ende 2016 In fast 18 Prozent der Hamburger Haushalte leben Kinder In rund 18 Prozent aller Hamburger Haushalte leben Kinder unter 18 Jah- ren. Das geht aus einer Sonderauswertung des Melderegisters zur Anzahl und Struktur der Haushalte hervor, die das Statistikamt Nord jährlich zum Stichtag 31. Dezember durchführt. Zwischen den verschiedenen Stadtteilen bestehen dabei starke Unter- schiede. Die höchsten Anteile an Haushalten mit Kindern gibt es in Neu- allermöhe (34 Prozent) und Duvenstedt (30 Prozent). Gleichzeitig weisen diese beiden Stadtteile mit 2,4 Personen die höchste durchschnittliche Haushaltsgröße in Hamburg auf (siehe Karte auf Seite 6). Demgegenüber gibt es in den innerstädtischen Gebieten verhältnismäßig wenige Haushalte mit Kindern: In Kleiner Grasbrook/Steinwerder, Hammer- brook, Borgfelde, Barmbek-Nord und St. Georg liegen die Anteile der Haushalte mit Kindern unter elf Prozent (siehe Tabelle auf Seite 4). Hier besteht ein Haushalt aus durchschnittlich 1,3 bis 1,5 Personen. Die absolut meisten Haushalte mit Kindern gibt es in den stark besiedelten Stadtteilen Rahlstedt, Billstedt, Wilhelmsburg, Eimsbüttel, Bramfeld und Winterhude. Zusammen befinden sich über ein Fünftel aller Hamburger Haushalte mit Kindern in diesen Stadtteilen. Ein Viertel aller „Kinderhaushalte“ sind Alleinerziehenden-Haushalte Ein Viertel der Hamburger Haushalte mit Kindern sind Alleinerziehenden- Haushalte. Die übrigen bestehen aus einem (Ehe-)Paar mit einem oder mehreren Kindern. Bezogen auf die absolute Zahl aller Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren wächst ebenfalls rund ein Viertel mit nur einem Erwachsenen auf (rund 67 000 Kinder und Jugendliche). -

Stadtteilatlas Der Polizeilichen Kriminalstatistik 2018
Polizeiliche Kriminalstatistik 2018 -ausgewählte Delikte nach Bezirken / Stadtteilen- Landeskriminalamt LKA FSt 11 Bruno-Georges-Platz 1 22297 Hamburg Tel.: 040 4286-70111Polizeiliche Kriminalstatistik 2005 eMail: [email protected] http://www.polizei.hamburg.de Polizeiliche Kriminalstatistik 2017 / 2018 - ausgewählte Delikte nach Bezirken / Stadtteilen - Landeskriminalamt LKA FSt 11 Bruno Georges-Platz 1, 22297 Hamburg Tel.: 040 4286-70111 Bezirke mit Übersichten der Straftaten / Deliktsbereiche für alle Stadtteile des Bezirkes Bezirk Hamburg-Mitte Bezirk Hamburg-Altona Bezirk Hamburg-Eimsbüttel Bezirk Hamburg-Nord Bezirk Hamburg-Wandsbek Bezirk Hamburg-Bergedorf Bezirk Hamburg-Harburg alle Bezirke und Stadtteile nach Straftat / Deliktsbereich Straftaten insgesamt (Straftatenschlüssel ------) Raub, räuberische Erpressung, räuberischer Angriff auf Kraftfahrer (Straftatenschlüssel 210000) Sonstige Raubüberfälle auf Straßen, Wegen oder Plätzen (Straftatenschlüssel 217000) Körperverletzung insgesamt (Straftatenschlüssel 220000) Gefährliche und schwere Körperverletzung (Straftatenschlüssel 222000) Gewaltkriminalität (Summenschlüssel 892000) Diebstahl insgesamt (Straftatenschlüssel ******) Wohnungseinbruchsdiebstahl gem. § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB (Summenschlüssel 888000) Diebstahl von Kraftwagen insgesamt (Straftatenschlüssel ***1**) Diebstahl an/aus Kraftfahrzeugen insgesamt (Straftatenschlüssel *50***) Diebstahl von Fahrrädern insgesamt (Straftatenschlüssel ***3**) Ladendiebstahl insgesamt (Straftatenschlüssel *26***) Taschendiebstahl -

Sturmflut-Hinweise Für Die Bevölkerung in Finkenwerder
Bramfeld Trittau Farmsen- Steilshoop Wichtige Informationen! Alsterdorf Berne E I M S B Ü T T E L Gr. Borstel Rahlstedt An alle Haushalte im gefährdeten Gebiet. Eidelstedt Barmbek- SCHENEFELD Lurup Nord Lokstedt Eppendorf Winterhude Tonndorf Stellingen WEDEL Rissen Ost Dulsberg Wandsbek Sülldorf Hoheluft- West Barmbek- Süd Harvestehude Jenfeld Iserbrook Osdorf Barsbüttel Bahrenfeld Eimsbüttel Uhlenhorst Eilbek Marienthal A L T O N A Altona- Rotherbaum Nord Groß-Flottbek Stern- Hohenfelde Blankenese schanze St. Georg Altona- Borgfelde Nienstedten Othmarschen Neustadt Hamm St. Pauli Horn Ottensen Hamburg- Altstadt Altstadt Hammer- Billstedt Glinde brook HafenCity Cranz Rothenburgsort Jork H A M B U R G - M I T T E Finkenwerder Billbrook Waltershof Steinwerder Kleiner Grasbrook Veddel REINBEK Neuenfelde Altenwerder Lohbrügge Moorfleet Francop Billwerder Wentorf Wilhelmsburg Moorburg Tatenberg Allermöhe Spadenland Neuallermöhe H A R B U R G Bergedorf BUXTEHUDE Neugraben- Hausbruch Reitbrook Fischbek Ochsenwerder B E R G E D O R F Heimfeld Curslack Harburg Neuland NEU WULMSTORF GEESTHACHT Eißendorf Gut Moor Wilstorf Altengamme Neuengamme Marmstorf Langenbek Rönneburg Kirchwerder Tiefliegende Gebiete Sinstorf Meckelfeld Landkreis Fliegenberg Hauptdeichlinie Harburg Maschen Rosengarten Sturmfl ut-Hinweise für die Bevölkerung in Finkenwerder Gefördert aus Klimaschutzmitteln Herausgeber: Behörde für Inneres und Sport Katastrophen- und Bevölkerungsschutz Johanniswall 4, 20095 Hamburg Tel. 040 428 28-0 www.hamburg.de / Katastrophenschutz Stand: September 2014 29 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Jollenhafen G G Blankenese G G G Rhb. G Jollenhafen u G u u J G G Mühlenberg L G u G G u G G u r e u a i r n c h n a Eichenal X e P . -
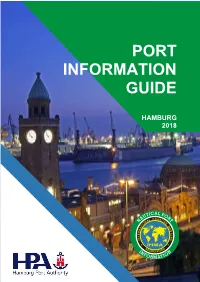
Port Information Guide
PORT INFORMATION GUIDE HAMBURG 2018 From left to right: Cpt. Jörg Pollmann, Chief Harbour Master Hamburg Port Authority, Mr. Frank Horch, Senator of Hamburg and President of the State Ministry of Economic Affairs, Mr. Jens Meier, CEO Hamburg Port Authority Inauguration of the new VTS Centre INITIATED BY IN ASSOCIATION WITH INITIATED BY IN ASSOCIATION WITH SUPPORTED BY GENERAL INTRODUCTION This guide has been written for masters of seagoing vessels, shipping lines, publishers of nautical information and any other party in need of nautical information. LEGAL DISCLAIMER While the Hamburg Port Authority (HPA) makes every effort to maintain the Port Information Guide up to date, accurate and accessible, we kindly ask for your understanding that we cannot accept responsibility for the accuracy and/or completeness of the Guide. In the event of any inconsistency or conflict between the Port Information Guide and the applicable legislation, including the bye-laws, the latter shall prevail. CONTACT PORT Hamburg Port Authority Harbour Master’s Division Neuer Wandrahm 4 20457 Hamburg Phone +49 40 42847-0 Fax +49 40 42847-2588 Internet www.hamburg-port-authority.de/ PERSON TO CONTACT FOR PORT INFORMATION Capt. Jörg Pollmann, Chief Harbour Master WEBSITE OF THE PORT www.hamburg-port-authority.de THIS DOCUMENT CAN BE FOUND AT www.hamburg-port-authority.de/en/press 5 PORT INFORMATION GUIDE Source: Harbour Master Port of Hamburg 2018 TABLE OF CONTENT GENERAL INTRODUCTION ................................................................................................