Alltägliches Leben
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Goethes Papiersachen Und Andere Dinge Des „Papiernen Zeitalters“
10.3726/92135_17 17 CHRISTIANE HOLM Goethes Papiersachen und andere Dinge des „papiernen Zeitalters“ Seit Papier in Europa bekannt und im 13. Jahrhundert auch produziert wurde, war es vornehmlich als Träger von Schrift und somit als Objekt des Beschreibens, Be- druckens und Lesens im Gebrauch.1 Erst Mitte des 18. Jahrhunderts etablieren sich neben einem ausdifferenzierten Angebot an Text- und Bildmedien auch andere seriell gefer- tigte Papierprodukte und das Papier hält Einzug ins Interieur. In Form von Tapeten, Möbelausgestaltungen, Behältnissen und anderen Papierobjekten prägt es von nun an den Charakter der Innenräume und somit auch die Umgebung des Schreibens und Lesens. Das aktuelle literaturwissenschaftliche Interesse an Papier richtet sich auf die Mate- 2 rialität von Textträgern. Dabei interessiert insbesondere der Eigen- oder Nebensinn des Schreibmaterials, der sich durchaus widerständig oder kommentierend zu dem Ge- schriebenen verhalten kann.3 Gegenstand der folgenden Beobachtungen und Überlegun- gen sind hingegen solche Papierobjekte, die nicht zum Beschriften gedacht, aber durchaus in Schreibpraktiken eingebunden waren. Exemplarisch werden dafür die papiernen Ein- 1 In China, wo Papier seit dem 2. Jh. v. Chr. nachgewiesen ist, hatte sich längst eine differenzierte Papierkultur entwickelt, in der das Material z. B. auch für Inneneinrichtung und Bekleidung Verwendung fand. 2 Aktuelle literaturwissenschaftliche Forschungen zur Materialität von Textträgern entstehen meist im Kon- text der Institutionen, die sich seit jeher mit dem konkreten Objekt befassen: Editionsprojekte, Archive und Museen. Aus dieser Tradition heraus ist die – durchaus kritische – Auseinandersetzung mit dem „material turn“ in den Kulturwissenschaften besonders ergiebig, vgl. M. Schubert (Hrsg.): Materialität in der Edi- tionswissenschaft, Berlin 2010. Eine gute Übersicht bietet die problemorientierte Forschungsdiskussion: Per Röcken: Was ist – aus editorischer Sicht – Materialität? Versuch einer Explikation des Ausdrucks und einer sachlichen Klärung. -

GERMAN LITERARY FAIRY TALES, 1795-1848 by CLAUDIA MAREIKE
ROMANTICISM, ORIENTALISM, AND NATIONAL IDENTITY: GERMAN LITERARY FAIRY TALES, 1795-1848 By CLAUDIA MAREIKE KATRIN SCHWABE A DISSERTATION PRESENTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF FLORIDA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY UNIVERSITY OF FLORIDA 2012 1 © 2012 Claudia Mareike Katrin Schwabe 2 To my beloved parents Dr. Roman and Cornelia Schwabe 3 ACKNOWLEDGMENTS First and foremost, I would like to thank my supervisory committee chair, Dr. Barbara Mennel, who supported this project with great encouragement, enthusiasm, guidance, solidarity, and outstanding academic scholarship. I am particularly grateful for her dedication and tireless efforts in editing my chapters during the various phases of this dissertation. I could not have asked for a better, more genuine mentor. I also want to express my gratitude to the other committee members, Dr. Will Hasty, Dr. Franz Futterknecht, and Dr. John Cech, for their thoughtful comments and suggestions, invaluable feedback, and for offering me new perspectives. Furthermore, I would like to acknowledge the abundant support and inspiration of my friends and colleagues Anna Rutz, Tim Fangmeyer, and Dr. Keith Bullivant. My heartfelt gratitude goes to my family, particularly my parents, Dr. Roman and Cornelia Schwabe, as well as to my brother Marius and his wife Marina Schwabe. Many thanks also to my dear friends for all their love and their emotional support throughout the years: Silke Noll, Alice Mantey, Lea Hüllen, and Tina Dolge. In addition, Paul and Deborah Watford deserve special mentioning who so graciously and welcomingly invited me into their home and family. Final thanks go to Stephen Geist and his parents who believed in me from the very start. -

648 Notes, June 2019 Based on Their Musical
05_907-146_BkRevs_pp637-687 4/22/19 7:32 AM Page 648 648 Notes, June 2019 based on their musical traditions. For baroque language and references with- example, he describes the music of out cluttering the text of the translation “heathens” thus: “For just as they had itself. no true knowledge of God in that they Kimberly Beck Hieb did not recognize the Trinity in God, West Texas A&M University they also could not recognize the har- monic triad, for they did not consider the third to be a consonance, even Sara Levy’s World: Gender, Judaism, though harmony without the addition and the Bach Tradition in Enlighten - of the third is quite deficient and in- ment Berlin. Edited by Rebecca Cypess complete, yea, even lifeless” (p. 83). and Nancy Sinkoff. (Eastman Studies Finally, Werckmeister wishes to con- in Music.) Rochester, NY: University of firm the subordinate position of linear Rochester Press, 2018. [x, 292 p. ISBN staff notation in relation to its superior 9781580469210 (hardcover), $99.00.] counterpart, German organ tablature. Illustrations, music examples, appen- He spends several chapters denigrating dices, bibliography, index, online au- the linear staff system, pointing to the dio files. inconvenience of having to read all the different clefs and the confusing This well-written, insightful, interdis- process of adding sharps and flats to ciplinary, and excellent work is an ef- pitches, which to him suggests unneces- fort to explore the facets of Sara Levy’s sary chromatic semitones. The new and complex world and in so doing bring practical equal temperament tuning is that remarkable woman from the mar- central to Werckmeister’s argument gins of intellectual and cultural history. -

Train up a Child: on the Maskilic Attempt to Change the Habitus of Jewish Children and Young Adults
JOURNAL OF JEWISH EDUCATION 2016, VOL. 82, NO. 1, 28–53 http://dx.doi.org/10.1080/15244113.2016.1133183 Train Up a Child: On the Maskilic Attempt to Change the Habitus of Jewish Children and Young Adults Zohar Shavit ABSTRACT Members of the Jewish Enlightenment movement and Jewish financial entrepreneurs undertook an active, conscious project to effect significant transformations in the Jewish habitus in German-speaking areas during the late 18th and early 19th centuries. A symbiotic relationship allowed these groups to disseminate a new vision of Jewish society through multiple mediums including, as this article examines in particular, a new Jewish educational system and new educational texts written for children and young adults. With guidelines on daily prac- tices including personal hygiene, dress, language, leisure, and interactions with one’s surroundings, these texts reached not only their intended audience but the parents’ generation as well. What should one do after getting up in the morning? Should one wash, and, if so, when? How should one behave at the table? How should one dress, or employ one’s leisure time? These and others are among the daily practices that organize a person’s life. They are not spontaneous actions; rather, they derive from social norms and cultural codes that characterize a particular social group and distinguish it from others. To put it another way: they comprise the habitus of a specific individual and the social group to which he or she belongs. This article examines for the first time the changes in the Jewish habitus that resulted from significant transformations within Jewish society in German-speaking areas during the late 18th and early 19th centuries, and the active role played by a new Jewish educational system therein. -
Friedrich Von Schlegel, Dorothea Von Schlegel an August Wilhelm Von Schlegel Jena, 20.02.1801
Friedrich von Schlegel, Dorothea von Schlegel an August Wilhelm von Schlegel Jena, 20.02.1801 Empfangsort Berlin Handschriften- Dresden, Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Datengeber Signatur Mscr.Dresd.e.90,XIX,Bd.24.c,Nr.163 Blatt-/Seitenzahl 4S. auf Doppelbl., hs. Format 18,6 x 11,4 cm Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe. Bd. 25. Dritte Abteilung: Briefe von und an Friedrich und Bibliographische Dorothea Schlegel. Höhepunkt und Zerfall der romantischen Schule (1799 ‒ 1802). Mit Angabe Einleitung und Kommentar hg. v. Hermann Patsch. Paderborn 2009, S. 234‒237. Editionsstatus Einmal kollationierter Druckvolltext mit Registerauszeichnung August Wilhelm Schlegel: Digitale Edition der Korrespondenz [Version-07-21];https://august- Zitierempfehlung wilhelm-schlegel.de/version-07-21/briefid/3569. [1] Jena den 20ten Febr 1801 Nicolovius hat eine Assignation auf 16 Carol[in] anRein geschickt, die auch schon durchFrommann besorgt und von Rein honorirt ist, und deren Empfang ich sogleich an Nicol[ovius] gemeldet habe. Unterdessen ist auch bey uns wieder einiges Geld eingelaufen, und es wird also mit den Zahlungen, in der Ordnung wie Du sie bestimmt hast, seinen Gang ziemlich schnell fortgehn können. Die beyden Apotheken, Schreiber[,] Fiedler, Buchbinder und Bretari zusammen betragen ungefähr so viel als unsre Schuld macht. Bretari kömmt zum Markte her und wird die Bezahlung wohl nicht eher erwarten. Er hat bei Uebergebung der Rechnung gefragt, ob er einen Shawl der um Ostern 1800 gekauft Dir oder Schelling berechnen soll. So viel wir wissen war er fürAuguste und hat Sch[elling] ihn bestellt gehabt. – – – Sollte Dein Aufsatz überBürger noch nicht ganz abgesandt sein beim Empfang dieses, [2] so beschwöre ich Dich bey allen Heiligen damit zu eilen. -

Unterhã¤Ndler Auslã¤Ndischer Dichterâ•Œ
pen Zeitschrift für Germanistik | Neue Folge XXIX (2019), Peter Lang, Bern | H. 2, S. 304–327 HÉCTOR CANAL „Unterhändler ausländischer Dichter“. Johann Diederich Gries’ Calderón-Übersetzungen I. Der Übersetzer Gries. Im Gegensatz zu anderen berühmten zeitgenössischen Übersetzern, wie August Wilhelm Schlegel oder Johann Heinrich Voß, machte Johann Diederich Gries (1775–1842) das Übersetzen zum (fast) ausschließlichen Gegenstand seines literarischen Schaffens. Sein Verzicht auf übersetzungstheoretische Ansprüche und sein spärlicher Um- gang mit Paratexten zu seinen Übersetzungen trugen trotz strenger und fundierter Kriterien sowie eines ausgesprochenen Sprachtalents zur stiefmütterlichen Behandlung Gries’ in der literaturwissenschaftlichen Forschung bei.1 Seine dichterische Produktion mit einem Übergewicht von Gelegenheitsgedichten, die, im Gegensatz etwa zu Friedrich und A. W. Schlegels Dichtungen,2 keine selbstreflexiven und avantgardistischen Ansprüche erhoben, stieß ebenfalls auf wenig Resonanz in der Forschung. Von seinen Zeitgenossen durchweg anerkannt, in seinen Anfängen von Wieland, Schiller oder A. W. Schlegel gefördert, später von Goethe gelobt,3 war Gries einer der wichtigsten Vermittler romanischer Literaturen und insbesondere des italienischen Epos im deutschsprachigen Raum. Seinen Ruf verdankte er zunächst den Übertragungen von Tasso4 und Ariosto5, die wiederaufgelegt (und nach- gedruckt!) wurden und zu kanonischen Versionen avancierten. Außerdem übersetzte er Fortiguerri6 und Boiardo7. Neben den italienischen Epen widmete sich Gries dem spanischen Theater. Seine Calderón-Übersetzungen,8 die sich im Lesekanon etablierten und bis ins 20. Jahrhundert abgedruckt wurden und als Vorlage für Theaterbearbeitungen dienten, stehen im Mittel- punkt dieses Beitrags. Er ist als archivalische Spurensuche durch den verstreuten Nachlass konzipiert, die Gries’ Netzwerke sichtbar werden lässt, und konzentriert sich aus Platz- und Zeitgründen auf die beiden ersten Stücke: Die Große Zenobia und Das Leben ein Traum. -

Friedrich Schlegel in Paris Oder Die Romantische Gegenrevolution
GÜNTER OESTERLE Friedrich Schlegel in Paris oder die romantische Gegenrevolution Vorblatt Publikation Erstpublikation: Gonthier-Louis Fink (ed.): Les Romantiques allemands et la Révolution francaise. Die deutsche Romantik und die französische Revolution. Straßburg 1989, S. 163-179. Neupublikation im Goethezeitportal Vorlage: Datei des Autors URL: <http://www.goethezeitportal.de/db/wiss/schlegel_fr/oesterle_revolution.pdf> Eingestellt am 08.10.2005. Autor Prof. Dr. Günter Oesterle Justus-Liebig-Universität Gießen Arbeitsbereich Neuere deutsche Literatur Philosophikum I Otto-Behaghel-Str. 10 35394 Gießen Emailadresse: <[email protected]> Empfohlene Zitierweise Beim Zitieren empfehlen wir hinter den Titel das Datum der Einstellung oder des letzten Updates und nach der URL-Angabe das Datum Ihres letzten Besuchs die- ser Online-Adresse anzugeben: Günter Oesterle: Friedrich Schlegel in Paris oder die romantische Gegenrevolution (08.10.2005). In: Goethezeitportal. URL: <http://www.goethezeitportal.de/db/wiss/schlegel_fr/oesterle_revolution.pdf> (Datum Ihres letzten Besuches). Oesterle: Friedrich Schlegel in Paris, S. 1 GÜNTER OESTERLE Friedrich Schlegel in Paris oder die romantische Gegenrevolution Es gilt eine Legende zu befragen. Im Anschluss an den - ich zitiere die Rezeption - «grundlegenden» (1), «berühmten» (2) und «schönen Essai» (3) von Ernst Robert Curtius Friedrich Schlegel und Frankreich (4) schreiben Richard Benz, Doris Starr, Marianne Schuller und Ernst Behler dem 1802 nach Frankreich aufbrechenden Fried- -

Katalog 39, Februar 2021
Antiquariat Schaper Dammtordamm 4 20354 Hamburg antiquariat-schaper.de [email protected] Telefon +49 (0)40 34 50 16 Mobil +49 (0)172 52 303 74 IMPRESSUM Antiquariat Dietrich und Brigitte Schaper oHG Dammtordamm 4 20354 Hamburg Deutschland Telefon +49 (0) 40 34 50 16 antiquariat-schaper.de [email protected] Handelsregister Hamburg: HRA 89388 UstID-Nr. DE 254 269 796 Mitglied im Verband deutscher Antiquare und der International League of Antiquarian Booksellers GESCHÄFTSBEDINGUNGEN Das Angebot des Kataloges ist freibleibend. Die Bestellungen werden in der Reihenfolge des Einganges ausgeführt. Innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Sendung besteht für uns die Verpflichtung zur Rücknahme, nicht aber zur Ersatzlieferung. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer (7%). Eigentumsvorbehalt gemäß § 449 BGB bis zur vollständigen Bezahlung. Die Geschäftsbedingungen werden mit Aufgabe einer Bestellung anerkannt. Umschlagabbildungen: C[hristoffer] Suhr. Hamburgische Trachten, Seite 5 Hamburg, Februar 2021 SCHÖNE UND SELTENE BÜCHER KATALOG FEBRUAR 2021 Carl Lang. Kindestreue, Geschwister- liebe, Dankbarkeit und Edelmuth. In merkwürdigen Scenen aus der neuesten Zeitge- schichte. Ein Sittenspiegel für Deutschlands Jugend. Karl Tauchnitz, Leipzig [1806]. 15,5 x 10,5 cm. 8, 136 S. Mit 6 color. Kupfern nach franz. Originalen. Pappband der Zeit ( Einband beschabt. Rücken- und Deckelbezug fehlt stellenweise. Papier gebräunt und teils stockfleckig). Die hübschen Kupfer sauber. 220,00 € (1309) Biblia, Das ist:, Heilige Schrifft des Alten und Neuen Testaments. [...]. Samt einer Vorrede Herrn J. M. Dilherrns. Mit 6 gestochenen Zwischentiteln, 12 gestochenen Portraits und zahlreichen Textholzschnitten. 2 Teile in 1 Band. Johann Andreas Endter, Nürnberg 1755. 39,5 x 27 cm. 46 Blatt, 1.181 S., 11 Blatt. -
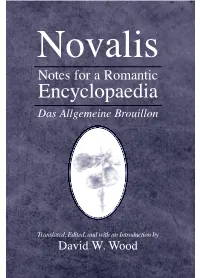
Notes for a Romantic Encyclopaedia Das Allgemeine Brouillon
Novalis Notes for a Romantic Encyclopaedia Das Allgemeine Brouillon Translated, Edited, and with an Introduction by David W. Wood Notes for a Romantic Encyclopaedia SUNY series, Intersections: Philosophy and Critical Theory Rodolphe Gasché, editor Notes for a Romantic Encyclopaedia Das Allgemeine Brouillon Novalis Translated, Edited, and with an Introduction by David W. Wood State University of New York Press Published by State University of New York Press, Albany © 2007 State University of New York All rights reserved Printed in the United States of America No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission. No part of this book may be stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means including electronic, electrostatic, magnetic tape, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without the prior permission in writing of the publisher. For information, address State University of New York Press, 194 Washington Avenue, Suite 305, Albany, NY 12210-2384 Production by Judith Block Marketing by Michael Campochiaro Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Novalis, 1772–1801. [Allgemeine Brouillon. English] Notes for a Romantic Encyclopaedia : Das Allgemeine Brouillon / Novalis ; translated, edited, and with an introduction by David W. Wood. p. cm. — (SUNY series, intersections: philosophy and critical theory) Includes bibliographical references and index. Translation of: Das Allgemeine Brouillon : Materialien zur Enzyklopäedistik 1798/99. ISBN-13: 978-0-7914-6973-6 -

Wielands Autorität Bei Tasso-Übersetzern Um 1800
Dieter Martin Der „große Kenner der Deutschen Ottave Rime“ Wielands Autorität bei Tasso-Übersetzern um 1800 Vorblatt Publikation Erstpublikation: Wieland-Studien 3 (1996), 194–215. Neupublikation im Goethezeitportal Vorlage: Datei des Autors URL: <http://www.goethezeitportal.de/db/wiss/wieland/martin_uebersetzer.pdf> Eingestellt am 08.04.2004 Autor PD Dr. Dieter Martin Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Deutsches Seminar II Institut für neuere deutsche Literatur 79085 Freiburg Emailadresse: <[email protected]> Homepage: <http://www.germanistik.uni-freiburg.de/ds2/persds2.php> Empfohlene Zitierweise Beim Zitieren empfehlen wir hinter den Titel das Datum der Einstellung oder des letzten Updates und nach der URL-Angabe das Datum Ihres letzten Besuchs dieser Online-Adresse anzugeben: Dieter Martin: Der „große Kenner der Deutschen Ottave Rime“. Wielands Autorität bei Tasso-Übersetzern um 1800 (08.04.2004). In: Goethezeitportal. URL: <http://www.goethezeitportal.de/db/wiss/wieland/martin_uebersetzer.pdf> (Datum Ihres letzten Besuches). Martin: Wielands Autorität bei Tasso-Übersetzern, S. 1 Dieter Martin Der „große Kenner der Deutschen Ottave Rime“ Wielands Autorität bei Tasso-Übersetzern um 1800 Christoph Martin Wielands literarisches Ansehen hat unter den Attacken der Brüder Schlegel nachhaltig gelitten. Das in den Jahren vor 1800 planmäßig durchgeführte „Autodafé über Wieland“ erschütterte seine Position auf dem deutschen Parnaß.1 Allerdings sollte die „Wielandische Hinrichtung“ in ihrer literarhistorischen Wirkung nicht überschätzt werden. Denn Wielands Wort zählt bei seinen romantischen Zeitgenossen mehr, als es die abschätzigen Urteile im ‘Athenaeum’ vermuten lassen. Dies zeigen wenig bekannte Quellen aus einem Gebiet, in dem Wielands Interesse mit dem der romantischen Generation zusammentrifft. Denn wie seine Shakespeare-Übersetzung den Übertragungen der Romantiker vorangeht, so antizipiert und beeinflußt Wieland auch die romantische Aneignung der großen italienischen Epen. -

Schloss Und Park Tiefurt
Audioguidetext zum SCHLOSS UND PARK TIEFURT Text/Redaktion: Linon Medien Klassik Stiftung Weimar | Tiefurt | 11.2011 1 Inhalt TITEL ...................................................................................................... AUDIOGUIDE-NUMMER Schloss Tiefurt Einführung ............................................................................................................................... 400 Diele 1. OG ............................................................................................................................... 401 Vertiefungsebene zu 401 ................................................................................................... 40 Speisezimmer ........................................................................................................................... 402 Kaminzimmer .......................................................................................................................... 403 Vertiefungsebene zu 403 ................................................................................................... 41 Musikzimmer ........................................................................................................................... 404 Vertiefungsebene zu 404 ................................................................................................... 42 Schlafzimmer ........................................................................................................................... 405 Alkovenzimmer ...................................................................................................................... -

NOVALIS Schriften
NOVALIS Schriften Die Werke von Friedrich von Hardenbergs Begründet von Paul Kluckhohn und Richard Samue Herausgegeben von RICHARD SAMUEL (f) in Zusammenarbeit mit HANS JOACHIM MÄI1L und GERHARD SCHULZ Historisch-kritische Ausgabe in vier Bänden, einem Materialienband und einem Ergänzungsband in vier Teilbänden mit dem dichterischen Jugendnachlaß und weiteren neu aufgetauchten Handschriften VKRLAG W. KOHLHAMMKR STUTTGART BKRLIN KÖLN 1998 NOVALIS Schriften VIERTER RAND Tagebücher, Briefwechsel, Zeitgenössische Zeugnisse Herausgegeben von RICHARD SAMUEL in Zusammenarbeit mit HANS JOACHIM MÄHE und GERHARD SCHULZ Mit einem Anhang Bibliographische Notizen und Bücherlisten bearbeitet von DIRK SCHRÖDER Zweite, unveränderte Auflage V KRLA(i W . KUHLHA MMER STUTTGART BERLIN KÖLN 1998 INHALT Einleitung von Richard Samuel I. Einführendes 1* II. Die landschaftliche Umgehung 4* III. Der gesellschaftliche Umkreis 6* 1. Familiensinn 6* 2. Das Elternhaus 7* 3. Tennstedt — Grüningen 10* 4. Freiberg und Dresden 17* 5. Aufklärung und Rokoko 22* 6. Weimar (Schiller, Goethe, Herder, Jean Paul) 24* 7. Romantiker 25* 8. Der Berufskreis 29* IV. Die Form der Briefe 32* V. Die Tagebücher 40* VI. Zeitgenössische Zeugnisse 43 VII. Hardenbergs äußere Erscheinung 43* Abteilung I: Tagebücher Die mit * bezeichneten Stücke der Abteilungen I—IV waren bisher ganz oder teil- weise unveröffentlicht. Nr. Titel Ort Datum Seite 1 Tagebuchblatt Weißenfels 1790 3 2 Abrechnung Weißenfels 1790, Herbst 4 3 Notiz Jena 1791 4 4 Reisejournal 1793,15.-19.4. 6 5 Tagebuchblatt Tennstedt 1794, Dez. 22 6 Klarisse Weißenfels 1796, Aug./Sept. 24 7 Kalendereintragungen 1797, Jan.—Apr. 26 8 Journal Tennstedt/ 1797,18.4.-6.7. 29 Grüningen 9 An Erasmus Weißenfels 1797,9. 8. 50 10 Betrachtung Freiberg 1798, Juli? 50 11 Notiz Weißenfels 1799, Juni 51 12 Notizen und Pläne Weißenfels 1799, August 52 13 Tagebuch Weißenfels 1800, 15.4.-6.9.