Chemnitz – Im Herzschlag Der Mobilität
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
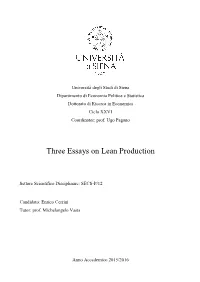
Three Essays on Lean Production
Università degli Studi di Siena Dipartimento di Economia Politica e Statistica Dottorato di Ricerca in Economics Ciclo XXVI Coordinator: prof. Ugo Pagano Three Essays on Lean Production Settore Scientifico Disciplinare: SECS-P/12 Candidato: Enrico Cerrini Tutor: prof. Michelangelo Vasta Anno Accademico 2015/2016 Acknowledgment This dissertation is not only the result of my work but also the result of feelings, ideas and behaviors that came up from people who I interviewed or I asked for advises. First of all, I want to deeply thank my supervisor prof. Michelangelo Vasta who supported my non-conventional research and guided me to do my best with his useful advises. I’m also grateful to the persons who supported my decision to enter the Ph.D program and who helped me to overcome those most difficult moments. Especially, I thank to my parents and all my family who encouraged me to continue to study and they provided me all the necessary support that allows me to complete my work. A special thanks to prof. Neri Salvadori, who was the first person that supported my idea to enter the Ph.D. program and advised me to join the Siena Department of Economics. I would also like to thank my friends who always help me relax when the program became too intensive, Andrea, Camilla, Daniele, Gabriele, Giacomo, Raffaele, Riccardo and Valerio. I want to stress my appreciation to all the people who gave me ideas due to their abilities and their knowledge. In particular, director Ugo Pagano, prof. Giuseppe Berta, Samuel Bowles, Paolo di Martino and Nicola Meccheri as well as Paolo Borioni and Fabio Landini. -

Vom Gummireifen Zur Kunststoffkarosse
104-111_KU110402_KU5 04.05.2010 10:42 Uhr Seite 104 100 JAHRE KUNSTSTOFFE Mercedes-Benz SLR McLaren aus kohle- faserverstärktem Kunststoff (CFK), 2003 (Foto: Wikipedia) Karl Benz am Steuer seines dreirädrigen Patent-Motorwagens Nr. 1 von 1886 (Foto: [59]) Vom Gummireifen zur Kunststoffkarosse Automobil. Der Gebrauch von Kunststoffen in Automobilen ist eigentlich so alt wie diese selbst. Das erste Automobil lief auf Vollgummireifen. Von da war es ein langer Weg zur umfangreichen Verwendung von Kunststoffen in den heutigen Kraftfahrzeugen. Betrachtet werden hauptsächlich die ersten 50 Jahre, aber immer wieder wird auch ein Blick auf die heutige Entwicklung geworfen und zum Schluss ein kurzer Ausblick angefügt. GÜNTER LATTERMANN meldet,wurde das Patent dafür gegen En- und schlechtere Fahreigenschaften als die de des Jahres erteilt. Die erste öffentliche späteren luftgefüllten Gummireifen (John ieser Artikel gibt einen Überblick Probefahrt seines „Wagens ohne Pferde“ Boyd Dunlop, 1888). Diese wurden 1895 über Kunststoffe im Automobil- erfolgte im Sommer 1886. Das linke Titel- erstmals für Automobile von den Gebrü- D bau. Bereits vor 71 Jahren erschien bild zeigt Karl Benz am Steuer dieses ers- dern Edouard und André Michelin aus ein „Rückblick auf die Internationale ten – dreirädrigen – Automobils. Es hat- Clermont-Ferrand an einen Peugeot Automobil- und Motorrad-Ausstellung te gegenüber seinem Konkurrenten, der Éclair montiert [4] – die berühmten Berlin 1939“ mit dem Titel „Kunststoffe bereits vierrädrigen, hölzernen „Motor- „Pneus“ (von griechisch „pneuma“ = im deutschen Kraftfahrbau“, der auch kutsche“ von Gottlieb Daimler einen Wind, Atem) nahmen ihren Lauf. damals bereits in der Zeitschrift Kunst- wichtigen Vorteil: seine Räder waren nicht Der erste Luft-Reifen aus vollsyntheti- stoffe veröffentlicht wurde [1]. -

Anniversary Dates 2020 Audi Tradition 2 Anniversary Dates 2020
Audi Tradition Anniversary Dates 2020 Audi Tradition 2 Anniversary Dates 2020 Contents Anniversaries in Our Corporate History May 2005 Body in the Manufacture of Production Cars ..........12 15 Years Audi Forum Neckarsulm ............................5 March 1980 December 2000 40 Years Audi quattro ...........................................13 20 Years Audi Forum Ingolstadt .............................6 October 1975 September 1995 45 Years Audi GTE Engine .....................................14 25 Years Audi TT and TTS .......................................7 November 1975 March 1990 45 Years Start of Porsche 924 Production 30 Years Audi Duo Hybrid Vehicles ...........................8 in Neckarsulm ......................................................15 September 1990 July 1970 30 Years Audi S2 Coupé ..........................................9 50 Years Market Launch of Audi 100 Coupé S .........16 December 1990 1970 30 Years Audi 100 C4 / 50 Years Start-Up Audi’s First Six-Cylinder Engine .............................10 of Technical Development ....................................17 January 1985 March / April 1965 35 Years Renaming of Audi NSU 55 Years End of Production of DKW F 11, Auto Union AG as AUDI AG ...................................11 DKW F 12, AU 1000 Sp ........................................18 September 1985 September 1965 35 Years Audi Introduced the Fully Galvanized 55 Years NSU Prinz 1000 TT & NSU Typ 110 ..........19 Audi Tradition 3 Anniversary Dates 2020 Continued Anniversaries in Our Corporate History April 1940 -

Bayerische Motoren Werke AG
BMW Bayerische Motoren Werke AG Francia: Le plaisir de conduire España: ¿Te gusta conducir? Hispanoamérica: El placer de conducir Alemania: Freude am Fahren Tipo Sociedad anónima Industria Automóvil Fundación 1916 Sede Múnich, Alemania Ámbito Mundial Productos Automóviles, motocicletas,motores, bicicletas, banca,seguros Ingresos 76.380 millones de € (2013)1 Beneficio 5.210 millones de € (2013)2 neto Valor de la empresa: 113.290 millones de € (2013) Deuda de la empresa: 69.180 millones de € (2013) Director Dr. Norbert Reithofer ejecutivo Empleados (-3,80%) 96.230 (2009)3 Divisiones MINI BMW Motorrad M GmbH Filiales Rolls-Royce BMW Bank Sitio web www.bmw.es (España) www.bmw.com (Internacional) BMW (siglas en alemán de: Bayerische Motoren Werke, «Fábricas bávaras de motores») es un fabricante alemán de automóviles y motocicletas, cuya sede se encuentra en Múnich. Sus subsidiarias son Rolls-Royce y BMW Bank. BMW es el líder mundial de ventas dentro de los fabricantes de gama alta.4 Índice [ocultar] 1 Historia de BMW. o 1.1 Comienzos o 1.2 Logotipo o 1.3 Primera motocicleta BMW o 1.4 Primera producción de automóviles en Eisenach o 1.5 Durante la Segunda Guerra Mundial o 1.6 Posguerra o 1.7 Crisis de finales de los años 1950 o 1.8 Comienzo de la recuperación y compra de Glas o 1.9 Era Kuenheim o 1.10 La debacle de Rover o 1.11 Historia reciente o 1.12 Motocicletas Husqvarna o 1.13 Presidentes del consejo de administración de BMW o 1.14 Hechos cronológicos relevantes o 1.15 Cronología del lanzamiento de productos 2 Gama de productos o 2.1 Automóviles . -

Im Wartburg Von Ost Nach West
Im Wartburg von Ost nach West Einst Statussymbol des Arbeiter- und Bauernstaates, heute liebenswerter Gast auf Oldie-Treffen – und fit ist er auch noch Von Christoph Gajda Dröhnend schiebt sich die schöne neu asphaltierte Straße unter die Räder, das Summen des stets mitlaufenden Lüfterrades vor dem Kühler steigert sich in ein mitleidiges Heulen und der Dreizylinder- Zweitaktmotor will erst durch seine Drehmomententfaltung im hohen Drehzahlbereich beweisen, dass er in der Lage ist, mich in die viel zu weichen Sitze zu drücken. Gut dass es geradeaus geht, denn Seitenhalt fehlt dem Gestühl gänzlich. Gute Laune dennoch, denn die Technik funktioniert ausnahmsweise pannenfrei und zuverlässig. Einzig die Tatsache dass man noch über tausend Kilometer auszuhalten hat, könnte das perfekte Feeling jetzt noch trüben. Ja, der Balaton ist weit… Doch nix mit Balaton. Von wegen Urlaubsreise mit fernem Ziel und Erholung in Aussicht, wobei der Weg zum Ziel gehört, oder besser gesagt, dass Auto und Fahrer gesund am Ziel ankommen. Die Leute müssen früher wohl doch härter gewesen sein. Für mich heißt es nur, einmal quer durch Deutschland. Von Anhalt, über den Südharz, Thüringen, Hessen ins Rhein-Main-Gebiet. Moment mal! Daran wäre früher überhaupt nicht zu denken gewesen, zumindest nicht in Richtung Ost-West. Von daher bildet meine Reise doch eine kleine Besonderheit. Aus heutiger Sicht betrachtet sogar umso mehr, wenn man bedenkt, dass ich völlig auf Autobahnen verzichte und nach guter alter Sitte ohne Navi die Landstriche durchquere, an deren Straßen sich die wichtigsten Städte wie Perlen an einer Kette aneinander reihen. Der Wagen Wartburg TOURIST, wie sich die Vollheckvariante (auch Kombi genannt) des Wartburg ab 1968 nannte: ein Statussymbol in der DDR. -

Eisenach: AWE Von Tamara Hawich (TWA) Und Dietmar Grosser (TA)
Regional z Straße der Industriekultur | Eisenach: AWE Von Tamara Hawich (TWA) und Dietmar Grosser (TA) Thüringen ist ein Land voller Traditionen in der deutschen Industrie. Es sind oft sehr schöne Industrie-Denkmäler erhalten geblieben, die als architektoni - sches Kleinod von der bewegten Geschichte der Unternehmen erzählen. Mit unserer Serie zur Straße der Industriekultur wollen wir die schönsten Denkmäler vorstellen und unsere Leser zu einer Fahrt einladen. Gemeinsam mit dem Thüringer Wirtschaftsarchiv (TWA), dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie sowie der Thüringer Allgemeine (TA) gehen wir auf Suche nach den interessantesten steinernen Zeitzeugen. Wir starten unsere Tour im Im Ausstellungspavillon an der Wartburgstraße kann man die Automobil - Westen Thüringens in der traditionsreichen Auto-Stadt Eisenach. geschichte hautnah verfolgen. Auto-Liebhaber wissen es: Ob der Eisenacher anfangs zur Aufstockung der vorhandenen Werk investiert. Seit 1992 wird unterhalb Wartburg, der Dixi-Zentaur, der BMW-Pro - Gebäude und später zu zahlreichen Stan - der Wartburg mit High Tech und neuesten peller oder der Opel-Blitz; all diese Marken- dortverlagerungen. Arbeitsmethoden produziert. Opel schrieb Zeichen schmückten oder zieren heute noch Noch vor der politischen Wende 1989 bei - also neue Industriegeschichte und ließ die die Fahrzeuge aus einem einzigen Hause: spielsweise wurden Produktionszweige in alten Gebäude aus der Gründerzeit hinter dem fast schon legendären Eisenacher Auto - Neubauten am westlichen Stadtrand Eisen - sich. Der verbliebene Rest wurde abgerissen, mobilwerk. Man nannte es kurz nur AWE. achs verlegt. Diese Bausubstanz nutzte die von anderen Unternehmen genutzt oder es Noch heute stehen unterhalb der Wartburg Adam Opel AG nach 1989 für den Aufbau zogen neue Herren aus den unterschiedlich - einige der wohl interessantesten Zeitzeugen einer Montagestrecke. -

DKW News 2019 August
NEWS – August 2019 EINLADUNG zur 31. GENERALVERSAMMLUNG am Samstag, 9. November 2019 14 Uhr Gasthaus Wallner „Grüner Baum“ Wallner Westbahnstraße 58, 4300 St. Valentin Telefon: 07435 52454 [email protected] Es ist ein WAHLJAHR Wer mit beschließen will - muss auch dabei sein ! Der Vorstand freut sich auf eine zahlreiche Teilnahme ! TAGESORDNUNG 1. Begrüßung 2. Bericht der Obfrau 3. Bericht des Kassiers 4. Bericht der Kassakontrolle 5. Entlastung des Kassiers 6. Entlastung des Vorstandes 7. Pause 8. Neuwahl 9. Veranstaltungen 2020 10. Allfälliges Alle Anträge, auch Angebote zur Mitwirkung im Vorstand, müssen spätestens 3 Tage vor der Generalversammlung per Post oder e-mail bei der Obfrau eingelangt sein. Heidi Zechmann, Otto-Pflanzl-Str. 10, 5020 Salzburg, [email protected] ACHTUNG die Einladung zur Herbstausfahrt liegt bei. Zehn Österreicher auf der „linken“ Spur So hat sie begonnen für uns Österrreicher, die Anreise zum 46. Internationalen Auto Union Treffen in Cirencester UK (1.- 4. 8. 2019) am Sonntag, dem 28. 7. 2019. Günter Zumpf und Elfriede Rasinger treffen Gustav Riedl und Elisabeth beim Kreuzerwirt in Straßwalchen und rufen Heidi Zechmann und Helmut Durich an, um einen ersten gemeinsamen Abend zur Besprechung auszumachen. Eine Radiomeldung über eine Mure auf der Strecke nach Lofer zwingt uns, das große deutsche Eck als mögliche Anfahrtsroute auf, und so fahren wir über Kufstein bei Regen auf die Inntalautobahn. Bis wir Innsbruck erreichen, zeigt das Wetter seine beste Seite und wir stellen unsere 3 DKW beim Verladebahnhof ab und besuchen das Zentrum der Tiroler Hauptstadt. Um 19:30 Uhr ist Bahnverladung und eine Stunde später geht der Nachtzug nach Düsseldorf (Produktionsstätte vieler unserer Autos). -

What Has Been Happening Over the Past Month ?
Austin 7 Club of S.A. Inc. CLUBROOMS: 262 Tapleys Hill Road, SEATON S.A. 5023 Bulletin Number 9 22.5.2020 What has been happening over the past month ? My boredom cure for Isolation. Take one feral car, add a moment of utter madness, and slowly add a toolbox full of spanners. Then lovingly and with a minimum of cursing start to dismember. Angle grinder and Oxy torch may at times need to be added. Do this for a whole four bloody (oops) weeks and then add paint to finish it off. It helps of course if you have been to lots of technical nights and spent up big on crank- shafts, camshafts, new pistons, etc. Etc. The next step is to lure a couple of mates to help lift the body off. I will bait the hook with a couple of bottles of wine. Hope that everyone is well. Cheers Wolf Past Events Weekend Run to the Rising Sun Hotel at Auburn 1994. When we are allowed out we should do a re-enactment. Coming Events Only one week to Winton if it had not been cancelled. Has everyone serviced their trailer? Friday Funnies All British Day February 2021 The ABD annual general meeting has been postponed. The Austin 7 is 100 years old in 2022 and we need to be the featured Marque at the ABD in 2022. To be the featured marque we need members to stand on the committee of the ABD to claim the date for us. th Austins Over Australia 24 – 29th August 2021 Is being held at Port Stephens in N.S.W. -

Träume Aus Chrom Und Lack. Autosammlungen Und Museen Zur
Ankerpunkte der Europäischen Route der Industriekultur · Industriekultur 1.15 31 Träume aus Chrom und Lack Autosammlungen und Museen zur Automobilgeschichte in Europa Frieder Bluhm Am Anfang der Geschichte des Automobils steht eine überholt. Aber schon seit Jahren gab es Überlegungen, Frau: Bertha Benz. Als sie sich im August 1888 mit ihren die Ära C. Benz und Söhne zu beenden. Die Bausubstanz Söhnen Eugen und Richard auf dem Benz Patent-Motor- war mittlerweile derart angegriffen, dass ein Fortbestand wagen auf die mehr als 100 Kilometer lange Überland- der Firma in der alten Fabrikanlage nicht mehr möglich war. fahrt von Mannheim nach Pforzheim und wieder zurück 2004 erwarb Winfried Seidel, Gründer von Vetera- begab, war dies der Beweis, dass im Automobil ernstzu- ma, Europas größtem Ersatzteilmarkt für Oldtimer, das nehmendes Potenzial steckte (Bertha Benz Memorial Route | Firmengelände. Mit Unterstützung von Mercedes-Benz www.bertha-benz.de). Und doch ahnte kein Zeitzeuge sanierte er die Fabrikhallen und gestaltete sie zum Mu- dieser Pioniertat, dass hundert Jahre später das Auto seum um. In fünf Bereichen präsentiert es die Geschich- das beherrschende Fortbewegungsmittel sein würde, te der Motorisierung anhand von 80 Fahrzeugen, vom auf das sich in weiten Teilen der Welt die gesamte Ver- Benz Patent-Motorenwagen bis zum Mercedes Formel-1- kehrsinfrastruktur ausrichtet. Der Siegeszug des Indivi- Rennwagen. Die Biografie der Motorisierung können dualverkehrs auf der Basis des Verbrennungsmotors Besucher an 30 Leuchtpyramiden nacherleben. Zeit- hatte erhebliche Auswirkungen auf die Gesellschaft. Mit zeugen der Automobilgeschichte werden dabei mit den der Massenproduktion des Autos ging eine Demokrati- großen Ereignissen der Weltgeschichte in Zusammen- sierung des Reisens einher. -

Teilnehmer Stand 19.07.2011, Lfd
1. August-Horch-Klassik, 24. Juli 2011 in Zwickau Liste der Teilnehmer Stand 19.07.2011, www.mc-zwickau.de lfd. Strt.- Fahrer Ort Beifahrer Ort Typ Baujahr Ccm Ps Nr. Nr. 1 V4 Tenzler Armin Zwickau Werner Winfried Lichtentanne Vorausfahrzeuge 2 V3 Vollnhals Rudolf Ingolstadt Horch 951 Cabrio 1940 5000 3 V2 Riedel Frank Niedercrinitz Wagner Eckhardt Niedercrinitz Horch 830 Cabrio 1933 3000 70 4 V1 Beetz Roland Hohenstein-Ernsttal Beetz Kerstin Hohenstein-Ernsttal Horch 420 1930 4500 90 Pkw 5 1 Wörmann Mathias Garmisch-Partenkirchen Wörmann Florian Garmisch-Partenkirchen Horch 830 1934 6 2 Ullmann Maik Grünhain-Beierfeld Ullmann Beate Grünhain-Beierfeld Wanderer W 10/1 1927 1550 30 7 3 Hanf Klaus Plauen Hanf Stephanie Plauen Dixi DA1 1928 748 15 8 4 Lindner Frank Mülsen Lindner Anett Mülsen Ford A 1928 3236 40 9 5 Albert Michael Mülsen Dixi D71 1929 15 10 6 Gorny Wulf Elsterberg/Kleingera Gorny Heike Elsterberg/Kleingera Audi Typ Zwickau 1929 5200 100 11 7 Haus Detlef Chemnitz Haus Elke Chemnitz Chevrolet International AC 1929 3136 46 12 8 Weller Thomas Oberhermsgrün Weller Regina Oberhermsgrün Wanderer W11 1929 2600 50 13 9 Laass Kristin Lichtentanne Laas Gitta Lichtentanne Ford A 1930 2023 28 14 10 Stöhr Rudolf Hohenölsen Stöhr Liane Hohenölsen Horch 780 oder 830 1932 5000 120 Krad 15 1 Firschke Manfred Morsbach Wanderer 2,5 Steuer-PS 1919 327 5 16 2 Zimmermann Dietmar Langenbernsdorf Neander 750V2 1928 750 22 17 3 Matthes Klaus Freiberg NSU 301T 1929 300 7 18 4 Karg Lutz Wilkau-Haßlau Karg Christjana Wilkau-Haßlau DKW SB 200 1936 200 7 19 5 Bötticher Herwig Wildenfels DKW SB 500 1937 500 20 6 Wienhold Rainer Zwickau Standard 1937 10 21 7 Klette Ernst Freiberg DKW KS 1938 200 8 22 8 Jung Rainer Werdau Rixe R.S. -
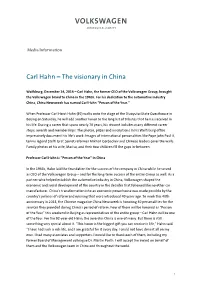
Carl Hahn – the Visionary in China
Media Information Carl Hahn – The visionary in China Wolfsburg, December 14, 2018 – Carl Hahn, the former CEO of the Volkswagen Group, brought the Volkswagen brand to China in the 1980s. For his dedication to the automotive industry China, China Newsweek has named Carl Hahn “Person of the Year.” When Professor Carl Horst Hahn (92) walks onto the stage of the Diaoyutai State Guesthouse in Beijing on Saturday, he will add another honor to the long list of tributes that he has received in his life. During a career that spans nearly 70 years, his résumé includes many different career stops, awards and memberships. The photos, prizes and inscriptions in his Wolfsburg office impressively document his life’s work: Images of international personalities like Pope John Paul II, tennis legend Steffi Graf, Soviet reformer Mikhail Gorbachev and Chinese leaders cover the walls. Family photos of his wife, Marisa, and their four children fill the gaps in-between. Professor Carl Hahn is “Person of the Year” in China In the 1980s, Hahn laid the foundation for the success of the company in China while he served as CEO of the Volkswagen Group – and for the long-term success of the entire Group as well. As a partner who helped establish the automotive industry in China, Volkswagen shaped the economic and social development of the country in the decades that followed like no other car manufacturer. China’s transformation into an economic powerhouse was made possible by the country’s policies of reform and opening that were introduced 40 years ago. To mark this 40th anniversary in 2018, the Chinese magazine China Newsweek is honoring 40 personalities for the services they provided during China’s period of reform. -

Die Auto Union AG Und Ihre Reaktionen Auf Das „Volkswagen“-Projekt 1931-1942
Die Auto Union AG Die Auto Union AG und ihre Reaktionen auf das „Volkswagen“-Projekt 1931-1942 VON LUTZ SARTOR Überblick Es wird an einem Beispiel der Frage nachgegangen, wie sich die deutsche Automobilindustrie zum nationalsozialistischen Projekt eines Volkswagens1 und damit zu einem neuen Produkt auf dem umkämpften Kleinwagenmarkt verhalten hat. Die Auto Union AG eignet sich für diese Untersuchung beson- ders,2 da sie als zweitgrößter Kleinwagenproduzent Deutschlands in beson- derem Maße von den Planungen zum Volkswagen betroffen war. Nach ein- leitenden Bemerkungen zu den Grundlagen des Volkswagen-Projekts und der Vorstellung des erfolgreichen Kleinwagens von DKW und später Auto Union wird untersucht, wie der Konzern auf den neuen Kleinwagen Volks- wagen reagierte und seinen Spielraum ausschöpfte. Hierbei sind verschiede- ne Unternehmensstrategien und Grade der Aktivität zu verfolgen. Der Schwer- punkt lag auf Maßnahmen im Rahmen des Reichsverbandes der deutschen Automobilindustrie (RDA) und im Konzern selbst. Im Zusammenhang mit dem letzteren Punkt sind auch die im Auftrag der Firma angefertigten Berichte und Analysen eines externen Fachmannes von Interesse. Die Anstrengungen der Auto Union AG waren zwar alle als gescheitert anzusehen, behinderten aber in keiner Weise die weitere Entwicklung. Abstract This article presents an example of the way in which the German automobile industry responded to the national socialists’ idea of a „people’s car“3 and, correspondingly, to a new product in the heavily contestet small car market. 1 Anstelle des ebenfalls gebräuchlichen Namens „KdF-Wagen“ wird durchgängig dieser Begriff verwendet. 2 Der 1998 bis 2000 im Sächsischen Staatsarchiv Chemnitz mustergültig erschlossene Be- stand dieses Konzerns eröffnet die Möglichkeit, die Verhaltensweisen des Konzerns in den verschiedenen Stadien der Entwicklung des Volkswagen-Projektes nachzuzeichnen.