091015 Final Koordinierungsbericht BAG Main
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Download Panoramakarte
Bildnachweise: Andreas Hub, Thomas Ochs Thomas Hub, Andreas Bildnachweise: Würzburg. Bonitasprint, von Farben kobaltfreien und und Druck: Klimaneutral gedruckt auf Recyclingpapier mit mineralöl mit Recyclingpapier auf gedruckt Klimaneutral Druck: 5–7 layout.de Gestaltung: kobold Gestaltung: 1 – 2 3 4 franken.de. 3. Auflage 2021, 10.000 Stück. Stück. 10.000 2021, Auflage 3. franken.de. www.flussparadies BAUNACH MAIN BAMBERG REGNITZ AURACH Impressum: Flussparadies Franken e. V., Ludwigstr. 25, 96052 Bamberg, Bamberg, 96052 25, Ludwigstr. V., e. Franken Flussparadies Impressum: R AUHE & ITZ REICHE EBRACH Raums (ELER) im Jahr 2015 Jahr im (ELER) Raums fonds für die Entwicklung des ländlichen ländlichen des Entwicklung die für fonds Landwirtschafts Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Europäischen den und Forsten und Landwirtschaft Ernährung, für Staatsministerium Bayerische das durch Gefördert und Haßberge. und die LAGs der Landkreise Forchheim, Bamberg, Lichtenfels Lichtenfels Bamberg, Forchheim, Landkreise der LAGs die Jura sowie sowie Jura Obermain und Haßberge Schweiz, Fränkische die Tourist Informationen und Naturparke Steigerwald, Steigerwald, Naturparke und Informationen Tourist die sind die Bayerischen Staatsforsten Forstbetrieb Forchheim, Forchheim, Forstbetrieb Staatsforsten Bayerischen die sind Gemeinden und den Wandervereinen. Kooperationspartner Kooperationspartner Wandervereinen. den und Gemeinden paradieses Franken e. V. zusammen mit 26 Städten und und Städten 26 mit zusammen V. e. Franken paradieses Fluss des Projekt ein ist Wanderweg Flüsse Der Sieben Der Hochwasser im Itzgrund I Thomas Ochs Naturnaher Main | Andreas Hub Bambergs Obere Brücke mit dem Alten Rathaus | Thomas Ochs Die Regnitz bei Seußling | Thomas Ochs Durch den Wiesengrund bei Pettstadt I Andreas Hub PARTNER PARTNER DIE GEHEIMNISVOLLEN DER DYNAMISCHE DIE SCHÖNE AM WASSER DIE FLIESSENDE DIE GLITZERNDEN am Rande des Steigerwalds zurück nach Bamberg. -
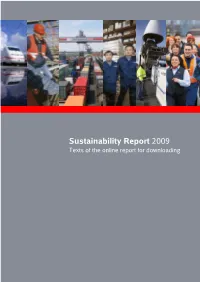
Sustainability Report 2009 Texts of the Online Report for Downloading
Sustainability Report 2009 Texts of the online report for downloading 1 Note: These are the texts of the Sustainability Report 2009, which are being made available in this file for archival purposes. The Sustainability Report was designed for an Internet presentation. Thus, for example, related links are shown only on the Internet in order to ensure that the report can be kept up-to-date over the next two years until the next report is due. Where appropriate, graphics are offered on the Internet in better quality than in this document in order to reduce the size of the file downloaded. 2 Table of Contents 1 Our company 6 1.1 Preface .................................................................................................................................... 6 1.2 Corporate Culture................................................................................................................... 7 1.2.1 Confidence..................................................................................................................................... 7 1.2.2 Values ............................................................................................................................................ 8 1.2.3 Dialog ........................................................................................................................................... 10 1.2.3.1 Stakeholder dialogs 10 1.2.3.2 Memberships 12 1.2.3.3 Environmental dialog 14 1.3 Strategy ................................................................................................................................ -

EU – Wasserrahmenrichtlinie Bericht Zur Bestandsaufnahme Bearbeitungsgebiet Neckar Teilbearbeitungsgebiet 51 (Tauber Im Bearbe
EU – Wasserrahmenrichtlinie Bericht zur Bestandsaufnahme Bearbeitungsgebiet Neckar Teilbearbeitungsgebiet 51 (Tauber im Bearbeitungsgebiet Main) Anhangsband WRRL - Bericht zur Bestandsaufnahme TBG 51 Tabellenverzeichnis 2 Wasserkörper 2.2.2 Beschreibung der Hydrogeologischen Einheiten 3 Menschliche Tätigkeiten und Belastungen 3.1 Belastungen der Oberflächengewässer 3.1.1 Signifikante Kommunale Einleiter 3.1.2 Signifikante Industrielle Einleiter 3.1.3-1 MONERIS-Gebiete 3.1.3-2 Stickstoff-Einträge OG (MONERIS) 3.1.3-3 Phosphor-Einträge OG (MONERIS) 3.1.4 Signifikante Wasserentnahmen durch Ausleitungen 3.1.6 Signifikanter Rückstau 3.2 Belastungen des Grundwassers 3.2.1-1 Sanierungsbedürftige Altlasten nach BBodSchG mit Wirkungspfad Boden- Grundwasser 3.2.1-2 Sanierungsbedürftige Schädliche Bodenveränderungen nach BBodSchG mit Wirkungspfad Boden-Grundwasser 4 Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten 4.1.3 Gefährdungsabschätzung Oberflächenwasserkörper 5 Verzeichnis der Schutzgebiete 5.1 Wasserschutzgebiete 5.2 Badegewässer 5.3-1 Wasserabhängige FFH-Gebiete 5.3-2 Wasserabhängige Vogelschutzgebiete 2 / 3 WRRL - Bericht zur Bestandsaufnahme TBG 51 Kartenverzeichnis Allgemein K 1.1 Übersichtskarte Oberflächengewässer K 2.1 Biologische Gewässergüte nach LAWA K 2.2 Gewässerstruktur nach LAWA K 3.1 Fluss- und Seewasserkörper K 4.1 Biozönotisch bedeutsame Gewässertypen K 6.1 Vorauswahl - künstliche und erheblich veränderte Gewässerabschnitte K 6.2 Signifikante morphologische Veränderungen K 6.3 Signifikante Abflussregulierung und signifikante Wasserentnahmen -

Mittels Edna & M
PILOTSTUDIE ZUR ERFASSUNG AQUATISCHER LEBENSFORMEN MITTELS EDNA & METABARCODING Bericht zum „Glücksspirale-Projekt“ 2016 der BGS Oberfranken Gefördert durch den Bayerischen Naturschutzfonds aus Mitteln der Glücksspirale INHALTSVERZEICHNIS ZUSAMMENFASSUNG .............................................................................................................................. 4 SUMMARY ................................................................................................................................................ 4 EINLEITUNG ............................................................................................................................................. 5 Die Methode „environmental DNA“ (eDNA) .................................................................................. 6 DNA Barcoding & Referenzdatenbanken ..................................................................................... 8 Pilotstudien ........................................................................................................................................ 9 MATERIAL & METHODEN ...................................................................................................................... 10 Projektgebiet .................................................................................................................................... 10 Untersuchte Gewässer .................................................................................................................. 12 Craimoosweiher ......................................................................................................................... -

Landschaftspflegekonzept Zum Naturpark Neckartal-Odenwald
Landschaftspflegekonzept zum Naturpark Neckartal-Odenwald Stand: 21.11.2016 Bearbeitung: Dipl.-Ing. Bärbel Schlosser Dr. Miriam Pfäffle Gesellschaft für Landschaftsökologie und Umweltplanung Gesellschaft für Landschaftsökologie und Umweltplanung St.-Peter-Straße 2 . 69126 Heidelberg . t 0 62 21 3950590 . f 0 62 21 3950580 [email protected] . www.bioplan-landschaft.de Inhaltsverzeichnis 1.0 Anlass und Aufgabenstellung .............................................................................................. 4 1.1 Anlass und Zielsetzung ....................................................................................................... 4 1.2 Aufbau des Landschaftspflegekonzepts ............................................................................ 5 1.3 Räumliche Abgrenzung ....................................................................................................... 6 1.4 Bereits bestehende Programme und Konzepte innerhalb der Naturparkkulisse ......... 7 2.0 Naturpark Neckartal-Odenwald ........................................................................................ 11 2.1 Beschreibung der Naturräume ........................................................................................ 12 2.1.1 Bergstraße ......................................................................................................................... 13 2.1.2 Vorderer Odenwald .......................................................................................................... 14 2.1.3 Sandstein-Odenwald ........................................................................................................ -

Naturschutzvo Südlicher Itzgrund 120 1
NaturschutzVO Südlicher Itzgrund 120 Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Südlicher Itzgrund“ im Gebiet der Stadt Coburg und des Landkreises Coburg vom 15.07.1993, zuletzt geändert durch Verordnung zur Anpassung von Verordnungen über Landschafts- schutzgebiete an den Euro vom 08.11.2001 (RABl OFr. Nr. 12/2001), in der vom 01.01.2002 an gültigen Fassung. Auf Grund von Art. 10 Abs. 2 Satz 3 des Bayerischen Naturschutzgesetzes – BayNatSchG – (BayRS 791-1-U), in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.08.1998 (GVBl S. 593), zuletzt geändert durch § 64 des Gesetzes vom 24.04.2001 (GVBl S. 140), erlässt der Bezirk Oberfranken folgende Verordnung: Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Südlicher Itzgrund“ im Gebiet der Stadt Coburg und des Landkreises Coburg § 1 Schutzgegenstand Der südlich von Coburg im Gebiet der Stadt und des Landkreises Coburg gelegene Landschaft- und Talraum der Itz wird in den in § 2 näher bezeichneten Grenzen unter der Bezeichnung „Südlicher Itzgrund“ als Landschaftsschutzgebiet geschützt. Das Landschaftsschutzgebiet hat eine Größe von ca. 1.222 ha. § 2 Schutzgebietsgrenzen (1) Die Grenzen des Landschaftsschutzgebietes verlaufen wie folgt: Im Osten ausgehend von der Brücke der B4 über die Itz ca. 400 m entlang der Kläranlage nach Süden und weiterführend nach Osten zur Itz und nach Südosten, Osten ca. 350 m nach Norden bis zur Bahnstrecke Bamberg-Coburg, an dieser entlang ca. 700 m nach Süden bis zum Nordrand eines Baugebietes, an diesem 100 m jeweils nach Westen und Süden bis zu einem Feldweg, an diesem nach Westen bis zur B 4 zurück, 100 m ostseits der B 4 nach Norden und am westseitigen Rand der Anschlussschleifen nach Ahorn, von Ahorn in die B 4 und weiter entlang der B 4 in Richtung Süden bis Niederfüllbach in Höhe der Zufahrt zur Geizenmühle, das Mühlengebäude ca. -

Geo-Naturpark Aktuell Jahrgang 15 · Ausgabe Nr
Geo-Naturpark aktuell Jahrgang 15 · Ausgabe Nr. 25 · 2. Halbjahr 2017 Infomagazin des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald In dieser Ausgabe Der UNESCO-Geopark und seine Partner: Römer und Global Nomadic Art Im Portrait: Ranger im Profil Erleben und Geniessen: Geo-Naturparktag, Klingender Steinbruch und Fotoausstellung Natur entdecken und bewahren: NABU Darmstadt und Äskulapnatter Engagement: Bergtierpark und Geopark vor Ort Ausgezeichnet: Klimakoffer, Geotop des Jahres und Streuobstwiesenretter Urpferd & Co: Kids im Geo-Naturpark Lesen und entdecken: Geotouren, Kleines ABC und Wanderkarten Kenner der Region verraten: Mein Lieblingsplatz National und International: Nationale Geotope und Geopark Naturtejo, Portugal Veranstaltungskalender: Juli bis Dezember 2017 Liebe Leser, Unser Service: Außendienst Liebe Leserinnen und Leser, die Sommerferien beginnen – und rechtzeitig dazu haben wir wieder ein um- fangreiches Programm für Sie bereitgestellt. Auch viele unserer Kooperationspartner empfehlen sich mit interessanten Ver- anstaltungen über die Sommermonate, ob der „Römersommer“ in Obernburg, das „Global Nomadic Art-Project“ in Darmstadt oder der „Klingende Steinbruch“ in Mömlingen. Ein Hinweis: Schauen Sie mal auf Seite 13 „Lieblingsorte im UNESCO Geopark“. Dort halten unsere Kooperationspartner Ute Ritschel und Dr. Jürgen Jung „echt klasse Tipps“ bereit! Sowohl der Waldkunstpfad in Darmstadt als auch die Gott- hardsruine in Weilbach/Amorbach sind einen Besuch wert, ich bin mir sicher, Sie werden begeistert sein. Spezielle Angebote halten wir für unsere jungen „Entdecker“ bereit. Nicht nur der Bergtierpark in Fürth-Erlen- bach ist hier zu empfehlen, er zeigt Tiere aus fünf Erdteilen und punktet mit Indianertipis und einem vielfälti- ges Erlebnis-Angebot. Auch die Entdeckungsreisen in die Natur, Urpferd & Co und kleine Höhlenforscher bieten spannende Erlebnisse in den Ferien. -

Bundesautobahn a 73 Suhl – Lichtenfels
Bundesautobahn A 73 Suhl – Lichtenfels Dokumentation 2008 (1,1) -2- US_A73 19.08.2008, 16:12:34 Uhr Neubau der A 73 zwischen dem Autobahndreieck Suhl und der Anschlussstelle Lichtenfels Dokumentation 2008 im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland des Freistaates Thüringen des Freistaates Bayern DEGES Historie Inhalt Zum Geleit Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung . Seite 4 Thüringer Minister für Bau, Landesentwicklung und Medien . Seite 6 Bayerischer Staatsminister des Innern . Seite 8 Historie Zur Baugeschichte der A 73 . Seite 10 Neubeginn Verkehrsprojekte Deutsche Einheit . Seite 14 DEGES – moderner Dienstleister der Auftragsverwaltung . Seite 15 Die bayerische Straßenbauverwaltung . Seite 16 Planung Planungs- und Verfahrensschritte für die A 73 . Seite 18 VDE Nr. 16: A 71 Erfurt – Schweinfurt/A 73 Suhl – Lichtenfels . Seite 21 Hoher Stellenwert für die Belange der Umwelt . Seite 23 Aufwändige Suche nach der besten Linie . Seite 25 Nachhaltige Entlastung vom Durchgangsverkehr . Seite 27 Freihändiger Grunderwerb und Flurneuordnung . Seite 29 Steckenbezogene Gestaltungskonzepte für die Brückenbauwerke . Seite 32 ૺૺૺૺૺ Die A 73 in Thüringen (TH) Maßnahmen 1. Abschnitt: AD Suhl (A 71/A 73) – AS Suhl-Friedberg . Seite 34 2. Abschnitt: AS Suhl-Friedberg – AS Schleusingen (B 4) . Seite 40 3. Abschnitt: südl. AS Schleusingen – n ördl. AS Eisfeld-Nord . Seite 48 4. Abschnitt: AS Eisfeld-Nord – Lgr. TH/BY . Seite 54 Region Was Thüringen ausmacht . Seite 58 2 Historie Inhalt Die A 73 in Bayern (BY) Maßnahmen Nordabschnitt: Lgr. TH/BY – westlich AS Coburg (B 4) . Seite 62 Mittelabschnitt: AS Coburg – AS Ebersdorf b. Coburg (B 303) . Seite 66 Südabschnitt: AS Ebersdorf b. Coburg – AS Lichtenfels (B 173/A 73) . Seite 73 Leistungsfähige Zubringer zur neuen Autobahn . -

Fortschreibung Des Nahverkehrsplans Für Stadt Und Landkreis Coburg
Lautertal Bad Rodach Neustadt bei Coburg Meeder Rödental Dörfles-Esbach Coburg Weitramsdorf Grub am Forst Ebersdorf Ahorn bei Coburg Niederfüllbach Sonnefeld Weidhausen Untersiemau bei Coburg Seßlach Großheirath Itzgrund ARGE ÖPNV Stadt und Landkreis Coburg Fortschreibung des Nahverkehrsplans für Stadt und Landkreis Coburg ____________________________________________________________________________________ ARGE ÖPNV Stadt und Landkreis Coburg Fortschreibung des Nahverkehrsplans für Stadt und Landkreis Coburg Endbericht Aufgabenträger: Stadt Coburg Landkreis Coburg Markt 1 Lauterer Straße 60 96450 Coburg 96450 Coburg Bearbeitung: Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult Wilhelmshöher Allee 274 34131 Kassel Tel.: 0561 – 988 349 65 Fax: 0561 – 988 349 68 Mail: [email protected] www.mathias-schmechtig.de Kassel, Juli 2015 Fortschreibung des Nahverkehrsplans für Stadt und Landkreis Coburg ____________________________________________________________________________________ Inhalt: Prozess der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes ........................................... 1 1 Rahmenbedingungen und Zielvorgaben ..................................................... 3 1.1 Gesetzliche Grundlagen ........................................................................... 3 1.1.1 EU-Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 .............................................. 3 1.1.2 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) ............................................ 4 1.1.3 Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG) ............................................................................. -

National NOTE 132P
DOCUMENT RESUME ED 275 570 SO 017 314 AUTHOR Glasrud, Clarence A., Ed. TITLE A Special Relationship: Germany and Minnesota, 1945-1985=Brucken Uber Grenzen: Minnesota und Bundesrepublik Deutschland, 1945-1985. INSTITUTION Concordia Coll., Moorhead, Minn. SPONS AGENCY Minnesota Humanities Commission, St. Paul.; National Endowment Zor the Humanities (NFAH), Washington, D.C. PUB DATE 83 NOTE 132p.; Papers presented at a conference entitled "A Heritage Fulfilled: German Americans" (Minneapolis, MN, April 22, 1982). Some photographs may not reproduce well. AVAILABLE FROM International Language Villages, Concordia College, Moorhead, MN 56560 (write for price). PUB TYPE Collected Works - Conference Proceedings (021)-- Historical Materials (060) -- Reports- General (140) EDRS PRICE MF01 Plus Postage. PC Not Available from EDRS. DESCRIPTORS Ethnic Groups; *Ethnicity; Foreign Countries; *Global Approach; Group Unity; Higher Education; *Intercultural Programs; *International Cooperation; *International Relations; International Trade; Resource Materials; Secondary Education IDENTIFIERS *Minnesota; *West Germaay ABSTRACT This collection of conference papers describes the post-World War II relationship between Germany and Minnesota. The relationship with the Federal Republic of West Germany is emphasized but East Germany is not ignored. The papers include: "Current Issues in German-American Relations" (P. Hermes); "The Cult of Talent and Genius: A German Specialty" (F. R. Stern with R. W. Franklin); "West Germany: Economic Power--Political Power" (L. J. Rippley); "The Image of the German in Contemporary Minnesota" (G. H. Weiss); "Cultural Exchange, Germany-Minnesota: A Case Study in Education" (N. Benzel); "The German Theological and Liturgical Influence in Minnesota: St. John's Abbey and the Liturgical Revival" (R. W. Franklin); "The German Impact on Modernism in Art" (M. -
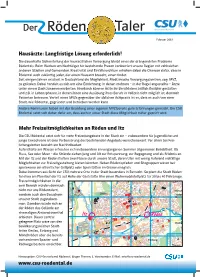
Itz Röden a E Mönch- Er G- W Tr E
Ortsverband Rödental Februar 2019 Hausärzte: Langfristige Lösung erforderlich! Die dauerhafte Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung bleibt eines der drängendsten Probleme Rödentals. Beim Werben um Nachfolger für bestehende Praxen konkurriert unsere Region mit zahlreichen anderen Städten und Gemeinden. Kreativität und Einfallsreichtum erhöhen dabei die Chancen dafür, dass in Rödental auch zukünftig jeder, der einen Hausarzt braucht, einen findet. Seit einigen Jahren existiert in Deutschland die Möglichkeit, Medizinische Versorgungszentren, sog. MVZ, zu gründen. Dabei handelt es sich um eine Einrichtung, in denen mehrere – in der Regel angestellte – Ärzte unter einem Dach zusammenarbeiten. Hierdurch können Ärzte ihr Berufsleben zeitlich flexibler gestalten und z.B. in Lebensphasen, in denen ihnen eine Ausübung ihres Berufs in Vollzeit nicht möglich ist, dennoch Patienten betreuen. Vorteil eines MVZs gegenüber der üblichen Arztpraxis ist es, dass es auch von einer Stadt, wie Rödental, gegründet und betrieben werden kann. Andere Kommunen haben mit der Gründung eines eigenen MVZ bereits gute Erfahrungen gemacht. Die CSU Rödental setzt sich daher dafür ein, dass auch in unser Stadt diese Möglichkeit näher geprüft wird. Mehr Freizeitmöglichkeiten an Röden und Itz Die CSU Rödental setzt sich für mehr Freizeitangebote in der Stadt ein – insbesondere für Jugendliche und junge Erwachsene ist eine Verbesserung des bestehenden Angebots wünschenswert. Vor allem bei Frei- luftangeboten besteht ein Nachholbedarf. Nach Nach Mittelberg, Schalkau Rathaus Zeichenerklärung Parkplatz AAufenthalteg amB Wasser erfreutenC sich SchalkauinsbesondereD im EvergangenenF SommerR allgemeinerP Beliebtheit.H Ob I e W Fornbach Kirche, Kapelle F Feuerwehr Sportplatz Nach 1 r Neustadt b. e S Schule Post Tennisplatz Coburg 1 d W n i Fluss, See oder Meer – die Strände ziehen Jung und Alt zur Entspannung,K Kindergar zurten BegegnungApotheke Friedhof und alsil Erlebnis an. -
Zeitschrift Der Deutschen Geologischen Gesellschaft
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft Jahr/Year: 1852-1853 Band/Volume: 5 Autor(en)/Author(s): Schauroth Karl Friedrich Freiherr von Artikel/Article: Uebersicht der geognostiscben Verhältnisse des Herzogthums Coburg und der anstossenden Ländertheile, als Erläuterung zur geognostiscben Karte. 698-742 698 2. Uebersicht der geognostiscben Verhält- nisse des Herzogthums Coburg und der an- stossenden Ländertheile, als Erläuterung zur geognostiscben Karte. Von Herrn C. v, Schalroth zu Coburg. Hierzu Tafel XV. I. UEorp&ologlselier Uelierfelick des ^Landes. Das Herzogthum Sachsen-Coburg mit den anstossenden Ländertheilen bildet ein im Herzen von Deutschland, am südlichen Abhänge des Thüringer Waldes gelegenes Hügel- land, dessen Reliefformen sich im Allgemeinen jenen des Thüringer "Waldes anschliessen. Diese Reliefformen beur- kunden sich als die Wirkungen gleichzeitig eingetretener Ursachen, indem die Entstehung des Gebirges, die Hebungs- linie, welche die abyssodynamischen Kräfte sich ausgewählt hatten, eine in südöstlicher Richtung zu verfolgende, der Hauptrichtung des Thüringer Waldes gleichlaufende Anein- anderreihung unserer Hügel bedingte. Eine solche Hügelreihe lässt sich , zunächst dem Ge- birge, von Tosse?ithal an über Sonneberg und Burggrub zu- sammenstellen, eine zweite, weniger regelmässige, von Eis- feld bis Mönchröden, eine dritte, weitfortsetzende und mehr in die Augen fallende von Hildburghausen bis Rottenbach, Mönchröden und Fürth am Berg bis Mödlitz, eine vierte end- lich von Rodach nach Coburg. Diese Hügelreihen sehen wir, bei der nahen Lage an dem, eine Hauptwasserscheide bildenden Thüringer Walde von Bächen durchschnitten, welche sich in den Gebieten der Rodach, der Itz und der Steinach sammeln und auf diesem Wege dem Main zueilen, indem sich die Steinach bei Markt 699 Zeula und die Itz, nachdem sie bei Gleuse?i die Rodach auf- genommen hat, bei Rattelsdorf in den Main ergiessen.