Zeitschrift Der Deutschen Geologischen Gesellschaft
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
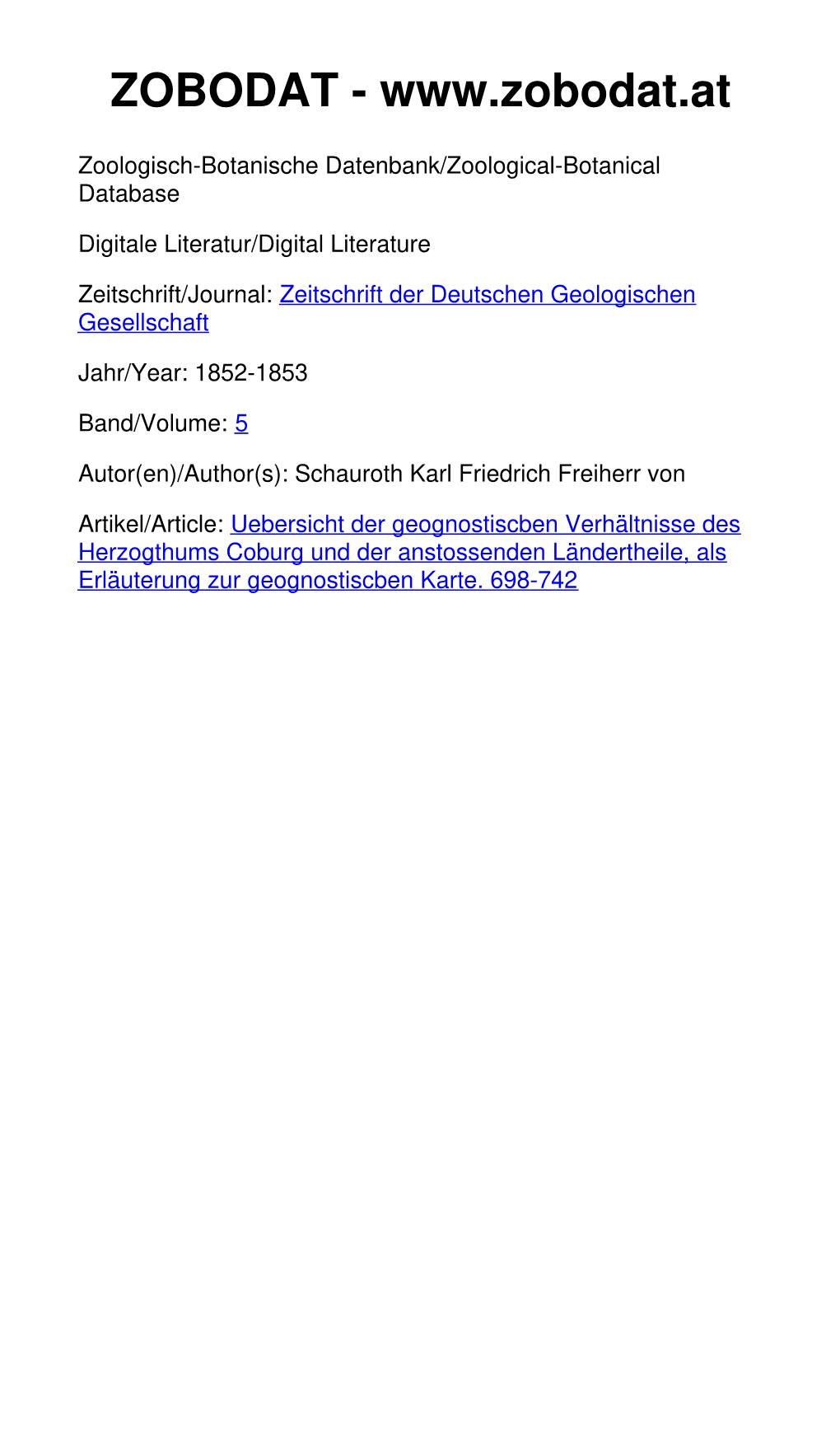
Load more
Recommended publications
-

Download Panoramakarte
Bildnachweise: Andreas Hub, Thomas Ochs Thomas Hub, Andreas Bildnachweise: Würzburg. Bonitasprint, von Farben kobaltfreien und und Druck: Klimaneutral gedruckt auf Recyclingpapier mit mineralöl mit Recyclingpapier auf gedruckt Klimaneutral Druck: 5–7 layout.de Gestaltung: kobold Gestaltung: 1 – 2 3 4 franken.de. 3. Auflage 2021, 10.000 Stück. Stück. 10.000 2021, Auflage 3. franken.de. www.flussparadies BAUNACH MAIN BAMBERG REGNITZ AURACH Impressum: Flussparadies Franken e. V., Ludwigstr. 25, 96052 Bamberg, Bamberg, 96052 25, Ludwigstr. V., e. Franken Flussparadies Impressum: R AUHE & ITZ REICHE EBRACH Raums (ELER) im Jahr 2015 Jahr im (ELER) Raums fonds für die Entwicklung des ländlichen ländlichen des Entwicklung die für fonds Landwirtschafts Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Europäischen den und Forsten und Landwirtschaft Ernährung, für Staatsministerium Bayerische das durch Gefördert und Haßberge. und die LAGs der Landkreise Forchheim, Bamberg, Lichtenfels Lichtenfels Bamberg, Forchheim, Landkreise der LAGs die Jura sowie sowie Jura Obermain und Haßberge Schweiz, Fränkische die Tourist Informationen und Naturparke Steigerwald, Steigerwald, Naturparke und Informationen Tourist die sind die Bayerischen Staatsforsten Forstbetrieb Forchheim, Forchheim, Forstbetrieb Staatsforsten Bayerischen die sind Gemeinden und den Wandervereinen. Kooperationspartner Kooperationspartner Wandervereinen. den und Gemeinden paradieses Franken e. V. zusammen mit 26 Städten und und Städten 26 mit zusammen V. e. Franken paradieses Fluss des Projekt ein ist Wanderweg Flüsse Der Sieben Der Hochwasser im Itzgrund I Thomas Ochs Naturnaher Main | Andreas Hub Bambergs Obere Brücke mit dem Alten Rathaus | Thomas Ochs Die Regnitz bei Seußling | Thomas Ochs Durch den Wiesengrund bei Pettstadt I Andreas Hub PARTNER PARTNER DIE GEHEIMNISVOLLEN DER DYNAMISCHE DIE SCHÖNE AM WASSER DIE FLIESSENDE DIE GLITZERNDEN am Rande des Steigerwalds zurück nach Bamberg. -
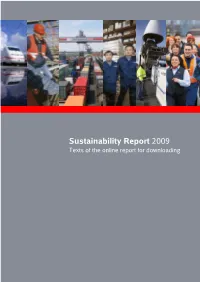
Sustainability Report 2009 Texts of the Online Report for Downloading
Sustainability Report 2009 Texts of the online report for downloading 1 Note: These are the texts of the Sustainability Report 2009, which are being made available in this file for archival purposes. The Sustainability Report was designed for an Internet presentation. Thus, for example, related links are shown only on the Internet in order to ensure that the report can be kept up-to-date over the next two years until the next report is due. Where appropriate, graphics are offered on the Internet in better quality than in this document in order to reduce the size of the file downloaded. 2 Table of Contents 1 Our company 6 1.1 Preface .................................................................................................................................... 6 1.2 Corporate Culture................................................................................................................... 7 1.2.1 Confidence..................................................................................................................................... 7 1.2.2 Values ............................................................................................................................................ 8 1.2.3 Dialog ........................................................................................................................................... 10 1.2.3.1 Stakeholder dialogs 10 1.2.3.2 Memberships 12 1.2.3.3 Environmental dialog 14 1.3 Strategy ................................................................................................................................ -

Mittels Edna & M
PILOTSTUDIE ZUR ERFASSUNG AQUATISCHER LEBENSFORMEN MITTELS EDNA & METABARCODING Bericht zum „Glücksspirale-Projekt“ 2016 der BGS Oberfranken Gefördert durch den Bayerischen Naturschutzfonds aus Mitteln der Glücksspirale INHALTSVERZEICHNIS ZUSAMMENFASSUNG .............................................................................................................................. 4 SUMMARY ................................................................................................................................................ 4 EINLEITUNG ............................................................................................................................................. 5 Die Methode „environmental DNA“ (eDNA) .................................................................................. 6 DNA Barcoding & Referenzdatenbanken ..................................................................................... 8 Pilotstudien ........................................................................................................................................ 9 MATERIAL & METHODEN ...................................................................................................................... 10 Projektgebiet .................................................................................................................................... 10 Untersuchte Gewässer .................................................................................................................. 12 Craimoosweiher ......................................................................................................................... -

091015 Final Koordinierungsbericht BAG Main
Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt Freistaat Thüringen Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) Internationale Flussgebietseinheit Rhein Bearbeitungsgebiet Main Koordinierungsbericht Koordinierungsbericht BAG Main Impressum Dieser Bericht wurde von der Koordinierungsgruppe BAG Main erstellt. Oktober 2009 Federführung Regierung von Unterfranken, Sachgebiet Wasserwirtschaft Peterplatz 9, 97070 Würzburg Weitere Bearbeiter Hessen: Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt Gutleutstraße 114, 60327 Frankfurt Baden-Württemberg: Regierungspräsidium Stuttgart Ruppmannstraße 21, 70565 Stuttgart Thüringen: Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie Prüssingstraße 25, 07745 Jena Bayern: Bayerisches Landesamt für Umwelt Bürgermeister-Ulrich-Straße 160, 86179 Augsburg Seite 2 von 28 Koordinierungsbericht BAG Main Inhaltsverzeichnis Vorbemerkungen......................................................................................................................... 4 Einleitung..................................................................................................................................... 5 1 Abstimmungsprozess im Bearbeitungsgebiet Main ........................................................... 6 2 Allgemeine Beschreibung.................................................................................................... -

Naturschutzvo Südlicher Itzgrund 120 1
NaturschutzVO Südlicher Itzgrund 120 Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Südlicher Itzgrund“ im Gebiet der Stadt Coburg und des Landkreises Coburg vom 15.07.1993, zuletzt geändert durch Verordnung zur Anpassung von Verordnungen über Landschafts- schutzgebiete an den Euro vom 08.11.2001 (RABl OFr. Nr. 12/2001), in der vom 01.01.2002 an gültigen Fassung. Auf Grund von Art. 10 Abs. 2 Satz 3 des Bayerischen Naturschutzgesetzes – BayNatSchG – (BayRS 791-1-U), in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.08.1998 (GVBl S. 593), zuletzt geändert durch § 64 des Gesetzes vom 24.04.2001 (GVBl S. 140), erlässt der Bezirk Oberfranken folgende Verordnung: Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Südlicher Itzgrund“ im Gebiet der Stadt Coburg und des Landkreises Coburg § 1 Schutzgegenstand Der südlich von Coburg im Gebiet der Stadt und des Landkreises Coburg gelegene Landschaft- und Talraum der Itz wird in den in § 2 näher bezeichneten Grenzen unter der Bezeichnung „Südlicher Itzgrund“ als Landschaftsschutzgebiet geschützt. Das Landschaftsschutzgebiet hat eine Größe von ca. 1.222 ha. § 2 Schutzgebietsgrenzen (1) Die Grenzen des Landschaftsschutzgebietes verlaufen wie folgt: Im Osten ausgehend von der Brücke der B4 über die Itz ca. 400 m entlang der Kläranlage nach Süden und weiterführend nach Osten zur Itz und nach Südosten, Osten ca. 350 m nach Norden bis zur Bahnstrecke Bamberg-Coburg, an dieser entlang ca. 700 m nach Süden bis zum Nordrand eines Baugebietes, an diesem 100 m jeweils nach Westen und Süden bis zu einem Feldweg, an diesem nach Westen bis zur B 4 zurück, 100 m ostseits der B 4 nach Norden und am westseitigen Rand der Anschlussschleifen nach Ahorn, von Ahorn in die B 4 und weiter entlang der B 4 in Richtung Süden bis Niederfüllbach in Höhe der Zufahrt zur Geizenmühle, das Mühlengebäude ca. -

Bundesautobahn a 73 Suhl – Lichtenfels
Bundesautobahn A 73 Suhl – Lichtenfels Dokumentation 2008 (1,1) -2- US_A73 19.08.2008, 16:12:34 Uhr Neubau der A 73 zwischen dem Autobahndreieck Suhl und der Anschlussstelle Lichtenfels Dokumentation 2008 im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland des Freistaates Thüringen des Freistaates Bayern DEGES Historie Inhalt Zum Geleit Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung . Seite 4 Thüringer Minister für Bau, Landesentwicklung und Medien . Seite 6 Bayerischer Staatsminister des Innern . Seite 8 Historie Zur Baugeschichte der A 73 . Seite 10 Neubeginn Verkehrsprojekte Deutsche Einheit . Seite 14 DEGES – moderner Dienstleister der Auftragsverwaltung . Seite 15 Die bayerische Straßenbauverwaltung . Seite 16 Planung Planungs- und Verfahrensschritte für die A 73 . Seite 18 VDE Nr. 16: A 71 Erfurt – Schweinfurt/A 73 Suhl – Lichtenfels . Seite 21 Hoher Stellenwert für die Belange der Umwelt . Seite 23 Aufwändige Suche nach der besten Linie . Seite 25 Nachhaltige Entlastung vom Durchgangsverkehr . Seite 27 Freihändiger Grunderwerb und Flurneuordnung . Seite 29 Steckenbezogene Gestaltungskonzepte für die Brückenbauwerke . Seite 32 ૺૺૺૺૺ Die A 73 in Thüringen (TH) Maßnahmen 1. Abschnitt: AD Suhl (A 71/A 73) – AS Suhl-Friedberg . Seite 34 2. Abschnitt: AS Suhl-Friedberg – AS Schleusingen (B 4) . Seite 40 3. Abschnitt: südl. AS Schleusingen – n ördl. AS Eisfeld-Nord . Seite 48 4. Abschnitt: AS Eisfeld-Nord – Lgr. TH/BY . Seite 54 Region Was Thüringen ausmacht . Seite 58 2 Historie Inhalt Die A 73 in Bayern (BY) Maßnahmen Nordabschnitt: Lgr. TH/BY – westlich AS Coburg (B 4) . Seite 62 Mittelabschnitt: AS Coburg – AS Ebersdorf b. Coburg (B 303) . Seite 66 Südabschnitt: AS Ebersdorf b. Coburg – AS Lichtenfels (B 173/A 73) . Seite 73 Leistungsfähige Zubringer zur neuen Autobahn . -

Fortschreibung Des Nahverkehrsplans Für Stadt Und Landkreis Coburg
Lautertal Bad Rodach Neustadt bei Coburg Meeder Rödental Dörfles-Esbach Coburg Weitramsdorf Grub am Forst Ebersdorf Ahorn bei Coburg Niederfüllbach Sonnefeld Weidhausen Untersiemau bei Coburg Seßlach Großheirath Itzgrund ARGE ÖPNV Stadt und Landkreis Coburg Fortschreibung des Nahverkehrsplans für Stadt und Landkreis Coburg ____________________________________________________________________________________ ARGE ÖPNV Stadt und Landkreis Coburg Fortschreibung des Nahverkehrsplans für Stadt und Landkreis Coburg Endbericht Aufgabenträger: Stadt Coburg Landkreis Coburg Markt 1 Lauterer Straße 60 96450 Coburg 96450 Coburg Bearbeitung: Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult Wilhelmshöher Allee 274 34131 Kassel Tel.: 0561 – 988 349 65 Fax: 0561 – 988 349 68 Mail: [email protected] www.mathias-schmechtig.de Kassel, Juli 2015 Fortschreibung des Nahverkehrsplans für Stadt und Landkreis Coburg ____________________________________________________________________________________ Inhalt: Prozess der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes ........................................... 1 1 Rahmenbedingungen und Zielvorgaben ..................................................... 3 1.1 Gesetzliche Grundlagen ........................................................................... 3 1.1.1 EU-Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 .............................................. 3 1.1.2 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) ............................................ 4 1.1.3 Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG) ............................................................................. -

National NOTE 132P
DOCUMENT RESUME ED 275 570 SO 017 314 AUTHOR Glasrud, Clarence A., Ed. TITLE A Special Relationship: Germany and Minnesota, 1945-1985=Brucken Uber Grenzen: Minnesota und Bundesrepublik Deutschland, 1945-1985. INSTITUTION Concordia Coll., Moorhead, Minn. SPONS AGENCY Minnesota Humanities Commission, St. Paul.; National Endowment Zor the Humanities (NFAH), Washington, D.C. PUB DATE 83 NOTE 132p.; Papers presented at a conference entitled "A Heritage Fulfilled: German Americans" (Minneapolis, MN, April 22, 1982). Some photographs may not reproduce well. AVAILABLE FROM International Language Villages, Concordia College, Moorhead, MN 56560 (write for price). PUB TYPE Collected Works - Conference Proceedings (021)-- Historical Materials (060) -- Reports- General (140) EDRS PRICE MF01 Plus Postage. PC Not Available from EDRS. DESCRIPTORS Ethnic Groups; *Ethnicity; Foreign Countries; *Global Approach; Group Unity; Higher Education; *Intercultural Programs; *International Cooperation; *International Relations; International Trade; Resource Materials; Secondary Education IDENTIFIERS *Minnesota; *West Germaay ABSTRACT This collection of conference papers describes the post-World War II relationship between Germany and Minnesota. The relationship with the Federal Republic of West Germany is emphasized but East Germany is not ignored. The papers include: "Current Issues in German-American Relations" (P. Hermes); "The Cult of Talent and Genius: A German Specialty" (F. R. Stern with R. W. Franklin); "West Germany: Economic Power--Political Power" (L. J. Rippley); "The Image of the German in Contemporary Minnesota" (G. H. Weiss); "Cultural Exchange, Germany-Minnesota: A Case Study in Education" (N. Benzel); "The German Theological and Liturgical Influence in Minnesota: St. John's Abbey and the Liturgical Revival" (R. W. Franklin); "The German Impact on Modernism in Art" (M. -
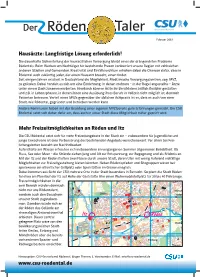
Itz Röden a E Mönch- Er G- W Tr E
Ortsverband Rödental Februar 2019 Hausärzte: Langfristige Lösung erforderlich! Die dauerhafte Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung bleibt eines der drängendsten Probleme Rödentals. Beim Werben um Nachfolger für bestehende Praxen konkurriert unsere Region mit zahlreichen anderen Städten und Gemeinden. Kreativität und Einfallsreichtum erhöhen dabei die Chancen dafür, dass in Rödental auch zukünftig jeder, der einen Hausarzt braucht, einen findet. Seit einigen Jahren existiert in Deutschland die Möglichkeit, Medizinische Versorgungszentren, sog. MVZ, zu gründen. Dabei handelt es sich um eine Einrichtung, in denen mehrere – in der Regel angestellte – Ärzte unter einem Dach zusammenarbeiten. Hierdurch können Ärzte ihr Berufsleben zeitlich flexibler gestalten und z.B. in Lebensphasen, in denen ihnen eine Ausübung ihres Berufs in Vollzeit nicht möglich ist, dennoch Patienten betreuen. Vorteil eines MVZs gegenüber der üblichen Arztpraxis ist es, dass es auch von einer Stadt, wie Rödental, gegründet und betrieben werden kann. Andere Kommunen haben mit der Gründung eines eigenen MVZ bereits gute Erfahrungen gemacht. Die CSU Rödental setzt sich daher dafür ein, dass auch in unser Stadt diese Möglichkeit näher geprüft wird. Mehr Freizeitmöglichkeiten an Röden und Itz Die CSU Rödental setzt sich für mehr Freizeitangebote in der Stadt ein – insbesondere für Jugendliche und junge Erwachsene ist eine Verbesserung des bestehenden Angebots wünschenswert. Vor allem bei Frei- luftangeboten besteht ein Nachholbedarf. Nach Nach Mittelberg, Schalkau Rathaus Zeichenerklärung Parkplatz AAufenthalteg amB Wasser erfreutenC sich SchalkauinsbesondereD im EvergangenenF SommerR allgemeinerP Beliebtheit.H Ob I e W Fornbach Kirche, Kapelle F Feuerwehr Sportplatz Nach 1 r Neustadt b. e S Schule Post Tennisplatz Coburg 1 d W n i Fluss, See oder Meer – die Strände ziehen Jung und Alt zur Entspannung,K Kindergar zurten BegegnungApotheke Friedhof und alsil Erlebnis an. -
Allgemeinverfügung Kormorane Main Und Nebenflüsse
Nr. 55.1-8642.01-19/09 Naturschutzrecht; Ausnahme nach § 43 Abs. 8 Satz 1 Nr. 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zum Ab- schuss von Kormoranen im Tal des Mains und seiner Nebenflüsse; Allgemeinverfügung Die Regierung von Oberfranken erlässt folgende Allgemeinverfügung: Auf der Grundlage von § 43 Abs. 8 Satz 1 Nr. 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 25. März 2002 (BGBl I S. 1193), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 22. Dezember 2008 (BGBl I S. 2986), werden zum Schutz gefährdeter Fischarten folgende über § 1 der Ver- ordnung über die Zulassung von Ausnahmen von den Schutzvorschriften für besonders ge- schützte Tier- und Pflanzenarten (Artenschutzrechtliche Ausnahmeverordnung - AAV) vom 3. Juni 2008 (GVBl S. 327) hinausgehende Regelungen getroffen: I. Tötung von Kormoranen (Phalacrocorax carbo sinensis) im Umkreis von 200 m um Fließ- gewässer 1. Der Abschuss von Kormoranen ist - am Main zwischen Lichtenfels und Bamberg - an der Itz unterhalb von Coburg bis zur Mündung in den Main - an der Rodach (Landkreis Coburg) unterhalb von Seßlach bis zur Mündung in die Itz - an der Baunach von der Grenze zum Regierungsbezirk Unterfranken bis Bau- nach - an der Steinach (Landkreise Coburg und Kronach) zwischen Wörlsdorf und Horb a.d. Steinach - an der Aisch von der Grenze zum Regierungsbezirk Mittelfranken bis zur Mün- dung in die Regnitz - 2 - - soweit diese Flächen in Oberfranken liegen - auch in den Europäischen Vogel- schutzgebieten "Täler von Oberem Main, Unterer Rodach und Steinach" (DE 5931- 471) "Itz-, Rodach- und Baunachaue" (DE 5831-471) und "Aischgrund" (DE 6331- 471) in der Zeit vom 1. September bis 15. Januar erlaubt. 2. In den unter Nr. -

Haßberge Haßberge
bodenständig aufgeschlossen voller Leben zukunftsorientiert erfolgreich HaßbergeLandkreis Heimat.Stark www.landkreis-hassberge.de 2 Landkreis Haßberge willkommen Der Landkreis Haßberge mit seinen Naturparks Haßberge und Steigerwald und dem Maintal dazwi- schen ist eine uralte und reiche Kulturlandschaft. starke Heimat Heimat - das sind Wohnort, Familie, Freunde und Bekannte, ein Geruch, ein Geschmack oder Klang - einfach ein wärmendes Gefühl als ruhender Gegen- pol zu einer beschleunigten Welt. Der Landkreis Haßberge ist eine Region mitten in Deutschland, wo sich ein Gefühl der Zugehörigkeit und des „zu Hause seins“ entwickelt hat, wo die Menschen Bodenhaftung haben und gerade deswegen aufgeschlossen, kreativ, zupackend und zukunftsorientiert sind. Die Kraft, die in diesem „Stück Heimat“ steckt, schätzen Einheimische, Heimkehrer und Zuziehende gleichermaßen. Hier Wurzeln zu schlagen lohnt sich. Seien Sie herzlich willkommen. Inhalt Sanfte Landschaft 4 Leben in der Natur 6 Zeitzeugen - Museen, Schlösser und Ruinen 8 Landtypisch - Städte und Dörfer 10 Menschen, Events, Tradition 12 „Heimkehrer“ erzählen 14 Wohnen, leben, lernen, arbeiten 16 Freizeit & Erholung 22 Bier und Wein - Genuss 24 Lage & Verkehrsanbindung 26 Zahlen, Daten, Fakten 28 Moderner Dienstleister - das Landratsamt 29 3 Landkreis Haßberge sanfte Landschaft ein Landkreis - Das Gebiet des Landkreises im nördlichen Unterfranken, zwei Naturparks flankiert von den Städten Bamberg, Coburg und Schweinfurt, wird geprägt durch die Naturräume Haßberge und nördlicher Steigerwald, verbunden durch die Lebensader Main. Ursprünglich im erdgeschichtlichen Zeitalter der Trias- Keuperstufe entstanden, präsentiert sich das an der ehemals innerdeutschen Grenze gelegene Gebiet heute sanfthügelig, reizvoll und abwechslungsreich, als eine der schönsten Mittelgebirgslandschaften Deutschlands. reizvoll Mit tiefgrünen Wiesentälern, Waldbuckeln, weiten Ausblicken und sonnenverwöhnten Weinbergen reizt diese Landschaft unsere Sinne und lässt „Stille erleben“. -

Master Plan Migratory Fish Rhine
Master Plan Migratory Fish Rhine Report No. 179 Imprint Publisher: International Commission for the Protection of the Rhine (ICPR) Kaiserin-Augusta-Anlagen 15, D 56068 Koblenz P.O. box 20 02 53, D 56002 Koblenz Telephone +49-(0)261-94252-0, Fax +49-(0)261-94252-52 Email: [email protected] www.iksr.org ISBN 978-3-941994-09-6 © IKSR-CIPR-ICBR 2009 Report 179e.doc Internationale Kommission zum Schutz des Rheins International Commission for the Protection of the Rhine Commission Internationale pour la Protection du Rhin Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn Master Plan Migratory Fish Rhine ICPR report no. 179 1. Initial conditions ..................................................................................... 2 2. Background............................................................................................ 3 3. Already implemented measures for anadromous migratory fish...................... 5 4. Measures planned for anadromous migratory fish in the different sections of the Rhine.................................................................................................... 6 4.1 River Continuity and Habitats...................................................................... 6 4.1.1 Delta Rhine............................................................................................ 6 4.1.2 Lower Rhine........................................................................................... 7 4.1.3 Middle Rhine .........................................................................................