Download Als
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Amtliche Bekanntmachung Des Landkreises Heidenheim: Allgemeinverfügung Des Landratsamtes Heidenheim
Amtliche Bekanntmachung des Landkreises Heidenheim: Allgemeinverfügung des Landratsamtes Heidenheim Das Landratsamt Heidenheim erlässt im Wege seiner Eilzuständigkeit nach § 16 Abs. 7 in Verbindung mit § 28 Abs. 3 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) für die Städte Heidenheim an der Brenz, Giengen an der Brenz, Herbrechtingen, Niederstotzingen und für die Gemeinden Dischingen, Gerstetten, Hermaringen, Königsbronn, Nattheim, Sontheim an der Brenz und Steinheim am Albuch folgende Allgemeinverfügung über die häusliche Absonderung von Personen, die mit dem neuartigen Corona-Virus SARS-CoV-2 infiziert sind und deren Kontaktpersonen zur Eindämmung und zum Schutz vor der Verbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 A) Entscheidung I. Adressat der Allgemeinverfügung 1. Adressat der Verfügung sind alle Personen, die positiv auf das Virus SARS-CoV-2 getestet wurden (Infizierte). 2. Die Allgemeinverfügung gilt auch für Kontaktpersonen nach III Nr. 1 der Verfügung. Diese Personen gelten solange als Infizierte, bis eine Infektion mit SARS-CoV-2 durch ärztliche Diagnose ausgeschlossen wird (Kontaktpersonen der Kategorie I). II. Anordnungen an den unter I) genannten Personenkreis 1. Infizierte haben sich – ohne weitere Anordnung – in häusliche Quarantäne zu begeben. Die Quarantäne dauert mindestens 14 Tage und endet frühestens 48 Stunden nach Eintritt der Symptomfreiheit. 2. Die Absonderung durch häusliche Quarantäne muss ohne zeitliche Verzögerung ab dem Bekanntwerden des positiven Testergebnisses auf SARS-CoV-2 bzw. ab Kenntnis des eigenen Status als Kontaktperson erfolgen. 3. Während der Absonderung ist es Infizierten und Kontaktpersonen untersagt, die Wohnung ohne ausdrückliche Zustimmung des Landratsamts Heidenheim – Gesundheitsamt zu verlassen. Dies gilt nicht, sofern ein Verlassen der Wohnung zum Schutz von Leben oder Gesundheit zwingend erforderlich ist (z. B. Hausbrand, medizinischer Notfall). -

Albuch-Bote-KV-Kw43-2020-S 806
68. Jahrgang Donnerstag, 22. Oktober 2020 Nummer 43 Mobil unterwegs in der Gemeinde Steinheim -BuÈ rgerbus wird zum BuÈrgermobil weiterentwickelt - Mit verschiedenen Maûnahmen wird die Ge- Car-Sharing die Beschaffung von drei E-Fahr- gen. Anschlieûend erhalten Sie eine Karte zur meinde Steinheim die Mobilitåt in der Ge- zeugen. Aufgrund von Verzægerungen bei der Aktivierung des Autos. Nach der Beantragung meinde voranbringen und Bçrgerinnen und Installation der notwendigen E-Ladesåulen wird Ihnen eine Beståtigungsmail zuge- Bçrgern die Mæglichkeit geben, mæglichst hat die Gemeinde bislang die Fahrzeuge beim schickt, in der Ihnen Ihre persænlichen Zu- lange selbstståndig zu bleiben, sei es zum Ein- Autohaus Baur in Mutlangen nicht abgerufen. gangsdaten mitgeteilt werden. Von nun an kaufen oder zum Arzt zu gelangen. Im låndlichen Raum låsst sich Car-Sharing kænnen Sie das Auto ganz bequem online bu- In der jçngsten Gemeinderatssitzung wurden durchaus schwieriger betreiben als in den chen! Ihr gebuchtes Fahrzeug steht bereit und folgende Maûnahmen beschlossen: Groûstådten. Groûe Car-Sharing-Anbieter in- kann mit der Kundenkarte geæffnet werden. vestieren daher nur in Stådten. Zudem macht Den Schlçssel finden Sie im Handschuhfach. Mitfahr-Tasche es die Corona-Zeit dem Car-Sharing noch Wenn Sie das Fahrzeug nicht mehr benætigen, Fçr den Teilort Sæhnstetten soll eine Mitfahr- schwerer - die Nutzung der Autos ist in vielen stellen Sie es einfach am Abholort wieder ab, Tasche eingefçhrt werden. Diese soll signali- Gemeinden seit Mårz stark rçcklåufig. Ebenso legen den Schlçssel ins Handschuhfach und sieren, dass der Tråger nach Sæhnstetten mit- sind viele Bçrgerinnen und Bçrger noch reser- verriegeln das Auto mit Ihrer Kundenkarte. genommen werden will, egal, ob er sich bei- viert gegençber E-Fahrzeugen. -

Bürgerinformation Inhaltsverzeichnis
Bürgerinformation Inhaltsverzeichnis Bezeichnung Seite Bezeichnung Seite Grußwort 1 Sportstätten 27 Gerstetten und seine Teilorte 2 Freizeiteinrichtungen 28 Branchenverzeichnis 4 Kirchen und religiöse Gemeinschaften 29 Eine Gemeinde in Zahlen 6 Gemeindehäuser 29 Sehenswürdigkeiten, Tourismus, Kultur 9 Gesundheitswesen und soziale Einrichtungen 30 Gemeinderäte 12 Unsere Partnerstädte 32 Ortschaftsräte 14 Der BdS Gerstetten lädt ein 34 Die Gemeindeverwaltung 16 Vereine und Verbände 36 Ein Wegweiser durch die Gemeindeverwaltung 18 Entsorgungseinrichtungen 38 Behörden und öffentliche Einrichtungen 22 Versorgungseinrichtungen 39 Kindergärten/Krippe 24 Impressum 40 Schulen 25 Notruftafel U3 Kultur und Freizeit 26 U = Umschlagseite BOSCH Tobias Thumm Kraftfahrzeugausrüstung KFZ-Reparaturen + Fahrzeughandel Wir machen, dass es fährt. Tobias Thumm Max-Eyth-Straße 30 Telefon 0 73 23 / 66 66 E-Mail [email protected] 89547 Heldenfi ngen Telefax 0 73 23 / 66 87 Internet www.go1a.de Grußwort Herzlich Willkommen in Gerstetten Diese neu überarbeitete Bürgerbroschüre soll Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, verehrte Neubürger, werte Gäste, mit Gerstetten und den Ortsteilen Dettingen, Gussenstadt, Heldenfingen, Heuchlingen, Heuchstetten und Sontbergen und deren Einrichtungen vertraut machen und den neu zugezogenen Einwohnern soll sie hel- fen, sich schnell bei uns zurechtzufinden und wohl zu fühlen. Große Wald- und Heideflächen sowie viele geologische Besonderheiten inmitten des UNESCO Geoparks Schwäbische Alb, verbunden mit zahlreichen Freizeiteinrichtungen und einem regen Vereinsleben, tragen entscheidend zu einem hohen Wohn- und Freizeitwert unserer Gemeinde bei. Allen Betrieben aus Handel, Gewerbe und Industrie, die die Herausgabe dieser Informationsschrift unter- stützt haben, danke ich sehr herzlich. Ich würde mich freuen, wenn Sie von den vielfältigen Angeboten Gebrauch machen und regen Anteil am bürgerlichen Leben in unserer Gemeinde nehmen würden. -

Declass Ified and Re Leased by Central Intelligence Agency Sources Kethods Exempt I 0N3828 Naz I Mar Cr Imes Disclosure Ag+ Date�`2001� 2006� � Copy
DECLASS IFIED AND RE LEASED BY CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY SOURCES KETHODS EXEMPT I 0N3828 NAZ I MAR CR IMES DISCLOSURE AG+ DATE`2001 2006 • COPY Contents . Page Part I: Warding off Dangers from the Defenceless ------------1 - 24 Preamble 1 Letters from Major General Vanamen and Brigadier , General Spivey 2 General Attitude. 3 A. Personal Interference in Favour Of Endangered Prisoners of War 4 - 19 1. The Congress of Doctors at Berlin - Schwanenwerderc- - - - 5 - 6 2. The Mission of7anaman end Spivey . • 7 3. The Prieoners of War Agreement with General Eisenhower and. the Transfei: of POWs from the East of Germany to the Nest 9 10 4. Tne Safeguarding of . POWs from Death caused by Ang/o- 41. , American Air-Raid Attacks 11 is 5. The Rescue of Prominent POWs from the Danger of being = • At Killed as Hostages- 13 • I, ‘' 6. The Reecue of TT U.S. : Pllots who had made a forced landing 14 . 7. The Re-organization of the Eastern. Prisoners . Living • - Condition- 15 - 19 : . f B. resMeasu against Prosecutions fo Political4RaCiald, an ... • ' Confessional2easons- • ., . ., 20 - 24 t .• i , .1 • ' ,. • 1. -Assistance fOr Norweigien Students 21 2. Support for,Relp from Abroad 1 22 , !..° •Assistance for Robert Bosch . 22. .23 .. , ..:. .:-. .. t •= 1 - 4. Personal Actions against Prosecution from Confessional Reasons. par.t1IL Short Survey of my Personal Life - . • 1, Descent and. Family - - fl 1 2. Education and Profeiiiion . 00.. 0:7.litary,ServiCe and Career 4"• Family 4.14.fe 5. The Present Situation of my Yemily - - - •o 6. Hy Political past . , .. .:.• . - ..• . 1 . ;, 7. My Present Opinion of the Past and...the iature . -
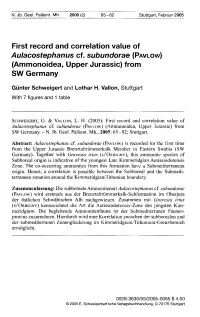
First Record and Correlation Value of Aulacostephanus Cf. Subundorae (PAVLOW) (Ammonoidea, Upper Jurassic) from SW Germany
N. Jb. Geol. Paläont. Mh. 2005 (2) 65-82 Stuttgart, Februar 2005 First record and correlation value of Aulacostephanus cf. subundorae (PAVLOW) (Ammonoidea, Upper Jurassic) from SW Germany Günter Schweigert and Lothar H. Vallon, Stuttgart With 7 figures and 1 table SCHWEIGERT, G. & VALLON, L. H. (2005): First record and correlation value of Aulacostephanus cf. subundorae (PAVLOW) (Ammonoidea, Upper Jurassic) from SW Germany. - N. Jb. Geol. Paläont. Mh., 2005: 65-82; Stuttgart. Abstract: Aulacostephanus cf. subundorae (PAVLOW) is recorded lor the first time from the Upper Jurassic Brenztaltrümmerkalk Member in Eastern Swabia (SW Germany). Together with Gravesia iritis (D'OKBIGNY), this ammonite species of Subboreal origin is indicative of the youngest Late Kimmeridgian Autissiodorensis Zone. The co-occurring ammonites from this formation have a Submediterranean origin. Hence, a correlation is possible between the Subboreal and the Submedi- terranean zonation around the Kimmeridgian/Tithonian boundary. Zusammenfassung: Die subboreale Ammonitenart Aulacostephanus cf. subundorae (PAVLOW) wird erstmals aus der Brenztaltrümmerkalk-Subformation im Oberjura der östlichen Schwäbischen Alb nachgewiesen. Zusammen mit Gravesia irius (D'ORBIGNY) kennzeichnet die Art die Autissiodorensis-Zone des jüngsten Kim- meridgium. Die begleitende Ammonitenfauna ist der Submediterranen Faunen- provinz zuzurechnen. Hierdurch wird eine Korrelation zwischen der subborealen und der submediterranen Zonengliederung im Kimmeridgium/Tithonium-Grenzbereich ermöglicht. 0028-3630/05/2005-0065 $ 4.50 © 2005 E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, D-70176 Stuttgart 66 G. Schweigert and L. H. Vallon 1. Introduction In the eastern part of Swabia, the Brenztaltrümmerkalk is a locally developed bioclastic deposit in the higher part of the Upper Jurassic. The Brenztal- trümmerkalk has a maximum thickness of about 100 meters and is mainly restricted to the near surroundings of Heidenheim and Schnaitheim, where it was quarried for several centuries as an important building stone. -

Oktober 2017 (4,03
Schutzgebühr 1 Euro www.kliniken-heidenheim.de Ausgabe 4. Quartal 2017 | 1. Oktober 2017 Zeitung des Klinikums Heidenheim » DER PATIENT AUS DEM INHALT 2. Bauabschnitt startet mit Abriss des 30 Jahre alten Erweiterungsbaus Neue Ambulanz der Gynäko- logie: Seit August in Betrieb. Modernisierung des Klinikums Heidenheim Seite 2 Am Montag, 18. September B1 und die Zentrale Notauf- Wirbelsäulenchirurgie im 2017, ist der Startschuss für nahme in Haus C direkte Naht- Klinikum: Behandlung von den 2. Bauabschnitt der Kli- stellen zueinander erhalten. An Verletzungen der Wirbelsäule. nikmodernisierung auf dem den bestehenden Funktions- Seite 3 Heidenheimer Schlossberg bau wird das Haus B1 auf drei gefallen. Zwischen dem al- Ebenen „-2“, „-1“, und „+1“ als Radioonkologie und ten Funktionsbau und Haus sogenannte OP-Brücke über Strahlentherapie: Was macht C wird ein achtgeschossiger direkte Übergänge verknüpft. ein Medizinphysiker? Baukörper – das Haus B1 – Seiten 4/5 entstehen. Termine Nach Ende der Abrissarbei- Schule für Gesundheits- und Im Rahmen des anstehen- ten wird die Baugrube für den 2. Krankenpflege: 14 Absolven- den 2. Bauabschnitts, der mit Bauabschnitt ausgehoben und ten bestanden ihr Examen. dem Abriss des Erweiterungs- im März 2018 ist die Grund- Seite 5 baus durch die Firma Max steinlegung vorgesehen, ab Wild GmbH, Berkheim, star- dann sollen sich die Baukräne Kinder- und Jugendmedizin: tet, werden für den Zentralen drehen. Läuft alles nach Plan, Wenn der Start ins Leben OP-Bereich, Radiologie, Apo- kann Anfang 2019 Richtfest ge- etwas holprig ist. Seite 6 theke, Zentrale Sterilgutver- feiert werden. Die Fertigstellung sorgungsabteilung sowie drei Modell des Hauses B 1, das zwischen den bestehenden Gebäuden Funktionsbau (links) und Haus C (rechts) in ist rund um den Jahreswechsel Neurologie: Informationen Pflegestationen neue Räume den kommenden rund drei Jahren in die Höhe wachsen wird. -

Linienplan-HDH Und Giengen.Pdf 1 07.11.16 14:38
Linienplan-HDH_und_Giengen.pdf 1 07.11.16 14:38 Linienplan Gesamtverkehr Landkreis Heidenheim Aalen Unterkochen Oberkochen Mörtingen Schweindorf 757 7518 51 Hohlenstein Ohmenheim Bartholomä Kösingen Königsbronn Ochsenberg Neresheim Frickingen 95 Waldsiedlung 40 Nietheim Itzelberg 52 Rotensohl Großkuchen Katzen- Hofen Zang stein Aufhausen Kleinkuchen Iggenhausen Dunstelkingen Eglingen Schnaitheim Steinweiler Auernheim Gnannen- weiler Schrez- Osterhofen Göppingen 41 51 Dischingen heim 50 Fleinheim 7688 Trugenhofen Neusel- Böhmenkirch Steinheim 7694 halden 101 Söhnstetten 30 Ballmerts- Heidenheim Nattheim hofen Ziegelhütte Reistingen Demmingen Sontheim/St. Zöschingen 7694 Gussenstadt Heuchstetten Küpfendorf 75 Waldhausen 75 68 Dattenhausen Mergelstetten Ziertheim Oggen- Schalkstetten Gerstetten Oggenh. hausen Keller 758 70 7690 Staufen Stubersheim Sontbergen 70 Altenberg Ballhausen 585 Heldenfingen 7693 C Amstetten 61 Syrgenstein Landshausen M Bolheim Bachhagel Altheim Hohen- 62 Y Heuchlingen 60 memmingen Wittislingen Dettingen Anhausen Herbrechtingen CM Söglingen Zöschlingsweiler 61 MY Giengen Ballendorf 7690 Sachsen- hausen 9097 CY Haunsheim 9098 Weidenstetten Eselsburg Hermaringen CMY Burg- Börslingen Dillingen Neen- berg Untermedlingen K stetten Hürben 7693 Brenz Bergen- Obermedlingen Holzkirch Bissingen weiler Lauingen 9105 Faimingen Hausen Echenbrunn Breitingen Sontheim Bächingen Stetten o. L. a.d. Brenz Gundelfingen 59 Niederstotzingen Oberstotzingen Asselfingen Beimerstetten Rammingen Riedhausen Langenau Bettighofer Jungingen Oberes -

Radlerzeit Km 26 Länge
www.heidenheimer-brenzregion.de Brenz-Radweg – vom Ursprung zur Donau Donau - Härtsfeld Tour Kliff Tour – auf die Gerstetter Alb Wasser & Stein – übers Härtsfeld Höhlen Tour – vom Brenztal ins Lonetal Lokalbahn-Radweg Länge: 56 km 46 m 110 m Länge: 52 km 230 m 170 m Länge: 37 km 275 m Länge: 44 km 315 m Länge: 26 km 81 m Länge: 21 km 87 m 169 m Radlerzeit Strecke: Königsbronn – Heidenheim – Herbrechtingen und Naturschutz- Strecke: Faimingen – Lauingen – Dillingen – Abzweig nach Nordwesten Strecke: Bahnhof Heidenheim – Ugental – Talhof – Ugenhof – Rüblinger Strecke: Bahnhof Heidenheim-Schnaitheim – Möhntal – Kleinkuchen – Strecke: Bahnhof Sontheim – Bergenweiler – Abkürzung über Burgberg Strecke: Bahnhof Gerstetten – Themenweg bis nach Gussenstadt – Wald- gebiet Eselsburger Tal – Giengen – Hermaringen – Sontheim (Bahnanschluss bis Wittislingen – Wittislingen – Ziertheim – Ballmertshofen – Dischingen – Hof – Heldenfingen – Gerstetten – Erpfenhausen – Küpfendorf – Steinweiler – Neresheim – Härtsfeldsee – Dischingen – Fleinheim – oder weiter nach Hermaringen – HöhlenErlebnisWelt Giengen-Hürben – hausen – Schalkstetten – Stubersheim – Bahnhof Amstetten (Anschluss Eiszeit – Urzeit für den Rücktransport) – Bächingen – Gundelfingen/Donau – Faimingen – Neresheim – Steinweiler – über Kleinkuchen nach Heidenheim Heidenheim Nattheim – Heidenheim/Brenzpark – Schnaitheim Lontal – Archäopark Vogelherd – Stetten – Niederstotzingen – Sontheim nach Stuttgart/Ulm) – verlängerbar zur Rundtour auf den ausgewiesenen Fußweg zur Brenzmündung Radwegen Von der Brenzmündung in Lauingen geht es ein Stück auf dem Donaurad- Durch die pulsierende Stadt Heidenheim geht es ins abgeschiedene Ugental, Die Tour führt übers Möhntal durch den Wald und mit sanftem Anstieg hin- Die Tour führt zunächst entlang der Brenz und bietet viele Rast- und Spiel- Vom Brenztopf in Königsbronn, einer der typischen Karstquellen der weg durch die bezaubernden Donaustädte und dann entlang der Egau und vorbei an Weiden und Wacholderheiden, auf denen Kühe, Schafe und Pferde auf aufs Härtsfeld. -

Anlaufstellen Zur Anlasslosen Testung Im Landkreis Heidenheim
Stand: 09.03.2021 Anlaufstellen zur anlasslosen Testung im Landkreis Heidenheim Symptomfreie Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher sowie das weitere Personal an Schulen, Kindertagesstätten und der Kindertagespflege haben gemäß der Teststrategie der Landesregierung Baden-Württemberg die Möglichkeit, sich auf das Vorliegen einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus testen zu lassen. Seit dem 01.03. können die Testungen NICHT MEHR in der Corona-Ambulanz auf dem Gelände des Klinikums Heideheim durchgeführt werden. Bitte nehmen Sie zur Testung immer den entsprechenden Berechtigungsschein und Ihre Pflegeerlaubnis als Nachweis Ihrer Tätigkeit mit. Eine Aufstellung der Corona-Notfallpraxen im Landkreis, in denen die Testungen stattfinden können, finden Sie hier In den Arztpraxen ist unbedingt eine telefonische Terminvereinbarung nötig! Außerdem haben wir folgende Informationen aus den einzelnen Kreisgemeinden/-städten: Wir versuchen die Liste möglichst aktuell zu halten, übernehmen aber keine Gewähr. Informieren Sie sich bitte auch selber über die öffentlichen Medien und Ihre Gemeindeverwaltung. Heidenheim Abstrichzentrum auf dem Konzerthaus-Parkplatz geplant ab dem 10.03. Mo-Fr 17:00 – 19:30 Uhr / Sa 14:00 – 17:00 Uhr Anmeldung unter www.coronatest-heidenheim.de Corona-Schwerpunktpraxen in Heidenheim: Praxis Dr. medic/IMF Klausenburg Gerd Freisler (Allgemeinmedizin) Praxis Specht und Roon (HNO) Praxis Dres. med. Maunz und Maunz (Allgemeinmedizin) Praxis Dr. med. Gisela Lapins (Innere Medizin) Praxis Dres. med. Vallerius und Rohbeck (Allgemein- und Innere Medizin) Praxis Dres. med. Blickle und Blickle (Kinder- und Jugendmedizin) Praxis Gert-Michael Gmelin (Allgemeinmedizin) Bitte vereinbaren Sie unbedingt vorher telefonisch einen Termin. Ansprechpartner in der Stadtverwaltung: David Mittner - Stadt Heidenheim Telefon: +49 7321 327-5300 [email protected] Dischingen Aktuell greifen wir auf die Strukturen der Kassenärztlichen Vereinigung bzw. -

0/12 Öffentlich-Rechtliche Vereinbarung Zur Übertragung Der
0/12 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Aufgaben der Wertermittlung nach § 1 Abs. 1 der Gutachterausschussverordnung und Bildung eines „Gemeinsamen Gutachterausschusses Heidenheim“ zwischen: 1 . der Stadt Heidenheim an der Brenz Grabenstraße 15, 89522 Heidenheim an der Brenz, vertreten durch Herrn Oberbürger- meister Bernhard Ilg und 2 . der Stadt Giengen an der Brenz Marktstraße 11, 89537 Giengen an der Brenz, vertreten durch Herrn Oberbürgermeister Dieter Henle 3 . der Stadt Herbrechtingen Lange Straße 58, 89542 Herbrechtingen, vertreten durch Herrn Bürgermeister Daniel Vogt 4 . der Gemeinde Gerstetten Wilhelmstraße 31, 89547 Gerstetten, vertreten durch Herrn Bürgermeister Roland Pola- schek 5 . der Gemeinde Steinheim am Albuch Hauptstraße 24, 89555 Steinheim am Albuch, vertreten durch Herrn Bürgermeister Hol- ger Weise 6 . der Gemeinde Königsbronn Herwartstraße 2, 89551 Königsbronn, vertreten durch Herrn Bürgermeister Michael Stütz 7 . der Gemeinde Nattheim Fleinheimer Straße 2, 89564 Nattheim, vertreten durch Herrn Bürgermeister Norbert Bereska 8 . der Gemeinde Sontheim an der Brenz Brenzer Straße 25, 89567 Sontheim an der Brenz, vertreten durch Herrn Bürgermeister Matthias Kraut 1 0/12 9 . der Stadt Niederstotzingen Im Städtle 26, 895168 Niederstotzingen, vertreten durch Herrn Bürgermeister Marcus Bremer 10 . der Gemeinde Dischingen Marktplatz 9, 89561 Dischingen, vertreten durch Herrn Bürgermeister Alfons Jakl 11 . der Gemeinde Hermaringen Karlstraße 12, 89568 Hermaringen, vertreten durch Herrn Bürgermeister Jürgen Mai- länder - nachfolgend Mitgliedsgemeinden genannt - Präambel Zur Verbesserung der gesetzlichen Aufgabenerfüllung der Gutachterausschüsse wird bei der Stadt Heidenheim ein gemeinsamer Gutachterausschuss gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 Gutachterausschussverordnung (GuAVO) für die Stadt Heidenheim und die die- ser Vereinbarung beitretenden Städte und Gemeinden des Landkreises Heidenheim (nachstehend alle „Mitgliedsgemeinden“ genannt) gebildet. -

Wanderzeit Einst Streiften Mammutjäger Durch Das Lonetal
www.heidenheimer-brenzregion.de Der Albschäferweg – Auf dem „Höhlengang“ Über die „Kuppenalb“ von Gerstetten nach Auf der „Brenzquellrunde“ zum Itzelberger Wandern auf den Spuren der Wanderschäfer vom Vogelherd zur Charlottenhöhle Gussenstadt See und über den Herwartstein Seit dem 15. Jahrhundert ist in Württemberg die Zunft der Schäfer zu nden. Länge km: 10,5 2:50 h 190 m Länge km: 16,8 4:30 h 211 m Länge km: 5,9 1:40 h 115 m In der Heidenheimer Brenzregion sind Schäfer noch als Wanderschäfer Wanderzeit Einst streiften Mammutjäger durch das Lonetal. Bei dieser Zeitspur streifen Erleben Sie 100 Jahre Eisenbahnromantik auf der Gerstetter Alb und Die Zeitspur führt vom Rathaus mit Blick auf den Brenztopf über den Klos- unterwegs. Die genügsamen Schafe bewahren die typischen Wacholder- Sie zunächst den Archäopark an der Vogelherdhöhle und wandern dann auf begeben Sie sich auf die 17 km lange Zeitspur durch eine Urmeerlandschaft. terhof zum naturbelassensten Teil des Itzelberger Sees. Einfach ein wunder- heiden, Wiesentäler und Waldränder vor Verbuschung und erhalten so die den Stettberg. Nach Querung der meist trockenen Lone geht es auf einem Zunächst geht es für alle Wanderer über den Galgenberg nach Heuchstet- schönes Fleckchen Erde, um die Seele baumeln zu lassen. Auf der anderen wertvollen Lebensräume seltener Tier- und Panzenarten. Eiszeit – Urzeit urigen Pfad hoch über dem Tal Richtung Ruine Kaltenburg. Anschließend ha- ten. Auf der Höhe über die weite Flur führt der Weg nach Gussenstadt. Hier Seite des Sees geht es auf dem Albschäferweg zur Ruine Herwartstein. Am Wandern Sie auf den Spuren der Wanderschäfer durch die Heidenheimer ben Sie die Qual der Wahl, die Charlottenhöhle besichtigen oder im Tal das im Gasthof Hirsch gibt es Hochprozentiges von heimischen Streuobstwiesen Ende der Tour statten wir dem Brenzursprung einen ausgiebigen Besuch ab Brenzregion in 10 Etappen auf 158 km. -

Heidenheim Wegweiser EINKAUFEN, BUMMELN UND GENIESSEN in SEINER SCHÖNSTEN FORM Die Schloss Arkaden in Heidenheim
1 Heidenheim Wegweiser EINKAUFEN, BUMMELN UND GENIESSEN IN SEINER SCHÖNSTEN FORM Die Schloss Arkaden in Heidenheim Die Schloss Arkaden in Heidenheim bieten einen Unser Service kann sich sehen lassen Übrigens: Mit einem Klick in der Region einzigartigen Mix aus Kaufhäusern, auf unsere Seiten: Fachgeschäften, Boutiquen, Dienstleistern, Cafés Vom Centergutschein über die P-Card, die bar- und Restaurants. Ob modische Vielfalt oder sport- rierefreie Ausstattung, einen EC-Geldautomat schloss-arkaden-heidenheim.de und liche Trends, ob elektronische Neuheiten oder - facebook.com/SchlossArkadenHeidenheim ausgefallene Geschenkideen, ob Artikel für den eigenen Parkplätzen und vielem mehr reicht das täglichen Bedarf oder gastronomische Vielfalt, Serviceangebot in den Schloss Arkaden. Über sind Sie auch zu Hause über alle das Angebot in den Arkaden lässt kaum Wünsche diese Vorteile und noch vieles mehr informieren Neuigkeiten und Aktionen schnell Sie gern unsere freundlichen Mitarbeiter an der und umfassend informiert. Center-Information im Erdgeschoss. Damit Sie unser umfassendes Angebot nutzen können, wann immer Sie möchten, sind unsere Geschäfte von Montag bis Samstag immer bis Schloss Arkaden Heidenheim Mo. – Sa. 07.00 – 21.00 Uhr In Mode sind wir ganz groß! Karlstraße 12 So. 11.00 – 18.00 Uhr 89518 Heidenheim Das Thema Mode wird in den Schloss Arkaden Telefon 0 73 21.6 60 92-0 Mo. – Sa. 09.30 – 20.00 Uhr besonders groß geschrieben. Unsere Geschäfte Telefax 0 73 21.6 60 92-18 halten ein riesiges Angebot an aktueller Damen-, [email protected] Mo.– Sa. 07.00 – 21.00 Uhr Herren und Kinderbekleidung sowie trendigen Schuhen und modischen Accessoires bereit. Wir www.schloss-arkaden-heidenheim.de So.