Sehr Geehrte Damen Und Herren, Leinerziehenden
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

2016 Annual Meetings of the Boards of Governors
THE WORLD BANK GROUP Public Disclosure Authorized 2016 ANNUAL MEETINGS OF THE BOARDS OF GOVERNORS Public Disclosure Authorized SUMMARY PROCEEDINGS Public Disclosure Authorized Washington, D.C. October 7-9, 2016 Public Disclosure Authorized THE WORLD BANK GROUP Headquarters 1818 H Street, NW Washington, D.C. 20433 U.S.A. Phone: (202) 473-1000 Fax: (202) 477-6391 Internet: www.worldbankgroup.org iii INTRODUCTORY NOTE The 2016 Annual Meetings of the Boards of Governors of the World Bank Group (Bank), which consist of the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), International Development Association (IDA), the International Finance Corporation (IFC), International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), and the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), held jointly with the International Monetary Fund (Fund), took place on October 7, 2016 in Washington, D.C. The Honorable Mauricio Cárdenas, Governor of the Bank and Fund for Colombia, served as the Chairman. In Committee Meetings and the Plenary Session, a joint session with the Board of Governors of the International Monetary Fund, the Board considered and took action on reports and recommendations submitted by the Executive Directors, and on matters raised during the Meeting. These proceedings outline the work of the 70th Annual Meeting and the final decisions taken by the Board of Governors. They record, in alphabetical order by member countries, the texts of statements by Governors and the resolutions and reports adopted by the Boards of Governors of the World Bank Group. In addition, the Development Committee discussed the Forward Look – A Vision for the World Bank Group in 2030, and the Dynamic Formula – Report to Governors Annual Meetings 2016. -

Deutscher Bundestag
Deutscher Bundestag 44. Sitzung des Deutschen Bundestages am Freitag, 27.Juni 2014 Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 4 Entschließungsantrag der Abgeordneten Caren Lay, Eva Bulling-Schröter, Dr. Dietmar Bartsch, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. zu der dritten Beratung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur grundlegenden Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und zur Änderung weiterer Bestimmungen des Energiewirtschaftsrechts - Drucksachen 18/1304, 18/1573, 18/1891 und 18/1901 - Abgegebene Stimmen insgesamt: 575 Nicht abgegebene Stimmen: 56 Ja-Stimmen: 109 Nein-Stimmen: 465 Enthaltungen: 1 Ungültige: 0 Berlin, den 27.06.2014 Beginn: 10:58 Ende: 11:01 Seite: 1 Seite: 2 Seite: 2 CDU/CSU Name Ja Nein Enthaltung Ungült. Nicht abg. Stephan Albani X Katrin Albsteiger X Peter Altmaier X Artur Auernhammer X Dorothee Bär X Thomas Bareiß X Norbert Barthle X Julia Bartz X Günter Baumann X Maik Beermann X Manfred Behrens (Börde) X Veronika Bellmann X Sybille Benning X Dr. Andre Berghegger X Dr. Christoph Bergner X Ute Bertram X Peter Beyer X Steffen Bilger X Clemens Binninger X Peter Bleser X Dr. Maria Böhmer X Wolfgang Bosbach X Norbert Brackmann X Klaus Brähmig X Michael Brand X Dr. Reinhard Brandl X Helmut Brandt X Dr. Ralf Brauksiepe X Dr. Helge Braun X Heike Brehmer X Ralph Brinkhaus X Cajus Caesar X Gitta Connemann X Alexandra Dinges-Dierig X Alexander Dobrindt X Michael Donth X Thomas Dörflinger X Marie-Luise Dött X Hansjörg Durz X Jutta Eckenbach X Dr. Bernd Fabritius X Hermann Färber X Uwe Feiler X Dr. Thomas Feist X Enak Ferlemann X Ingrid Fischbach X Dirk Fischer (Hamburg) X Axel E. -

Electoral Rules and Elite Recruitment: a Comparative Analysis of the Bundestag and the U.S
Florida International University FIU Digital Commons FIU Electronic Theses and Dissertations University Graduate School 6-27-2014 Electoral Rules and Elite Recruitment: A Comparative Analysis of the Bundestag and the U.S. House of Representatives Murat Altuglu Florida International University, [email protected] DOI: 10.25148/etd.FI14071144 Follow this and additional works at: https://digitalcommons.fiu.edu/etd Recommended Citation Altuglu, Murat, "Electoral Rules and Elite Recruitment: A Comparative Analysis of the Bundestag and the U.S. House of Representatives" (2014). FIU Electronic Theses and Dissertations. 1565. https://digitalcommons.fiu.edu/etd/1565 This work is brought to you for free and open access by the University Graduate School at FIU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in FIU Electronic Theses and Dissertations by an authorized administrator of FIU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY Miami, Florida ELECTORAL RULES AND ELITE RECRUITMENT: A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE BUNDESTAG AND THE U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in POLITICAL SCIENCE by Murat Altuglu 2014 To: Interim Dean Michael R. Heithaus College of Arts and Sciences This dissertation, written by Murat Altuglu, and entitled Electoral Rules and Elite Recruitment: A Comparative Analysis of the Bundestag and the U.S. House of Representatives, having been approved in respect to style and intellectual -

Plenarprotokoll 19/229
Plenarprotokoll 19/229 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 229. Sitzung Berlin, Mittwoch, den 19. Mai 2021 Inhalt: Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Stefan Keuter (AfD) . 29247 C nung . 29225 B Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29247 C Absetzung der Tagesordnungspunkte 8, 9, 10, Stefan Keuter (AfD) . 29247 D 16 b, 16 e, 21 b, 33, 36 und 39 . 29230 C Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29247 D Ausschussüberweisungen . 29230 D Sepp Müller (CDU/CSU) . 29248 A Feststellung der Tagesordnung . 29232 B Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29248 B Sepp Müller (CDU/CSU) . 29248 C Zusatzpunkt 1: Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29248 C Aktuelle Stunde auf Verlangen der Fraktio- Christian Dürr (FDP) . 29248 D nen der CDU/CSU und SPD zu den Raketen- angriffen auf Israel und der damit verbun- Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29249 A denen Eskalation der Gewalt Christian Dürr (FDP) . 29249 B Heiko Maas, Bundesminister AA . 29232 B Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29249 C Armin-Paulus Hampel (AfD) . 29233 C Dr. Wieland Schinnenburg (FDP) . 29250 A Dr. Johann David Wadephul (CDU/CSU) . 29234 C Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29250 A Alexander Graf Lambsdorff (FDP) . 29235 C Dorothee Martin (SPD) . 29250 B Dr. Gregor Gysi (DIE LINKE) . 29236 C Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29250 B Omid Nouripour (BÜNDNIS 90/ Dorothee Martin (SPD) . 29250 C DIE GRÜNEN) . 29237 C Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29250 D Dirk Wiese (SPD) . 29238 C Lisa Paus (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . 29250 D Dr. Anton Friesen (AfD) . 29239 D Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29251 A Jürgen Hardt (CDU/CSU) . 29240 B Dr. Gesine Lötzsch (DIE LINKE) . 29251 C Kerstin Griese (SPD) . -

Deutscher Bundestag
Plenarprotokoll 19/183 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 183. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 8. Oktober 2020 Inhalt: Wahl der Abgeordneten Leni Breymaier, Kay Fritz Güntzler (CDU/CSU) . 22951 D Gottschalk, Jan Ralf Nolte und Martin Markus Herbrand (FDP) . 22953 C Hohmann als Schriftführer . 22943 A Änderungen der Tagesordnung . 22943 B Fabio De Masi (DIE LINKE) . 22954 A Absetzung der Tagesordnungspunkte 18 b und Lisa Paus (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . 22954 D 33 s . 22943 B Michael Schrodi (SPD) . 22955 D Sebastian Brehm (CDU/CSU) . 22956 C Tagesordnungspunkt 26: Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Tagesordnungspunkt 10: Umsetzung der Richtlinien (EU) 2019/878 Antrag der Abgeordneten René Springer, und (EU) 2019/879 zur Reduzierung von Dr. Bernd Baumann, Stephan Brandner, wei- Risiken und zur Stärkung der Proportiona- terer Abgeordneter und der Fraktion der AfD: lität im Bankensektor (Risikoreduzierungs- Inländische Arbeitskräfte zuerst – Falsche gesetz – RiG) Weichenstellungen des Fachkräfteeinwan- Drucksache 19/22786 . 22943 B derungsgesetzes rückgängig machen Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 22943 C Drucksache 19/23132 . 22957 D Dr. Bruno Hollnagel (AfD) . 22944 C René Springer (AfD) . 22957 D Alexander Radwan (CDU/CSU) . 22945 B Dr. Mathias Middelberg (CDU/CSU) . 22958 D Dr. Florian Toncar (FDP) . 22946 B Linda Teuteberg (FDP) . 22960 A Jörg Cezanne (DIE LINKE) . 22947 A Dr. Lars Castellucci (SPD) . 22961 C Lisa Paus (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . 22947 C Susanne Ferschl (DIE LINKE) . 22962 C Johannes Schraps (SPD) . 22948 B Filiz Polat (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . 22963 A Sepp Müller (CDU/CSU) . 22949 A Peter Weiß (Emmendingen) (CDU/CSU) . 22964 A René Springer (AfD) . 22964 C Tagesordnungspunkt 27: Dr. -
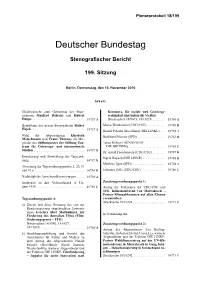
Plenarprotokoll 18/199
Plenarprotokoll 18/199 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 199. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 10. November 2016 Inhalt: Glückwünsche zum Geburtstag der Abge- Kommerz, für soziale und Genderge- ordneten Manfred Behrens und Hubert rechtigkeit und kulturelle Vielfalt Hüppe .............................. 19757 A Drucksachen 18/8073, 18/10218 ....... 19760 A Begrüßung des neuen Abgeordneten Rainer Marco Wanderwitz (CDU/CSU) .......... 19760 B Hajek .............................. 19757 A Harald Petzold (Havelland) (DIE LINKE) .. 19762 A Wahl der Abgeordneten Elisabeth Burkhard Blienert (SPD) ................ 19763 B Motschmann und Franz Thönnes als Mit- glieder des Stiftungsrates der Stiftung Zen- Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/ trum für Osteuropa- und internationale DIE GRÜNEN) ..................... 19765 C Studien ............................. 19757 B Dr. Astrid Freudenstein (CDU/CSU) ...... 19767 B Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Sigrid Hupach (DIE LINKE) ............ 19768 B nung. 19757 B Matthias Ilgen (SPD) .................. 19769 A Absetzung der Tagesordnungspunkte 5, 20, 31 und 41 a ............................. 19758 D Johannes Selle (CDU/CSU) ............. 19769 C Nachträgliche Ausschussüberweisungen ... 19759 A Gedenken an den Volksaufstand in Un- Zusatztagesordnungspunkt 1: garn 1956 ........................... 19759 C Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD: Klimakonferenz von Marrakesch – Pariser Klimaabkommen auf allen Ebenen Tagesordnungspunkt 4: vorantreiben Drucksache 18/10238 .................. 19771 C a) -

Drucksache 19/21376
Deutscher Bundestag Drucksache 19/21376 19. Wahlperiode 30.07.2020 Unterrichtung durch die Delegation der Bundesrepublik Deutschland in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates Tagung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates vom 21. bis 25. Januar 2019 in Straßburg Inhaltsverzeichnis Seite I. Delegationsmitglieder ........................................................................ 2 II. Einführung ......................................................................................... 5 III. Ablauf der 1. Sitzungswoche 2019 .................................................... 6 III.1 Wahlen und Geschäftsordnungsfragen ................................................ 7 III.2 Schwerpunkte der Beratungen ............................................................. 8 III.3 Auswärtige Redner .............................................................................. 20 IV. Tagesordnung der 1. Sitzungswoche 2019 ....................................... 24 V. Verabschiedete Empfehlungen und Entschließungen .................... 29 VI. Reden deutscher Delegationsmitglieder ........................................... 69 VII. Berichterstattermandate deutscher Mitglieder ............................... 79 VIII. Funktionsträgerinnen und -träger in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates ........................................................ 80 IX. Sitzung des Ständigen Ausschusses in Helsinki............................... 82 X. Mitgliedsländer des Europarates .................................................... -

Plenarprotokoll 19/167
Plenarprotokoll 19/167 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 167. Sitzung Berlin, Freitag, den 19. Juni 2020 Inhalt: Tagesordnungspunkt 26: Zusatzpunkt 25: a) Erste Beratung des von den Fraktionen der Erste Beratung des von den Fraktionen der CDU/CSU und SPD eingebrachten Ent- CDU/CSU und SPD eingebrachten Entwurfs wurfs eines Zweiten Gesetzes zur Umset- eines Gesetzes über begleitende Maßnah- zung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur men zur Umsetzung des Konjunktur- und Bewältigung der Corona-Krise (Zweites Krisenbewältigungspakets Corona-Steuerhilfegesetz) Drucksache 19/20057 . 20873 D Drucksache 19/20058 . 20873 B in Verbindung mit b) Erste Beratung des von der Bundesregie- rung eingebrachten Entwurfs eines Zwei- ten Gesetzes über die Feststellung eines Zusatzpunkt 26: Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und für das Haushaltsjahr 2020 (Zweites SPD: Beschluss des Bundestages gemäß Ar- Nachtragshaushaltsgesetz 2020) tikel 115 Absatz 2 Satz 6 und 7 des Grund- Drucksache 19/20000 . 20873 B gesetzes Drucksache 19/20128 . 20874 A c) Antrag der Abgeordneten Kay Gottschalk, Marc Bernhard, Jürgen Braun, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD: in Verbindung mit Arbeitnehmer, Kleinunternehmer, Frei- berufler, Landwirte und Solo-Selbstän- Zusatzpunkt 27: dige aus der Corona-Steuerfalle befreien Antrag der Abgeordneten Dr. Dirk Spaniel, und gleichzeitig Bürokratie abbauen Wolfgang Wiehle, Leif-Erik Holm, weiterer Drucksache 19/20071 . 20873 C Abgeordneter und der Fraktion der AfD: d) Antrag der Abgeordneten Caren Lay, Deutscher Automobilindustrie zeitnah hel- Simone Barrientos, Dr. Gesine Lötzsch, fen, Bahnrettung statt Konzernrettung, Be- weiterer Abgeordneter und der Fraktion richte des Bundesrechnungshofs auch in DIE LINKE: Clubs und Festivals über der Krise beachten und umsetzen die Corona-Krise retten Drucksache 19/20072 . -

Plenarprotokoll 17/126
Plenarprotokoll 17/126 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 126. Sitzung Berlin, Mittwoch, den 21. September 2011 Inhalt: Erweiterung der Tagesordnung . 14789 A Dr. Gerd Müller, Parl. Staatssekretär BMELV . 14793 A Streichung der Tagesordnungspunkte 13 und 16 14789 C Nicole Maisch (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) . 14793 A Tagesordnungspunkt 1: Dr. Gerd Müller, Parl. Staatssekretär Befragung der Bundesregierung: Waldstra- BMELV . 14793 B tegie 2020 – Internationales Jahr der Wäl- Georg Schirmbeck (CDU/CSU) . 14793 B der 2011 . 14789 C Dr. Gerd Müller, Parl. Staatssekretär Dr. Gerd Müller, Parl. Staatssekretär BMELV . 14793 B BMELV . 14789 D Ulrich Kelber (SPD) . 14793 C Cajus Caesar (CDU/CSU) . 14790 D Dr. Gerd Müller, Parl. Staatssekretär Dr. Gerd Müller, Parl. Staatssekretär BMELV . 14793 D BMELV . 14791 A Hartwig Fischer (Göttingen) (CDU/CSU) . 14793 D Cornelia Behm (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) . 14791 A Dr. Gerd Müller, Parl. Staatssekretär BMELV . 14794 A Dr. Gerd Müller, Parl. Staatssekretär BMELV . 14791 B Alexander Süßmair (DIE LINKE) . 14794 A Dr. Christel Happach-Kasan (FDP) . 14791 C Dr. Gerd Müller, Parl. Staatssekretär BMELV . 14794 B Dr. Gerd Müller, Parl. Staatssekretär BMELV . 14791 D Cajus Caesar (CDU/CSU) . 14794 C Petra Crone (SPD) . 14792 A Dr. Gerd Müller, Parl. Staatssekretär BMELV . 14794 C Dr. Gerd Müller, Parl. Staatssekretär BMELV . 14792 A Harald Ebner (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) . 14794 D Franz-Josef Holzenkamp (CDU/CSU) . 14792 B Dr. Gerd Müller, Parl. Staatssekretär Dr. Gerd Müller, Parl. Staatssekretär BMELV . 14795 A BMELV . 14792 B Petra Crone (SPD) . 14795 B Dr. Kirsten Tackmann (DIE LINKE) . 14792 C Dr. Gerd Müller, Parl. Staatssekretär Dr. Gerd Müller, Parl. Staatssekretär BMELV . 14795 B BMELV . -

Der Ausschuss Für Ernährung Und Landwirtschaft
35 Friedrich Ostendorff, BÜNDNIS 90 / 6 24 DIE GRÜNEN Der Ausschuss für Ernährung Rita Stockhofe, 13 Willi Brase, 32 stellvertretender 3 CDU/CSU 8 Marlene Mortler, 22 SPD Dr. Kirsten Vorsitzender und Landwirtschaft Carola Stauche, Mitarbeiterin Kordula Kovac, 11 CDU/CSU 17 Elvira Großhandels Tackmann, Bauer, CDU/CSU im landwirtschaft CDU/CSU Dieter Stier, Meisterin der Peter Bleser DrobinskiWeiß, kaufmann, DIE LINKE. geb. 12.1.1953 Verwaltungs lichen Familien Geschäftsführerin, CDU/CSU ländlichen Parlamentarischer SPD Sozialpädagoge, 27 30 Obfrau in Dortmund; fachwirtin, unternehmen, geb. 22.10.1957 DiplomAgrar Hauswirtschaft, Staatssekretär beim DiplomPädagogin, Gewerkschafts Rainer Spiering, Ursula Schulte, Tierärztin, verheiratet, geb. 10.5.1952 geb. 1.11.1967 in Welschen Ennest; ingenieur, geb. 16.10.1955 Bundesminister für Rektorin, sekretär, SPD SPD geb. 24.9.1960 ein Kind. in Arnsgereuth; in Haltern; verheiratet, geb. 29.6.1964 in Lauf; Ernährung und geb. 26.6.1951 geb. 10.10.1951 Oberstudienrat, Hausfrau, in Schmalkalden; MdB 2002 bis 2005 verheiratet, verheiratet, zwei Kinder. in Weißenfels; verheiratet, Landwirtschaft in Norderney; in Petershagen; geb. 27.1.1956 geb. 9.8.1952 verheiratet, und seit 2009 zwei Kinder. sechs Kinder. MdB seit 2013 ledig. drei Kinder. verheiratet. verheiratet, in Dissen; in Alstätte; zwei Kinder. Im Deutschen Bundestag werden Entscheidungen über MdB seit 2009 MdB seit 2013 MdB seit 2009 MdB seit 2002 15 18 MdB seit 2004 zwei Kinder. verheiratet, verheiratet, MdB seit 2005 36 zum Teil sehr komplexe und strittige Gesetzesvorhaben 5 9 10 Katharina Landgraf, Alois Gerig, 21 MdB seit 1998 drei Kinder. 29 zwei Kinder. Harald Ebner, und über parlamentarische Initiativen aus allen Politik 1 2 4 Artur 7 Waldemar Kees de Vries, 12 14 CDU/CSU 16 CDU/CSU Dr. -

Landesliste Für Die Wahl Zum Beschlossen Am: 05.06.2021 Deutschen Bundestag 2021
CDU in Niedersachsen Landesliste für die Wahl zum Beschlossen am: 05.06.2021 Deutschen Bundestag 2021 Nr. Name Beruf Wohnort WK-Nr. und Bezeichnung Vorschlag 1 Dr. Hendrik Hoppenstedt MdB Staatsminister, Bundestagsabgeordneter Burgwedel 043: Hannover-Land I BV Hannover 2 Michael Grosse-Brömer MdB Rechtsanwalt, Bundestagsabgeordneter Brackel 036: Harburg BV Nordostniedersachsen 3 Gitta Connemann MdB Rechtsanwältin, Bundestagsabgeordnete Hesel 025: Unterems BV Ostfriesland, FU 4 Dr. Mathias Middelberg MdB Rechtsanwalt, Bundestagsabgeordneter Osnabrück 039: Stadt Osnabrück BV Osnabrück-Emsland Parlamentarischer Staatssekretär, 5 Enak Matthias Ferlemann MdB Cuxhaven 029: Cuxhaven – Stade II BV Elbe-Weser Bundestagsabgeordneter 026: Friesland – Wilhelmshaven – LV Oldenburg / BV 6 Anne Janssen Lehrerin Wittmund Wittmund Ostfriesland, FU 7 Tilman Kuban Unternehmensjurist / Rechtsanwalt Barsinghausen 047: Hannover-Land II Junge Union (BV Hannover) Bankkaufmann, Rechtsanwalt, 8 Carsten Müller MdB Braunschweig 050: Braunschweig LV Braunschweig Bundestagsabgeordneter 9 Mareike Lotte Wulf MdL Geschäftsführerin Emmerthal 046: Hameln-Pyrmont – Holzminden BV Hannover, FU Bundestagsabgeordneter, Steuerberater und 10 Fritz Güntzler MdB Göttingen 053: Göttingen BV Hildesheim Wirtschaftsprüfer Stephan Theodor Johannes 11 Bundestagsabgeordneter Bad Zwischenahn 027: Oldenburg – Ammerland LV Oldenburg Albani MdB Hauswirtschaftsleiterin, 12 Ingrid Pahlmann MdB Gifhorn 45: Gifhorn-Peine BV Nordostniedersachsen, FU Bundestagsabgeordnete 13 Henning Otte MdB Bundestagsabgeordneter -

20210421 6-Data.Pdf
Deutscher Bundestag 223. Sitzung des Deutschen Bundestages am Mittwoch, 21. April 2021 Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 6 Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD Entwurf eines Vierten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite - Drs. 19/28444, 19/28692 und 19/28732 Abgegebene Stimmen insgesamt: 656 Nicht abgegebene Stimmen: 53 Ja-Stimmen: 342 Nein-Stimmen: 250 Enthaltungen: 64 Ungültige: 0 Berlin, den 21.04.2021 Beginn: 14:53 Ende: 15:27 Seite: 1 Seite: 2 Seite: 2 CDU/CSU Name Ja Nein Enthaltung Ungült. Nicht abg. Dr. Michael von Abercron X Stephan Albani X Norbert Maria Altenkamp X Peter Altmaier X Philipp Amthor X Artur Auernhammer X Peter Aumer X Dorothee Bär X Thomas Bareiß X Norbert Barthle X Maik Beermann X Manfred Behrens (Börde) X Veronika Bellmann X Sybille Benning X Dr. André Berghegger X Melanie Bernstein X Christoph Bernstiel X Peter Beyer X Marc Biadacz X Steffen Bilger X Peter Bleser X Norbert Brackmann X Michael Brand (Fulda) X Dr. Reinhard Brandl X Dr. Helge Braun X Silvia Breher X Sebastian Brehm X Heike Brehmer X Ralph Brinkhaus X Dr. Carsten Brodesser X Gitta Connemann X Astrid Damerow X Alexander Dobrindt X Michael Donth X Marie-Luise Dött X Hansjörg Durz X Thomas Erndl X Dr. Dr. h. c. Bernd Fabritius X Hermann Färber X Uwe Feiler X Enak Ferlemann X Axel E. Fischer (Karlsruhe-Land) X Dr. Maria Flachsbarth X Thorsten Frei X Dr. Hans-Peter Friedrich (Hof) X Maika Friemann-Jennert X Michael Frieser X Hans-Joachim Fuchtel X Ingo Gädechens X Dr.