Chorliteraturkunde
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
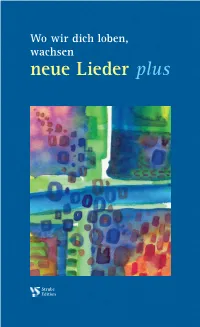
Neue Lieder Plus
Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder plus Strube Edition ALPHABETISCHES VERZEICHNIS Accorde-nous la paix .............. 202 Christe, der du trägst Adieu larmes, peines .............. 207 die Sünd der Welt .................. 110 Aimer, c’est vivre .................... 176 Christ, ô toi qui portes Allein aus Glauben ................. 101 nos faiblesses ........................ 110 Allein deine Gnade genügt ....102 Christ, ô toi visage de Dieu .... 111 Alléluia, Venez chantons ........ 174 Christus, Antlitz Gottes ........... 111 Alles, was atmet .................... 197 Christus, dein Licht .................. 11 Amazing love ......................... 103 Christus, Gottes Lamm ............ 12 Amen (K) ............................... 104 Christus, höre uns .................... 13 An den Strömen von Babylon (K) ... 1 Christ, whose bruises An dunklen, kalten Tagen ....... 107 heal our wounds ................... 111 Anker in der Zeit ...................... 36 Con alegria, Atme in uns, Heiliger Geist ..... 105 chantons sans barrières ......... 112 Aube nouvelle dans notre nuit .. 82 Con alegria lasst uns singen ... 112 Auf, Seele, Gott zu loben ........ 106 Courir contre le vent ................. 40 Aus den Dörfern und aus Städten .. 2 Croix que je regarde ............... 170 Aus der Armut eines Stalles ........ 3 Danke für die Sonne .............. 113 Aus der Tiefe rufe ich zu dir ........ 4 Danke, Vater, für das Leben .... 114 Avec le Christ ........................... 70 Dans la nuit Bashana haba’a ..................... 183 la parole de Dieu (C) .............. 147 Behüte, Herr, Dans nos obscurités ................. 59 die ich dir anbefehle .............. 109 Das Leben braucht Erkenntnis .. 14 Bei Gott bin ich geborgen .......... 5 Dass die Sonne jeden Tag ......... 15 Beten .................................... 60 Das Wasser der Erde .............. 115 Bis ans Ende der Welt ................ 6 Da wohnt ein Sehnen Bist du mein Gott ....................... 7 tief in uns .............................. 116 Bist zu uns wie ein Vater ........... -
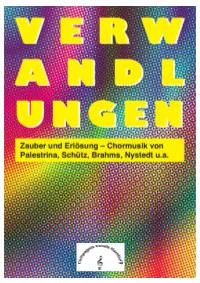
CV Programm 2017.Pdf
- 2 - Inhalt • Programm............................................................................. 4 • Texte mit Übersetzungen........................................................ 5 • Angaben zu den Komponisten............................................... 10 • Informationen zu Chorleiter und Chor..................................... 14 - 3 - Verwandlungen Seit Urzeiten fasziniert den Menschen die Vorstellung der Verwandlung: Der Gläubige hofft auf die geistliche Umwandlung durch Gott; in der Litera- tur, besonders in Sagen und Märchen, begegnen uns Verwandlungen als Fluch und Erlösung, als gerechte Strafe oder Belohnung für unser Tun. Was auch immer wir fürchten oder hoffen: Wir schaffen die Transformation nicht selbst. Es braucht eine besondere Kraft, damit wir anders oder ein an- derer werden – den Glauben an eine höhere Instanz, Zaubertränke, Wun- der. Die Musik selbst ist auf unerklärliche Weise magisch. Sie besitzt die Wirk- macht, uns zu verwandeln, zu verzaubern. Sie dient in unserem Konzert- programm als Medium, um von Verwandlungen zu erzählen und deren in- nere oder äußere Prozesse erlebbar zu machen. - 4 - Programm Giovanni Pierluigi di Palestrina (1525-1594) Sicut cervus Alessandro Scarlatti (1660-1725) Exultate deo Heinrich Schütz (1585-1672) Das ist je gewisslich wahr Rolf Schweizer (1936-2016) Der Herr ist mein Hirte (Psalm 23) Johannes Brahms (1833-1897) Vineta, op.42, 2 Verlorene Jugend, op.104, 4 Knut Nystedt (1915-2014) Die Güte des Herrn Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901) Kyrie - Agnus dei aus: Missa in Es (Cantus Missae op.109) für zwei vierstimmige Chöre Ola Gjeilo (geb. 1978) Unicornis captivatur (2001) - 5 - Giovanni Pierluigi di Palestrina Sicut Cervus Sicut cervus desiderat Wie der Hirsch schreit ad fontes aquarum, nach frischem Wasser, ita desiderat anima mea so schreit meine Seele, ad te, Deus. Gott, zu Dir. Alessandro Scarlatti Exultate Deo Exultate Deo, Frohlocket dem Herrn, adiutori nostro. -

Lieder-Liste 140130 Für Geplante Cusic-Mappe Mit Quellen
Inhaltsverzeichnis der geplanten Cusic-Mappe 1-220 (01/2014) Quelle der Vorlage [mit Lied-Nr.] : Kzg. : Kreuzungen [von Martin Müller, Sasbach] E&H : Erdentöne-Himmelsklang [Schwabenv.] SmH : Singt mit Herz [Druck Hartmann, Han.] € pro€ pro€ pro€ pro€ pro€ pro€ pro …) …) …) …) …) …) …) k+s : kommt und singt [Erzbistum Köln] GL : Neues Gotteslob [Bistümer Deutschlands] LZ : Liederzettel sehr unterschiedlicher Herkunft AnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlder Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen TonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonart : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle KostenKostenKostenKostenKostenKostenKostenKosten(7.-(7.-(7.-(7.-(7.-(7.-(7.-(7.- Nr. Liedtitel Quelle Autoren : Text / Musik Copyright ( ggf. Text / Musik ) s = € Bem. Hanna Lam / Wim ter Burg | Verlag G. F. Callenbach, Nijkerk NL | 113 Abraham, Abraham, verlass dein Land k+s 351 1 = dt. Übertr. Diethard Zils Gustav Bosse Verlag, Regensburg 032 Alle Knospen springen auf Kzg 11 Wilhelm Willms / Ludger Edelkötter KIMU Kindermusikverlag GmbH, Pullheim 1 = 143 Amen ! Amen ! Kzg 14 Spiritual 1 4+ 174 Ameni, Amen - All ihr Werke lobt -

Programm Samstag, 11
PROGRAMM Samstag, 11. Oktober 2014 Hangar 2, Flughafen Tempelhof 1 Inhalt Grußwort 2 10 Thesen »Begabt leben – Mutig verändern« Nun halten Sie das Programm unseres Perspektivkongresses in der Hand. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammen an der Zukunft unserer Kirche zu arbeiten. Monate der Planungen 6 Programm und der Absprachen liegen hinter uns. Wir sind dankbar für 6 09.00 – 10.00 Uhr Ankommen und Anmeldung das große Engagement, das uns auf dem Weg zum Kongress 6 10.00 – 10.05 Uhr Begrüßung begleitet hat. 8 10.05 – 10.45 Uhr Bibelgespräche zu Mt. 5,13 f Jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns an diesem WERKTAG 2014 9 10.45 – 11.15 Uhr Szenische Lesung an die Arbeit machen und miteinander feiern. Die Zukunft liegt vor uns. Wir wissen nicht genau, was morgen sein wird, 9 11.15 – 12.15 Uhr »Begabt leben – Mutig verändern« doch wir können mit unserem Kongress zeigen, dass wir eine 9 12.15 – 13.30 Uhr Mittagessen reformatorische Kirche sind, die bereit ist, sich zu verändern. 9 13.30 – 14.00 Uhr Gemeinsames Singen Unsere Perspektiven sind unterschiedlich. Wir kommen aus allen Regionen unserer Landeskirche und bringen sehr 10 14.00 – 16.00 Uhr Weltcafé: Kirche morgen – so! verschiedene Lebensentwürfe in diesem Raum zusammen. 16 16.00 – 16.30 Uhr Das haben wir gehört … Wir sind eine Landeskirche, die die größte Metropole 16 16.30 – 17.00 Uhr Gestärkt werden – Brot teilen Deutschlands in ihren Grenzen weiß, aber auch sehr ländlich 16 17.00 Uhr Segen und Sendung geprägte Regionen umfasst. -

Glauben Hoffen Singen Einsichten Wagen
glauben hoffen singen Einsichten wagen ... Version 2 � Entstehungsweise "glauben hoffen singen" - Zitat aus dem Vorwort: „Mit einer hohen Fachkompetenz hat ein Team aus Musikern und Theologen die Lieder ausgewählt und an Wort, Melodie und Satz gearbeitet. … Jetzt ist jeder Einzelne und mit ihm jede Gemeinde aufgerufen, mit dem neuen Gesangbuch in das Lob Gottes einzustimmen …“ Zum Vergleich hierzu das neue Liederbuch "Singt unserm Gott" aus Österreich*, Zitat aus dem Vorwort: SINGT UNSERM „Sogleich nach dem Beschluss vom April 2009 wurden die Adventgemeinden GOTT Österreichs über dieses Projekt informiert und um Vorschläge gebeten. … Der Arbeitskreis beschäftigte sich etwa ein Jahr lang mit diesen Vorschlägen, sichtete sie und sortierte aus. Das Endergebnis ist, dass jede Gemeinde viele ihrer Vorschläge in diesem neuen Liederbuch wiederfinden wird.“ *Dieser Vergleich soll nicht als Werbung für dieses Liederbuch gelten. Liederquellen 268 Wir loben Gott 199 Leben aus der Quelle 84 Feiert Jesus (versch. Bände) 16 "Die Gesänge aus Taizé" (4 lateinisch) Leben aus der Quelle Wir loben Gott 7 neue Lieder von adventistischen Autoren 7 Kirchentagsliederheft 2011/2013 5 Seventh-Day Adventist Hymnal nicht-adventistische Quellen 5 Ökum. Kirchentagsliederheft 2003/2013 1 Zionslieder 1935 1 Ökumenisches Liederbuch 95 weitere nichtadventistische Quellen adv. Quellen www.glauben-hoffen-singen.de/de/verzeichnisse.html Leben aus der Quelle, 306 Wir loben Gott munterwegs 1-3 71 neue Lieder von adventistischen Autoren 46 Seventh-day Adventist Hymnal 38 Leben aus der Quelle 23 Zionsliederbuch nicht-adventistische Wir loben Gott 18 Ich will dir danken Quellen 17 Munterwegs 1-3 11 Internationales Gesangbuch SINGT UNSERM 8 Norwegisches Liederbuch GOTT 7 Unser Liederbuch traditionelle und neue 6 Hymnes et Louanges adventist. -

Die St.Galler Singtaglieder
Die St.Galler Singtaglieder www.ref-sg.ch/musik Titel Autor/-innen Singtag Am Abend der Welt C. Rüttlinger / D. Plüss 2011 Anker in der Zeit Albert Frey 2009 Atem Gottes Albert Frey 2012 Bei dir ist die Quelle des Lebens Monika und Reto Frischknecht 2014 Beten Christoph Zehendner / Manfred Staiger 2020 Bi an den Himmel René Schärer 2020 Bleib bei uns Martin Buchholz 2019 Bliib e treu Patrick Rufer 2012 Christus lebt! Natasha Hausammann 2014 Brich ein – brich auf Esther Wild-Bislin / Roman Bislin-Wild 2014 Da berühren sich Himmel und Erde Thomas Laubach 2009 Danke (für diesen Festtag heute) Unbekannt / Martin G. Schneider 2012 Danke für alles, was du gibst, Herr Albert Frey 2012 Da wohnt ein Sehnen Anne Quigley / Eugen Eckert 2019 Das wünsch ich dir Martin Buchholz 2011 Dein Herz fürchte sich nicht Martin Buchholz 2015 Dein Wort ist ein Licht (Thy Word) Amy Grant / M.W.Smith 2009 Der Herr segne dich Martin Pepper 2010 Der Herr segne dich (Stäheli) Irene Stäheli 2014 Der Herr ist mein Hirte Mitch Schlüter / Timo Böcking / 2020 Jelena Herder Die Zeit ist reif Christoph Zehendner / 2014 Andreas Hausammann Du Albert Frey 2009 Du bisch willkomme, du ghörsch dezue Roland Pöschl 2014 Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt Martin Pepper 2010 Du bist ewig M. Lönnebo / C. Bittlinger / J. Denke / 2014 D. Plüss Du bist heilig Fritz Baltruweit / Per Harling 2010 Du bist mein Zufluchtsort Michael Lender / Gitta Leuscher 2012 Durch das Dunkel Hans-Jürgen Netz / Christoph Lehmann 2012 Du hast Erbarmen Albert Frey 2010 Es Gschänk vom Himmel Andrew Bond -

Basisinformationen Zum „Neuen Geistlichen Lied” (Ngl)
PETER DECKERT , KÖLN : NGL BASISINFORMATIONEN ZUM „NEUEN GEISTLICHEN LIED” (NGL) Inhalt der Blätter: • Zitatensammlung : Singen und Musik im Gottesdienst (2 Seiten) • Das NGL: Strukturanalyse (Schaubild) (1 Seite) • Das NGL: Definitionsversuche (3 Seiten) • Was heißt „ neu " beim Neuen Geistlichen Lied? (2 Seiten) • Zum Begriff „Neues Geistliches Lied (NGL)“ (2 Seiten) • Übersicht: „Neues Geistliches Lied" und „Rhythmische Kirchenmusik" im Gesamtfeld religiöser Popularmusik (1 Seite) • Übersicht: Entwicklungsgeschichte der Neueren religiösen Popularmusik (NGL) 1950-1980 (1 S.) • Das NGL: Charakteristische Merkmale (2 Seiten) • Das NGL: Musikalische Merkmale (1 Seite)) • Das NGL: Stilrichtungen (3 Seiten) • Die Formgestalten des NGL und ihre Auswirkung auf das Singen der Gemeinde (2 Seiten) • Die Diskussion um das NGL: Versuch einer Systematisierung Pro und Contra (2 Seiten) • Ausführung von NGL im Kirchenraum und im Gottesdienst: Kleine Praxisproblem-Liste (2 Seiten) • Acht grundlegende Beobachtungen zur Situation des NGL (nach Eugen Eckert) (1 Seite) • Kriterien zur Analyse und Beurteilung von NGL (Der „AK SINGLES-Kriterienkatalog ", mit Einführung) (2+2 Seiten) • Empfehlenswerte Sammlungen von NGL (Liederbücher, Liedblätter) (3 Seiten) • Verlage und Gruppen , die NGL produzieren (Auswahl) (2 Seiten) • „NGL“ im Internet (1 Seite) • NGL-Literatur (Linkhinweis) (1 Seite) .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- HINWEISE: 1 Diese „Basisinformationen" sind ursprünglich 1984 als Arbeitsblätter für Seminare entstanden und wurden spä- ter – größtenteils aktualisiert – über diese Zweckbestimmung hinaus in vorliegender Form veröffentlicht. 2. Die Quellenangabe "Thomas Fischer" auf einigen Blättern steht für: Fischer, Thomas: Zur Problematik des Neuen Geistlichen Liedes in seiner gottesdienstlichen Funktion. Schriftli- che Hausarbeit zur 1. Staatsprüfung für das Lehramt an der Primarstufe, Universität Düsseldorf, Abt. Neuss, Seminar für Musik und ihre Didaktik. 1984 3. Zitation dieser Blätter wie folgt erbeten: Peter Deckert: Basisinformationen zum Neuen Geistlichen Lied. -

Lieder Evang. Reformierter Kirchenchor Der March
Lieder Evang. reformierter Kirchenchor der March Liedtitel Komponist Buchtitel Lied Mappe A Ach, arme Welt Johannes Brahms Chorbuch Grün 1 Ach, Gott und Herr Hans Chemin-Petit Chorbuch 68 34 Ade zur guten Nacht Hermann Stern Geselliges Singen 3 368 Adeste fideles, Herbei oh ihr Gläubigen Hubert Meister Mappe 142 Advent-Jodler Lorenz Maierhofer Mappe 148 Aennchen von Tharau ist, die mir gefällt Friedrich Silcher Geselliges Singen 3 365 Agnus Die, Gottes lamm der du trägst Per Gunnar Petersson Chorheft 2014 12 All I Want is a Room Somewhere Frederick Loewe Geselliges Singen 3 348 All mein Gedanken, die ich hab, die sind bei dir Johannes Brahms Geselliges Singen 3 362 All Morgen ist ganz frisch und neu Hermann Schroeder Musikbeilage 77 91 All Morgen ist ganz frisch und neu Adolf Strube Chorbuch 68 9 All Morgen ist ganz frisch und neu Johann Walter Musikbeilage 36 3 Alle eure Sorgen werfet auf ihn Matthias Blumer Musikbeilage 89 1 Alle guten Gaben Heinz Lau Geselliges Singen 2 153 Alle guten Gaben kommt her von Gott Anonymus Geselliges Singen 2 155 Alle Welt lobe den Herrn J.Safford Smith Mappe Allein auf Gottes Wort Joseph Rheinberger Mappe 114 Allein Gott in der Höh sei Ehr Johann Sebastian Bach Bachbuch 4 Allein Gott in der Höh sei Ehr Hugo Distler Chorheft 74 2 Allein Gott in der Höh sei Ehr Hans Leo Hassler Musikbeilage 35 10 Allein Gott in der Höh sei Ehr Michael Prätorius Chorbuch 68 10 Allein Gott in der Höh sei Ehr Friedrich Zipp Musikbeilage 67 2 Allein Gott in der Höh sei Ehr I Felix Mendelssohn Bartholdy Chorbuch Grün 12 Allein -
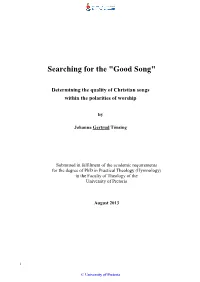
Searching for the "Good Song" Determining the Quality of Christian Songs Within the Polarities of Worship
Searching for the "Good Song" Determining the quality of Christian songs within the polarities of worship by Johanna Gertrud Tönsing Submitted in fulfilment of the academic requirements for the degree of PhD in Practical Theology (Hymnology) in the Faculty of Theology of the University of Pretoria August 2013 i © University of Pretoria Summary This thesis tries to answer the question what Christians should be singing in worship and why. The situation in many congregations is one of conflict around music and worship styles. The question is how these can be bridged and how worship leaders can be guided to make responsible choices about what is sung in Sunday worship. It is argued that what is sung, strongly influences the theology and faith of congregants. The thesis locates the discipline of hymnology within a hermeneutical approach to practical theology and tries to develop a theory to answer the question how to determine quality in Christian songs. The current discussions in practical theology and hermeneutics are examined for their relevance to hymnology, particularly some of the insights of Habermas, Gadamer and Ricoeur. Here particularly the idea of “dialogue” and “fusion of horizons” becomes relevant for bridging the divides in the conflicts around worship music. The dissertation examines biblical and church historical answers to the question of whether and what Christians should be singing. It becomes clear that the answers have varied widely during the course of church history, sometimes swinging between extremes. The next chapter looks at songs in the context of the worship service, their function within various parts of the service, and particularly looks at the dialectical poles of worship which should be kept in balance. -

Bruno Antonio Buike Einige Lieder Des Neuen Gotteslob 2013 -Suizidale Texte, Subversive Infiltration Und Banalisierung Der Römisch-Katholischen Religion [Some Songs of the German
Bruno Antonio Buike Einige Lieder des Neuen Gotteslob 2013 - suizidale Texte, subversive Infiltration und Banalisierung der römisch-katholischen Religion [Some songs of the German Song- and Prayerbook „Neues Gotteslob 2013“. Suicidal texts, subversive infiltration and banalization of the Roman-Catholic Religion.] [Certaines chansons du livre de prières allemand "Neues Gotteslob 2013". Textes suicidaires, infiltration subversive et banalisation de la religion catholique romaine] [Alcune canzoni del libro di preghiere tedesco "Neues Gotteslob 2013”. Testi da suicidio, infiltrazione sovversiva e banalizzazione de la Religione Romano- Cattolica] (with working weblinks in online-edition) main language: German other languages: English, Italian Tannhäuser als Ritter des Deutschen Ordens - Lieder-Handschrift Codex Manesse - © Neuss / Germany: Bruno Buike 2015 Buike Music and Science [email protected] BBWV E 63 Bruno Antonio Buike: Einige Lieder des Neuen Gotteslob 2013 - suizidale Texte, subversive Infiltration und Banalisierung der römisch-katholischen Religion [Some songs of the German Song- and Prayerbook „Neues Gotteslob 2013“. Suicidal texts, subversive infiltration and banalization of the Roman- Catholic Religion] [Certaines chansons du livre de prières allemand "Neues Gotteslob 2013". Textes suicidaires, infiltration subversive et banalisation de la Religion Catholique Romaine] [Alcune canzoni del libro di preghiere tedesco "Neues Gotteslob 2013”. Testi da suicidio, infiltrazione sovversiva e banalizzazione de la Religione Romano-Cattolica] main language German, other languages English and Italian Neuss: Bruno Buike 2015 1. Dies ist ein wissenschaftliches Projekt ohne kommerzielle Interessen. 2. Wer finanzielle Forderungen gegen dieses Projekt erhebt, dessen Beitrag und Name werden in der nächsten Auflage gelöscht. 3. Das Projekt wurde gefördert von der Bundesrepublik Deutschland, Sozialamt Neuss. 4. Rechtschreibfehler zu unterlassen, konnte ich meinem Computer trotz jahrelanger Versuche nicht beibringen. -

Gott? Und Ich, Trotz Wi - Der - Re - Den, 1
Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder zur Ansicht zur Ansicht Anhang zum Gesangbuch der Evangelischen Landeskirche in Baden mit Kopierschutz mit Kopierschutz 1 Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder „Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder!" Das ist wahr für die Christen- Inhalt heit zu allen Zeiten. In ihre Lieder nehmen Menschen ihre Erfahrungen hin- Lieder = 1–94 und 101–224 ein, singen vom Leben mit dem Glauben. Verkündigung, Gotteslob, Klage Psalmen = 901–976 und Frage gewinnen dabei immer neue Gestalt, bringen Glauben in Bezie- Liturgischer Kalender: nach Nr. 976 hung zur erlebten Gegenwart zum Ausdruck und nehmen musikalische Ent- Thematisches Verzeichnis der Lieder wicklungen auf. Alphabetisches Inhaltsverzeichnis Vor 13 Jahren wurde das erste Liederheft „Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder” als Ergänzung zum Evangelischen Gesangbuch herausgebracht. Seitdem sind weitere „Neue Lieder” hinzugekommen. Manche von ihnen wurden in dieser Zeit neu geschrieben, andere entstammen Regionalteilen der Gesangbücher oder neuen Beiheften anderer Landeskirchen. Außerdem enthält das Liederbuch alle neuen Wochenlieder, die nicht in den Gesangbü- chern der beteiligten Landeskirchen stehen. Dieses Plus von 124 Liedern ergänzt nun in einem Buch die Liedsammlung von 2005 – und ist den Gemeinden mit umfangreichem Begleitmaterial für Instrumente, Chöre und Bands zugänglich. Musik klingt über Grenzen hinweg! Das gilt auch für die Kommissionsarbeit, die diesem Liederbuch vorausging: Die Landeskirchen in Württemberg, Ba- den, der Pfalz und Elsass-Lothringen sind singend miteinander verbunden. Das vorliegende Liederbuch macht mit deutschen, französischen, englischen und spanischen Liedern Lust auf die Vielfalt der Singkulturen; die Bandbreite der Lieder eröffnet eine vielfältige theologische und musikalische Sprache des Glaubens für unsere Zeit. -

„Die Ngl-Literaturliste“
Peter Deckert: „DIE NGL-LITERATURLISTE“ Bücher – Zeitschriftentitel – Examensarbeiten zum Thema „Neues Geistliches Lied (NGL) – Sacro-Pop – Religiöse Popularmusik“ - Entstehung, Entwicklung, Formen, Funktionen, - Kriterien zu Auswahl und Bewertung, Kritik, - pädagogische, pastorale, liturgische Funktion und Bedeutung, - musikalische Einordnung, - Bewertung der Liedtexte, - Macher und Vermittler u.a. Die Liste ist alphabetisch nach Verfassern geordnet. Vielen Titeln sind den Inhalt erläuternde und kommentierende Hinweise beigefügt. Zur schnellen Übersicht verweisen Kennziffern auf den Hauptinhalt des Titels. Bei dieser Literaturzusammenstellung handelt es sich um die umfassendste verfügbare NGL-Bibliographie. Ein An- spruch auf Vollständigkeit wird damit jedoch nicht erhoben. Um die Liste zu verbessern und auf aktuellem Stand zu halten, sind Benutzer herzlich gebeten, Ergänzungen und Korrekturen mitzuteilen! Erarbeitet von Peter Deckert © Herausgegeben vom Arbeitskreis SINGLES im Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) im Erzbistum Köln Köln 1975 ff. Bearbeitungsstand: November 2020 Literaturliste NGL - 2 - © Inhalt © Hinweise zum Gebrauch: Aufbau und Inhalt der Literaturliste...............................................................................3 Problem Literaturbeschaffung........................................................................................3 Recherchehilfen der Literaturliste ..................................................................................4 Liste der "Themenkennziffern" (= bei den Titeln