Gesangbuchkunde (D 3)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
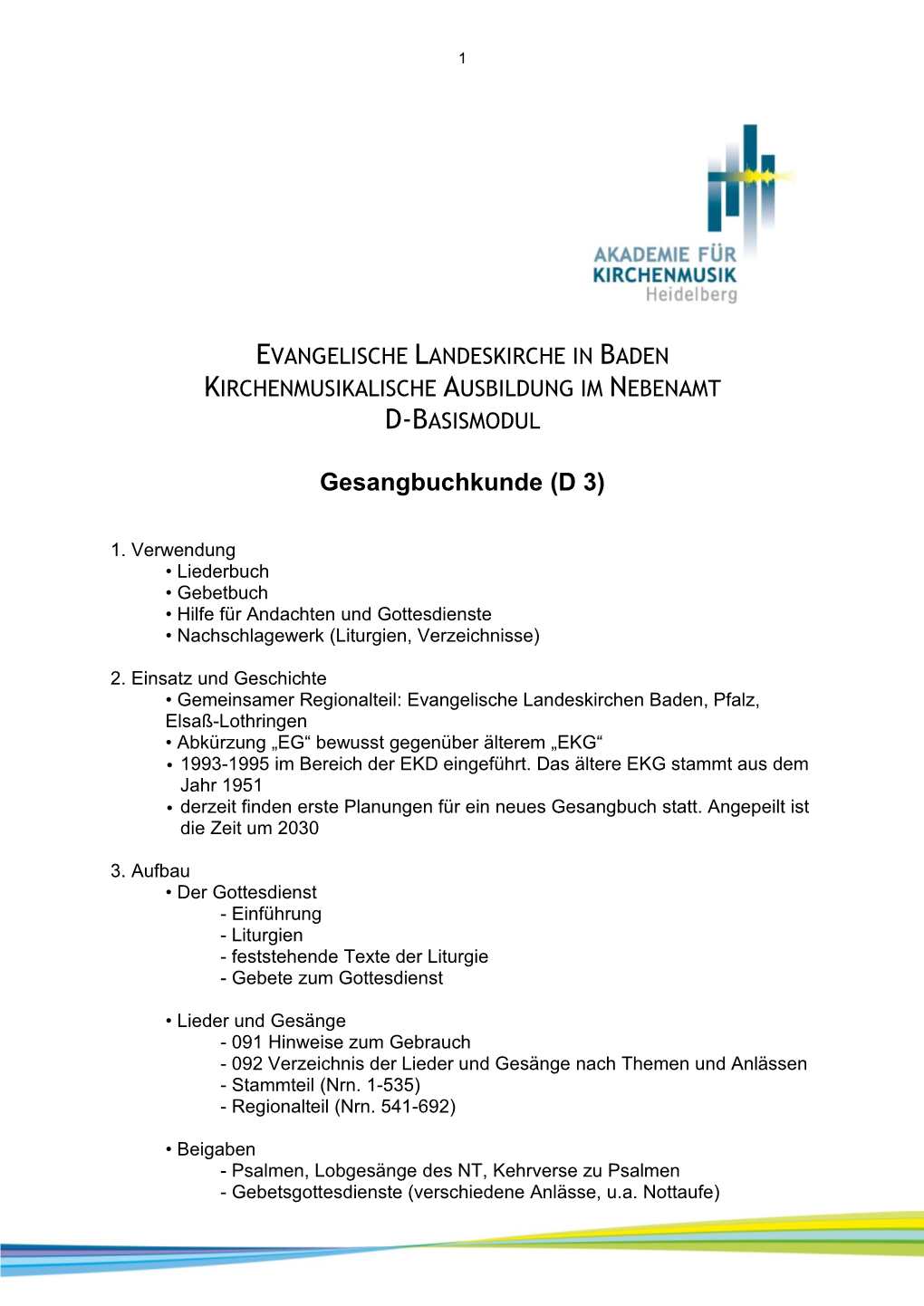
Load more
Recommended publications
-
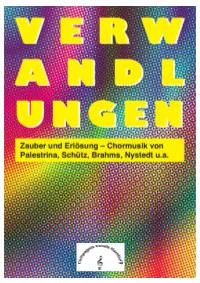
CV Programm 2017.Pdf
- 2 - Inhalt • Programm............................................................................. 4 • Texte mit Übersetzungen........................................................ 5 • Angaben zu den Komponisten............................................... 10 • Informationen zu Chorleiter und Chor..................................... 14 - 3 - Verwandlungen Seit Urzeiten fasziniert den Menschen die Vorstellung der Verwandlung: Der Gläubige hofft auf die geistliche Umwandlung durch Gott; in der Litera- tur, besonders in Sagen und Märchen, begegnen uns Verwandlungen als Fluch und Erlösung, als gerechte Strafe oder Belohnung für unser Tun. Was auch immer wir fürchten oder hoffen: Wir schaffen die Transformation nicht selbst. Es braucht eine besondere Kraft, damit wir anders oder ein an- derer werden – den Glauben an eine höhere Instanz, Zaubertränke, Wun- der. Die Musik selbst ist auf unerklärliche Weise magisch. Sie besitzt die Wirk- macht, uns zu verwandeln, zu verzaubern. Sie dient in unserem Konzert- programm als Medium, um von Verwandlungen zu erzählen und deren in- nere oder äußere Prozesse erlebbar zu machen. - 4 - Programm Giovanni Pierluigi di Palestrina (1525-1594) Sicut cervus Alessandro Scarlatti (1660-1725) Exultate deo Heinrich Schütz (1585-1672) Das ist je gewisslich wahr Rolf Schweizer (1936-2016) Der Herr ist mein Hirte (Psalm 23) Johannes Brahms (1833-1897) Vineta, op.42, 2 Verlorene Jugend, op.104, 4 Knut Nystedt (1915-2014) Die Güte des Herrn Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901) Kyrie - Agnus dei aus: Missa in Es (Cantus Missae op.109) für zwei vierstimmige Chöre Ola Gjeilo (geb. 1978) Unicornis captivatur (2001) - 5 - Giovanni Pierluigi di Palestrina Sicut Cervus Sicut cervus desiderat Wie der Hirsch schreit ad fontes aquarum, nach frischem Wasser, ita desiderat anima mea so schreit meine Seele, ad te, Deus. Gott, zu Dir. Alessandro Scarlatti Exultate Deo Exultate Deo, Frohlocket dem Herrn, adiutori nostro. -

Basisinformationen Zum „Neuen Geistlichen Lied” (Ngl)
PETER DECKERT , KÖLN : NGL BASISINFORMATIONEN ZUM „NEUEN GEISTLICHEN LIED” (NGL) Inhalt der Blätter: • Zitatensammlung : Singen und Musik im Gottesdienst (2 Seiten) • Das NGL: Strukturanalyse (Schaubild) (1 Seite) • Das NGL: Definitionsversuche (3 Seiten) • Was heißt „ neu " beim Neuen Geistlichen Lied? (2 Seiten) • Zum Begriff „Neues Geistliches Lied (NGL)“ (2 Seiten) • Übersicht: „Neues Geistliches Lied" und „Rhythmische Kirchenmusik" im Gesamtfeld religiöser Popularmusik (1 Seite) • Übersicht: Entwicklungsgeschichte der Neueren religiösen Popularmusik (NGL) 1950-1980 (1 S.) • Das NGL: Charakteristische Merkmale (2 Seiten) • Das NGL: Musikalische Merkmale (1 Seite)) • Das NGL: Stilrichtungen (3 Seiten) • Die Formgestalten des NGL und ihre Auswirkung auf das Singen der Gemeinde (2 Seiten) • Die Diskussion um das NGL: Versuch einer Systematisierung Pro und Contra (2 Seiten) • Ausführung von NGL im Kirchenraum und im Gottesdienst: Kleine Praxisproblem-Liste (2 Seiten) • Acht grundlegende Beobachtungen zur Situation des NGL (nach Eugen Eckert) (1 Seite) • Kriterien zur Analyse und Beurteilung von NGL (Der „AK SINGLES-Kriterienkatalog ", mit Einführung) (2+2 Seiten) • Empfehlenswerte Sammlungen von NGL (Liederbücher, Liedblätter) (3 Seiten) • Verlage und Gruppen , die NGL produzieren (Auswahl) (2 Seiten) • „NGL“ im Internet (1 Seite) • NGL-Literatur (Linkhinweis) (1 Seite) .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- HINWEISE: 1 Diese „Basisinformationen" sind ursprünglich 1984 als Arbeitsblätter für Seminare entstanden und wurden spä- ter – größtenteils aktualisiert – über diese Zweckbestimmung hinaus in vorliegender Form veröffentlicht. 2. Die Quellenangabe "Thomas Fischer" auf einigen Blättern steht für: Fischer, Thomas: Zur Problematik des Neuen Geistlichen Liedes in seiner gottesdienstlichen Funktion. Schriftli- che Hausarbeit zur 1. Staatsprüfung für das Lehramt an der Primarstufe, Universität Düsseldorf, Abt. Neuss, Seminar für Musik und ihre Didaktik. 1984 3. Zitation dieser Blätter wie folgt erbeten: Peter Deckert: Basisinformationen zum Neuen Geistlichen Lied. -

Lieder Evang. Reformierter Kirchenchor Der March
Lieder Evang. reformierter Kirchenchor der March Liedtitel Komponist Buchtitel Lied Mappe A Ach, arme Welt Johannes Brahms Chorbuch Grün 1 Ach, Gott und Herr Hans Chemin-Petit Chorbuch 68 34 Ade zur guten Nacht Hermann Stern Geselliges Singen 3 368 Adeste fideles, Herbei oh ihr Gläubigen Hubert Meister Mappe 142 Advent-Jodler Lorenz Maierhofer Mappe 148 Aennchen von Tharau ist, die mir gefällt Friedrich Silcher Geselliges Singen 3 365 Agnus Die, Gottes lamm der du trägst Per Gunnar Petersson Chorheft 2014 12 All I Want is a Room Somewhere Frederick Loewe Geselliges Singen 3 348 All mein Gedanken, die ich hab, die sind bei dir Johannes Brahms Geselliges Singen 3 362 All Morgen ist ganz frisch und neu Hermann Schroeder Musikbeilage 77 91 All Morgen ist ganz frisch und neu Adolf Strube Chorbuch 68 9 All Morgen ist ganz frisch und neu Johann Walter Musikbeilage 36 3 Alle eure Sorgen werfet auf ihn Matthias Blumer Musikbeilage 89 1 Alle guten Gaben Heinz Lau Geselliges Singen 2 153 Alle guten Gaben kommt her von Gott Anonymus Geselliges Singen 2 155 Alle Welt lobe den Herrn J.Safford Smith Mappe Allein auf Gottes Wort Joseph Rheinberger Mappe 114 Allein Gott in der Höh sei Ehr Johann Sebastian Bach Bachbuch 4 Allein Gott in der Höh sei Ehr Hugo Distler Chorheft 74 2 Allein Gott in der Höh sei Ehr Hans Leo Hassler Musikbeilage 35 10 Allein Gott in der Höh sei Ehr Michael Prätorius Chorbuch 68 10 Allein Gott in der Höh sei Ehr Friedrich Zipp Musikbeilage 67 2 Allein Gott in der Höh sei Ehr I Felix Mendelssohn Bartholdy Chorbuch Grün 12 Allein -
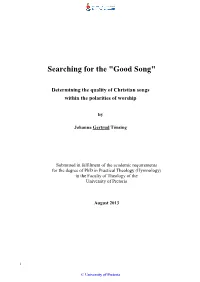
Searching for the "Good Song" Determining the Quality of Christian Songs Within the Polarities of Worship
Searching for the "Good Song" Determining the quality of Christian songs within the polarities of worship by Johanna Gertrud Tönsing Submitted in fulfilment of the academic requirements for the degree of PhD in Practical Theology (Hymnology) in the Faculty of Theology of the University of Pretoria August 2013 i © University of Pretoria Summary This thesis tries to answer the question what Christians should be singing in worship and why. The situation in many congregations is one of conflict around music and worship styles. The question is how these can be bridged and how worship leaders can be guided to make responsible choices about what is sung in Sunday worship. It is argued that what is sung, strongly influences the theology and faith of congregants. The thesis locates the discipline of hymnology within a hermeneutical approach to practical theology and tries to develop a theory to answer the question how to determine quality in Christian songs. The current discussions in practical theology and hermeneutics are examined for their relevance to hymnology, particularly some of the insights of Habermas, Gadamer and Ricoeur. Here particularly the idea of “dialogue” and “fusion of horizons” becomes relevant for bridging the divides in the conflicts around worship music. The dissertation examines biblical and church historical answers to the question of whether and what Christians should be singing. It becomes clear that the answers have varied widely during the course of church history, sometimes swinging between extremes. The next chapter looks at songs in the context of the worship service, their function within various parts of the service, and particularly looks at the dialectical poles of worship which should be kept in balance. -

Bruno Antonio Buike Einige Lieder Des Neuen Gotteslob 2013 -Suizidale Texte, Subversive Infiltration Und Banalisierung Der Römisch-Katholischen Religion [Some Songs of the German
Bruno Antonio Buike Einige Lieder des Neuen Gotteslob 2013 - suizidale Texte, subversive Infiltration und Banalisierung der römisch-katholischen Religion [Some songs of the German Song- and Prayerbook „Neues Gotteslob 2013“. Suicidal texts, subversive infiltration and banalization of the Roman-Catholic Religion.] [Certaines chansons du livre de prières allemand "Neues Gotteslob 2013". Textes suicidaires, infiltration subversive et banalisation de la religion catholique romaine] [Alcune canzoni del libro di preghiere tedesco "Neues Gotteslob 2013”. Testi da suicidio, infiltrazione sovversiva e banalizzazione de la Religione Romano- Cattolica] (with working weblinks in online-edition) main language: German other languages: English, Italian Tannhäuser als Ritter des Deutschen Ordens - Lieder-Handschrift Codex Manesse - © Neuss / Germany: Bruno Buike 2015 Buike Music and Science [email protected] BBWV E 63 Bruno Antonio Buike: Einige Lieder des Neuen Gotteslob 2013 - suizidale Texte, subversive Infiltration und Banalisierung der römisch-katholischen Religion [Some songs of the German Song- and Prayerbook „Neues Gotteslob 2013“. Suicidal texts, subversive infiltration and banalization of the Roman- Catholic Religion] [Certaines chansons du livre de prières allemand "Neues Gotteslob 2013". Textes suicidaires, infiltration subversive et banalisation de la Religion Catholique Romaine] [Alcune canzoni del libro di preghiere tedesco "Neues Gotteslob 2013”. Testi da suicidio, infiltrazione sovversiva e banalizzazione de la Religione Romano-Cattolica] main language German, other languages English and Italian Neuss: Bruno Buike 2015 1. Dies ist ein wissenschaftliches Projekt ohne kommerzielle Interessen. 2. Wer finanzielle Forderungen gegen dieses Projekt erhebt, dessen Beitrag und Name werden in der nächsten Auflage gelöscht. 3. Das Projekt wurde gefördert von der Bundesrepublik Deutschland, Sozialamt Neuss. 4. Rechtschreibfehler zu unterlassen, konnte ich meinem Computer trotz jahrelanger Versuche nicht beibringen. -

Gott? Und Ich, Trotz Wi - Der - Re - Den, 1
Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder zur Ansicht zur Ansicht Anhang zum Gesangbuch der Evangelischen Landeskirche in Baden mit Kopierschutz mit Kopierschutz 1 Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder „Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder!" Das ist wahr für die Christen- Inhalt heit zu allen Zeiten. In ihre Lieder nehmen Menschen ihre Erfahrungen hin- Lieder = 1–94 und 101–224 ein, singen vom Leben mit dem Glauben. Verkündigung, Gotteslob, Klage Psalmen = 901–976 und Frage gewinnen dabei immer neue Gestalt, bringen Glauben in Bezie- Liturgischer Kalender: nach Nr. 976 hung zur erlebten Gegenwart zum Ausdruck und nehmen musikalische Ent- Thematisches Verzeichnis der Lieder wicklungen auf. Alphabetisches Inhaltsverzeichnis Vor 13 Jahren wurde das erste Liederheft „Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder” als Ergänzung zum Evangelischen Gesangbuch herausgebracht. Seitdem sind weitere „Neue Lieder” hinzugekommen. Manche von ihnen wurden in dieser Zeit neu geschrieben, andere entstammen Regionalteilen der Gesangbücher oder neuen Beiheften anderer Landeskirchen. Außerdem enthält das Liederbuch alle neuen Wochenlieder, die nicht in den Gesangbü- chern der beteiligten Landeskirchen stehen. Dieses Plus von 124 Liedern ergänzt nun in einem Buch die Liedsammlung von 2005 – und ist den Gemeinden mit umfangreichem Begleitmaterial für Instrumente, Chöre und Bands zugänglich. Musik klingt über Grenzen hinweg! Das gilt auch für die Kommissionsarbeit, die diesem Liederbuch vorausging: Die Landeskirchen in Württemberg, Ba- den, der Pfalz und Elsass-Lothringen sind singend miteinander verbunden. Das vorliegende Liederbuch macht mit deutschen, französischen, englischen und spanischen Liedern Lust auf die Vielfalt der Singkulturen; die Bandbreite der Lieder eröffnet eine vielfältige theologische und musikalische Sprache des Glaubens für unsere Zeit. -

Neue Lieder Ein Angebot Für Die Gemeinden
Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder Ein Angebot für die Gemeinden Herausgegeben von den Evangelischen Landeskirchen in Baden und Württemberg, der Evangelischen Kirche der Pfalz und den Églises Réformée et Luthérienne d'Alsace et de Lorraine Chorheft herausgegeben von Lothar Friedrich EDITION 6282/02 Korrekturphase Korrekturphase Ansichtsexemplar in Vorwort Das Lied Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder gab den Titel der neuen Liedsammlung, die die Evangelischen Kirchen in Baden und Württemberg, in der Pfalz und die Églises Réformée et Luthérienne d'Alsace et de Lorraine zum Advent 2005 für ihre Gemeinden herausgegeben haben. Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder macht deutlich, eine christliche Gemeinde ist immer in Bewegung zu neuen Wegen im Lobe Gottes. So bleibt es nicht aus, dass zehn Jahre nach Erscheinen des neuen Evangelischen Gesangbu- ches wieder zahlreiche neue Lieder entstanden sind. Die in Gruppen und Kreisen gewachsenen neuen Lieder verlangen nach der singenden Gemeinde als prakti- zierendes Organ des Lobes Gottes. Aus diesem Grunde wurden für die Chöre zu einer Auswahl von Liedern leicht singbare Chorsätze konzipiert. Sie sind als gängige polyphone 3- bis 4-stimmige Sätze angelegt. Für die leichtere Hörbarkeit der Gemeinde beginnen fast alle Sätze mit einstimmig geführter Melodie im Sopran, wobei sich die weiteren Stimmen aus der vorausgegangenen Stimme entwickeln. Jeder Chorsatz ist mit einem Klavier-, Keyboard-, bzw. einem leichten Orgelbegleitsatz (manualiter) versehen. Damit will das Heft mit Hilfe der Chöre die Gemeinden zum Singen der neuen Lieder anleiten. Haben wir weiterhin ein offenes und waches Ohr für das Wachsen von neuen Liedern! Dazu will das Chorheft für die Gemeinden einen kleinen konstruktiven Beitrag leisten. -

Reformiertes Gesangbuch: Neuere Liedmelodien (Nach Melodietypen) Entstanden Nach 1952 Oder Neu Im Gesangbuch-Gebrauch; Ohne Nichtliedmäßige Gesänge
Reformiertes Gesangbuch: neuere Liedmelodien (nach Melodietypen) entstanden nach 1952 oder neu im Gesangbuch-Gebrauch; ohne nichtliedmäßige Gesänge Typus „Neues Kirchenlied“ Fortsetzung der Kirchenliedtradition, z.T. neomodal 002 Gottes Lob wandert und Erde darf hören Manfred Schlenker 013 Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen (Ps 22) Friedemann Gottschick 1967 039 Geborgen, geliebt und gesegnet (Ps 62) Franz Krautwurst 1991 045 Herr, mein Gott, ich traue auf dich (Ps 71) Johannes Petzold 1984/85 061 Lobe den Herrn, o Seele mein Manfred Schlenker (1968) 1971 064 Herr, wie sind deine Werke so groß und viel (Ps 104) Rolf Schweizer 1991 081 Wie die Träumenden werden wir sein (Ps126) Johannes Petzold 1985 085 Aus der Tiefe rufe ich zu dir (Ps 130) Oskar Gottlieb Blarr 086 Gott, ich fühl mich müd und leer (Ps 130) Hans Hauzenberger 1990 095 Besser als ich mich kenne (Ps 139) Johannes Petzold 1984 105 Nun darf getrost ich gehen s. 698 167 Du hast uns, Herr, gerufen, und darum sind wir hier Kurt Rommel 1967 185 Du hast mich, Herr zu dir gerufen Otmar Schulz (1974) 1978 186 Voller Freude sehn wir, Herr, dein Wunder Linus David 1990 212 O Herr, nimm unsre Schuld Hans Georg Lotz 1964 213 Ich steh vor dir mit leeren Händen, Bernard Huijbers 1964 256 Es ist ein Wort ergangen Albert Moeschinger (1939) 1941 258 Herr, gib uns Mut zum Hören Kurt Rommel 1964 260 Gott hat das erste Wort Gerard Kremer (1959) 1965 270 Wir glauben Gott im höchsten Thron Christian Lahusen 1948 279 Gott liebt diese Welt Walter Schulz 1962 281 Du bist der Weg, auf dem wir schreiten Theophil Rothenberg, geb. -

PDF-Download
Ankommen. www.busstag.de Er und Ben, sein Bruder, Nur ein Stern am Firmament, sind schon lange unterwegs. sonst nur der Mond und die Es ist kalt in der Wüste nachts, Vision von einer Welt, die er nicht kennt. tagsüber unfassbar heiss, Die Vision von Europa, doch die Freiheit verlangt ihren Preis. die Vision von Wohlstand und Glück. Aus: BAP: Vision vun Europa; Musik - Ulrich Rode, Text - Wolfgang Niedecken, Verlag - Vrinxpoozsonx Wolfgang Niedecken „Unser Nächster ist Wir wollen aufstehn, aufeinander zugehn, jeder Mensch, besonders der, voneinander lernen, miteinander umzugehn. der unser Hilfe braucht.“ Aufstehn, aufeinander zugehn Martin Luther und uns nicht entfernen, wenn wir etwas nicht verstehn. Aufstehn, aufeinander zugehn; Text: Clemens Bittlinger © Rechte beim Urheber Heimat ist nicht Raum, Heimat ist nicht Freundschaft, Heimat ist nicht Liebe – Heimat ist Friede. Paul Keller 1. Meine engen Grenzen, 1. Damit aus Fremden Freunde werden, meine kurze Sicht kommst du als Mensch in unsre Zeit: bringe ich vor dich. Du gehst den Weg durch Leid und Armut, Wandle sie in Weite: damit die Botschaft uns erreicht. Herr erbarme dich. 2. Damit aus Fremden Freunde werden, 4. Meine tiefe Sehnsucht gehst du als Bruder durch das Land, nach Geborgenheit begegnest uns in allen Rassen bringe ich vor dich. und machst die Menschlichkeit bekannt. Wandle sie in Heimat: Damit aus Fremden Freunde werden; Herr erbarme dich. Text und Melodie: Rolf Schweizer © by Bärenreiter-Verlag, Kassel Meine engen Grenzen, Text: Eugen Eckert © Lahn-Verlag in der Butzon & Bercker GmbH, Kevelaer, www.lahn-verlag.de Wo ein Mensch den andern sieht, „Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu nicht nur sich und seine Welt, essen gegeben. -

Kurz-Skript Hymnologie
Gliederung und Stichworte zur Vorlesung Hymnologie © Dr. Michael Schneider ([email protected]) 2019 Dieses Kurz-Skript bietet einen Überblick über den Vorlesungsbereich Hymnologie, insbesondere über prüfungsrelevante Inhalte. Es dient als Orientierung und Grundlage für persönliche Mitschriften von Vorle- sungen. Für vertiefte Fragen (auch zur Prüfungsvorbereitung) sind außerdem die in den Hinweisen genannte Literatur und ggf. weitere Unterlagen der/des jeweils Vorlesenden zu beachten. Zur Einleitung: Begriff und Aufgabe der Hymnologie Vielfältige Perspektiven: Hymnologie Die Texte von Kirchenliedern lassen sich literaturwissenschaftlich analysieren, die Me- lodien musikwissenschaftlich. Das Besondere an Kirchenliedern ist aber ihre Rezeption und Geltung als „Glaubenszeugnis“. Musikalisch oder theologisch anspruchsvolle Lieder können ohne jeden Gebrauch im Gottesdienst wieder in Vergessenheit geraten; umge- kehrt gibt es durchaus Lieder, die im Gottesdienst weit verbreitet sind, von Musikwis- senschaft und Theologie aber eher als schlicht eingestuft werden. Bei der hymnologi- schen Analyse von Kirchenliedern spielen daher nicht nur Struktur und Geschichte von Text und Musik eine Rolle. Hymnologie muss auch immer die Rezeption (im Gottes- dienst) bedenken. Singen und Musizieren als menschliche Lebensäußerung Singen und Musizieren sind Grundformen menschlicher Lebensäußerung und zwi- schenmenschlicher Kommunikation – weit über den (evangelischen) Gottesdienst hin- aus. Lieder sind bewusst, aber auch un- und unterbewusst -

Lexikon, Ergänzende Dateien
Otto Holzapfel, Liedverzeichnis [Hildesheim: Olms, 2006], CD-ROM-Update = Januar 2021. Dateien: Lieder, Lexikon, ergänzende Dateien. Alle Rechte vorbehalten, nicht zum Verkauf; kann kostenlos interessierten KollegInnen und Institutionen überlassen werden. Update jeweils beim Verfasser (Freiburg i.Br.; ottoholzapfel[at]yahoo.de) und im Volksmusikarchiv des Bezirks Oberbayern (Bruckmühl); © gemeinsames Copyright für die vorliegende Zusammenstellung insgesamt Otto Holzapfel und / oder Volksmusikarchiv des Bezirks Oberbayern. - Abkürzungen, wichtige Stichwörter und Liedverweise, ausgeschriebene Literaturhinweise sind mit # plus Begriff [ohne Abstand] auffindbar (bei der Literatur in der Regel jeweils an der ersten Stelle, zusätzlich in der ausführlichen Datei „Einleitung und Bibliographie“); * = Melodie; vgl. = Sekundärliteratur [Weiteres siehe „Einleitung“]. - An der Behebung leider möglicher Fehler arbeitet der Verfasser; für Korrekturen bin ich dankbar. – Ausgewählte Textstellen sind Zitate, Angaben zu einer ‚Fundstelle‘ mit möglicherweise jeweils eigenem Copyright, das zu beachten ist. Das gilt auch für die Abbildungen („Bildzitat“); die entspr. Quellen sind angegeben. - Wichtige Verweise auf die Lieddateien und auf ergänzende Dateien sind gelb unterlegt. „Copyright“ bedeutet „Urheberrecht“ und sollte so respektiert werden (vgl. auch Hinweis zur Datei „Liederhandschrift Langebek“). Ein Hashtag # ist dem entsprechenden Hauptstichwort ohne Abstand vorangesetzt. In den vorliegenden PDF- Dateien ist die Suchfunktion über „Strg“ und „f“ [„finden“] benutzbar (kleines Suchfenster links unten). Lexikon – Teil E bis G E Eber, Paulus (1511-1569); siehe: Lieddatei „Herr Jesu Christ wahr Mensch und Gott…“ #Ebermannstädter Liederhandschrift; geschrieben um 1750 von Frantz Melchior Freytag in Franken; Edition, hrsg. von Rolf W.Brednich und Wolfgang Suppan (Kulmbach 1972); das Repertoire ist dem Kunstlied nahestehend, nur wenige Stücke daraus sind populär geblieben. Vgl. in: Volksmusik in Bayern [Katalog], München 1985, S.34 f. -
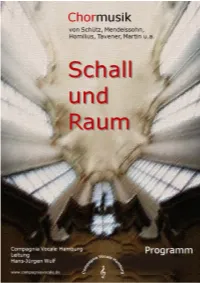
CV Programm 2014-5A
- 1 - - 2 - Inhalt • Einleitung ................................ ................................ ............ 3 • Programm................................ ................................ ............ 4 • Texte mit Übersetzungen ................................ ....................... 5 • Angaben zu den Komponisten ................................ ............... 13 • Informationen zu Chorleiter und Chor ................................ ..... 19 - 3 - Schall und Raum Geistliche Chormusik von di Lasso bis Lauridsen Kirchen bieten Konzertbesuchern besondere Hörerlebnisse, für Kompo- nisten sind sie seit jeher reiche Inspirationsquellen. San Marco in Vene- dig mit seinen vielen Emporen regte Giovanni Gabrieli im 16. Jahrhun- dert zu mehrchörigen Werken an, die den Raum weiten und von allen Seiten mit Klang erfüllen. Die akustischen Möglichkeiten der Kirchenar- chitektur faszinieren Komponisten bis heute. Frank Martin oder Morten Lauridsen umgeben uns mit selbst geschaffenen Klangräumen, John Cage macht die Stille im Raum erlebbar, indem er ihr ein eigenes Stück widmet. Die Compagnia Vocale Hamburg nimmt in ihrem Konzert unterschiedli- che Aufstellungen ein und bezieht so den ganzen Raum und das Publi- kum in die Musik ein. Auch stilistisch und thematisch spannt der Chor weite Bögen. Aus fünf Jahrhunderten erklingen Bittgebete und Lobge- sänge, Motetten über menschliche Zweifel und göttliche Vergewisse- rung sowie am Ende ein Amen als komponiertes Glockengeläut. - 4 - Programm Orlando di Lasso (1532 – 1594) O la, che bon eccho Giovanni Gabrieli