Kurz-Skript Hymnologie
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Now Let Us Come Before Him Nun Laßt Uns Gehn Und Treten 8.8
Now Let Us Come Before Him Nun laßt uns gehn und treten 8.8. 8.8. Nun lasst uns Gott, dem Herren Paul Gerhardt, 1653 Nikolaus Selnecker, 1587 4 As mothers watch are keeping 9 To all who bow before Thee Tr. John Kelly, 1867, alt. Arr. Johann Crüger, alt. O’er children who are sleeping, And for Thy grace implore Thee, Their fear and grief assuaging, Oh, grant Thy benediction When angry storms are raging, And patience in affliction. 5 So God His own is shielding 10 With richest blessings crown us, And help to them is yielding. In all our ways, Lord, own us; When need and woe distress them, Give grace, who grace bestowest His loving arms caress them. To all, e’en to the lowest. 6 O Thou who dost not slumber, 11 Be Thou a Helper speedy Remove what would encumber To all the poor and needy, Our work, which prospers never To all forlorn a Father; Unless Thou bless it ever. Thine erring children gather. 7 Our song to Thee ascendeth, 12 Be with the sick and ailing, Whose mercy never endeth; Their Comforter unfailing; Our thanks to Thee we render, Dispelling grief and sadness, Who art our strong Defender. Oh, give them joy and gladness! 8 O God of mercy, hear us; 13 Above all else, Lord, send us Our Father, be Thou near us; Thy Spirit to attend us, Mid crosses and in sadness Within our hearts abiding, Be Thou our Fount of gladness. To heav’n our footsteps guiding. 14 All this Thy hand bestoweth, Thou Life, whence our life floweth. -

Materialheft Schlussgottesdienst Die Biblische Grundlage: Jesaja 51,1–5
schaut hin – blickt durch – geht los Schlussgottesdienst 3. Ökumenischer Kirchentag Materialheft zum 16. Mai 2021 Impressum Alle Rechte vorbehalten © 2021 3. Ökumenischer Kirchentag Frankfurt 2021 e. V. Verantwortlich: Arnd Schomerus Redaktion: Ilse Müller, Julius Radtke, Arnd Schomerus Layout und Satz: Stephan Gärtner Inhaltsverzeichnis Einführung/Vorwort 4 Die biblische Grundlage: Jesaja 51,1–5 5 Exegetische Skizze 7 Ablauf des Schlussgottesdienstes 16 Leporello 17 Gebet und Fürbitten aus dem Gottesdienst 22 Kollekte 23 Anregungen zum Mitmachen 24 Anhang 32 Einführung/Vorwort Kirchen-, Katholikentage und Ökumenische Kirchentage sind Feste der Gemeinschaft und Begegnung. Besonders bei den Großgottesdiensten ist das immer wieder deutlich zu spüren. Die Corona-Pandemie hat unsere Planungen in diesem Jahr durcheinandergebracht. Wir wollen trotzdem diskutieren, uns digital begegnen und auch Gottesdienste feiern. Das ist wichtig – persönlich, füreinander und für unsere Gesellschaft. Der Schlussgottesdienst des 3. Ökumenische Kirchentages wird vor Ort in Frankfurt am Main auf einer Bühne an der „Weseler Werft“ gefeiert werden. Gleichzeitig wird dieser Gottesdienst live im ZDF übertragen und ein Mitfeiern ist bundesweit möglich. Dieses Mitfeiern wollen wir durch dieses Materialheft unterstützen. Sie finden den Ablauf des Gottesdienstes, die Lieder, eine Druckvorlage für einen „Gottesdienstzettel“ wie auch eine „exegetische Skizze“ für den dem Schlussgottesdienst zugrundeliegenden Bibeltext Jesaja 51,1–5. Darüber hinaus sind auch Ideen beschrieben, wie in einer Kirchengemeinde ein gemeinsames Mitfeiern des Schlussgottesdienstes eingebettet werden kann. „Schaut hin – blickt durch – geht los“. Wir freuen uns, wenn viele am 16. Mai 2021, von 10.00–11.00 Uhr dabei sind! Arnd Schomerus Kirchentagspastor Hinweise zu Aufführungsrechten Bitte beachten Sie die rechtlichen Rahmenbedingungen für Aufführungsrechte, die für Ihre Kirche gelten. -

"... Und Steure Deiner Feinde Mord" : Gewalt Im Kirchenlied
IASL 2015; 40(1): 1–20 Martina Wagner-Egelhaaf „… und steure deiner Feinde Mord“ Gewalt im Kirchenlied Abstract: This essay looks at moments of violence in Christian hymns. It analyzes chants used in the early modern struggle between Catholics and Protestants and in missionary movements which still can be found in contemporary hymnbooks. The article shows that the chants not only direct aggression against an outer enemy but also against the fiend within. As the German word ‘Gewalt’ means both ‘violence’ and ‘power’, the hymns oscillate between both meanings. The ‘Gewalt’ being praised in the hymns often self-reflectively addresses the chants’ own violence and/or power as it is illustrated by a brief look at Heinrich von Kleist’s novella Die heilige Cäcilie oder die Gewalt der Musik. DOI 10.1515/iasl-2015-0001 Kirchenlieder mit Gewalt in Verbindung zu bringen, liegt auf den ersten Blick nicht unbedingt nahe, dient das Kirchenlied doch in erster Linie der gottesdienst- lichen Erbauung und dem Lob Gottes. Und doch gibt es in den Gesangbüchern, die insgesamt ziemlich politisch korrekt geworden sind,1 bis heute Liedtexte, in denen es keineswegs zimperlich zugeht. Dies ist umso mehr in historischen Gesangbüchern der Fall. Es ist ein Leichtes, hier Beispiele zu präsentieren, bei denen man sich fragt, wie sie gesungen werden konnten, ohne dass sich dabei das christliche Gewissen regte. Im Fokus des vorliegenden Beitrags steht jedoch das, was tatsächlich in den Gesangbüchern stehen geblieben ist, was gewisser- maßen die Gewalt-Zensur überstanden hat und vielleicht doch unter dem Vor- zeichen einer gepflegten, impliziten, subtilen, in ihrer Ambiguität vielleicht den- noch wirkmächtigen Gewaltförmigkeit diskutiert werden kann. -
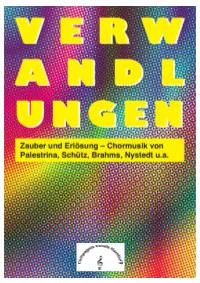
CV Programm 2017.Pdf
- 2 - Inhalt • Programm............................................................................. 4 • Texte mit Übersetzungen........................................................ 5 • Angaben zu den Komponisten............................................... 10 • Informationen zu Chorleiter und Chor..................................... 14 - 3 - Verwandlungen Seit Urzeiten fasziniert den Menschen die Vorstellung der Verwandlung: Der Gläubige hofft auf die geistliche Umwandlung durch Gott; in der Litera- tur, besonders in Sagen und Märchen, begegnen uns Verwandlungen als Fluch und Erlösung, als gerechte Strafe oder Belohnung für unser Tun. Was auch immer wir fürchten oder hoffen: Wir schaffen die Transformation nicht selbst. Es braucht eine besondere Kraft, damit wir anders oder ein an- derer werden – den Glauben an eine höhere Instanz, Zaubertränke, Wun- der. Die Musik selbst ist auf unerklärliche Weise magisch. Sie besitzt die Wirk- macht, uns zu verwandeln, zu verzaubern. Sie dient in unserem Konzert- programm als Medium, um von Verwandlungen zu erzählen und deren in- nere oder äußere Prozesse erlebbar zu machen. - 4 - Programm Giovanni Pierluigi di Palestrina (1525-1594) Sicut cervus Alessandro Scarlatti (1660-1725) Exultate deo Heinrich Schütz (1585-1672) Das ist je gewisslich wahr Rolf Schweizer (1936-2016) Der Herr ist mein Hirte (Psalm 23) Johannes Brahms (1833-1897) Vineta, op.42, 2 Verlorene Jugend, op.104, 4 Knut Nystedt (1915-2014) Die Güte des Herrn Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901) Kyrie - Agnus dei aus: Missa in Es (Cantus Missae op.109) für zwei vierstimmige Chöre Ola Gjeilo (geb. 1978) Unicornis captivatur (2001) - 5 - Giovanni Pierluigi di Palestrina Sicut Cervus Sicut cervus desiderat Wie der Hirsch schreit ad fontes aquarum, nach frischem Wasser, ita desiderat anima mea so schreit meine Seele, ad te, Deus. Gott, zu Dir. Alessandro Scarlatti Exultate Deo Exultate Deo, Frohlocket dem Herrn, adiutori nostro. -

Lutheran Spirituality and the Pastor
Lutheran Spirituality and the Pastor By Gaylin R. Schmeling I. The Devotional Writers and Lutheran Spirituality 2 A. History of Lutheran Spirituality 2 B. Baptism, the Foundation of Lutheran Spirituality 5 C. Mysticism and Mystical Union 9 D. Devotional Themes 11 E. Theology of the Cross 16 F. Comfort (Trost) of the Lord 17 II. The Aptitude of a Seelsorger and Spiritual Formation 19 A. Oratio: Prayer and Spiritual Formation 20 B. Meditatio: Meditation and Spiritual Formation 21 C. Tentatio: Affliction and Spiritual Formation 21 III. Proper Lutheran Meditation 22 A. Presuppositions of Meditation 22 B. False Views of Meditation 23 C. Outline of Lutheran Meditation 24 IV. Meditation on the Psalms 25 V. Conclusion 27 G.R. Schmeling Lutheran Spirituality 2 And the Pastor Lutheran Spirituality and the Pastor I. The Devotional Writers and Lutheran Spirituality The heart of Lutheran spirituality is found in Luther’s famous axiom Oratio, Meditatio, Tentatio (prayer, meditation, and affliction). The one who has been declared righteous through faith in Christ the crucified and who has died and rose in Baptism will, as the psalmist says, “delight … in the Law of the Lord and in His Law he meditates day and night” (Psalm 1:2). He will read, mark, learn, and take the Word to heart. Luther writes concerning meditation on the Biblical truths in the preface of the Large Catechism, “In such reading, conversation, and meditation the Holy Spirit is present and bestows ever new and greater light and devotion, so that it tastes better and better and is digested, as Christ also promises in Matthew 18[:20].”1 Through the Word and Sacraments the entire Trinity makes its dwelling in us and we have union and communion with the divine and are conformed to the image of Christ (Romans 8:29; Colossians 3:10). -

Lieder-Liste 140130 Für Geplante Cusic-Mappe Mit Quellen
Inhaltsverzeichnis der geplanten Cusic-Mappe 1-220 (01/2014) Quelle der Vorlage [mit Lied-Nr.] : Kzg. : Kreuzungen [von Martin Müller, Sasbach] E&H : Erdentöne-Himmelsklang [Schwabenv.] SmH : Singt mit Herz [Druck Hartmann, Han.] € pro€ pro€ pro€ pro€ pro€ pro€ pro …) …) …) …) …) …) …) k+s : kommt und singt [Erzbistum Köln] GL : Neues Gotteslob [Bistümer Deutschlands] LZ : Liederzettel sehr unterschiedlicher Herkunft AnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlder Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen TonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonart : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle KostenKostenKostenKostenKostenKostenKostenKosten(7.-(7.-(7.-(7.-(7.-(7.-(7.-(7.- Nr. Liedtitel Quelle Autoren : Text / Musik Copyright ( ggf. Text / Musik ) s = € Bem. Hanna Lam / Wim ter Burg | Verlag G. F. Callenbach, Nijkerk NL | 113 Abraham, Abraham, verlass dein Land k+s 351 1 = dt. Übertr. Diethard Zils Gustav Bosse Verlag, Regensburg 032 Alle Knospen springen auf Kzg 11 Wilhelm Willms / Ludger Edelkötter KIMU Kindermusikverlag GmbH, Pullheim 1 = 143 Amen ! Amen ! Kzg 14 Spiritual 1 4+ 174 Ameni, Amen - All ihr Werke lobt -

Inhalt Des Ersten Bandes. Die Periode Des Vekenntmsliedes 1570—1648
Inhalt des ersten Bandes. Die Periode des Vekenntmsliedes 1570—1648. A. Die Zeit von 1570-1618. Seite Seite Seite I. Tie thüringischen Dichter. Leonhard Kreichheim . 81 Sebastian Hornmolt . 156 Johannes Timäns. 82 Johann Philipp Apsfel Cyriakus Schneegaß . 1 Caspar Schreiber . 83 selber . 158 Erasmus Winter ... 3 Melchior Eccard . 84 Johann Assum . 158 Johann Stenrlein ... 3 Nathanael Tilesins . 88 Bernhard Heupold 160 Johann Stoll .... 6 Martin Hancke .... 92 David Spaiser . 161 Melchior Bischoff ... 7 Caspar Rauch .... 93 Abraham Suarinns . 10 c) Sonstige Dichter. Johann Lemann . 94 Michael Sachse . ... 14 Johannes Flimmer Christiana Cunradina. 96 Martin Rutilius .... 21 (Flinner) . 167- Valerius Herberger . 97 Basilius Förtsch .... 22 Johann Halbmeyr 167 Zacharias Herberg er . 99 NicolauS Rhost .... 26 Sebastian Ambrosius 169 Adam Meitzer .... 100 Johann Kempff .... 27 Zacharias Eyring . 170 Christoph Knoll . 100 Tobias Kiel 28 Moritz Moltzer . 172 Lieder von unbekannten Johann Lindemann . 32 Lieder von unbekannten Verfassern 103 Lieder von unbekannten Verfassern . .... 173 Verfassern 33 IV. Die süddeutschen Dichter. V. Die norddeutschen Dichter. Urban Störner . 177 II. Die sächsischen Dichter. a) Die Dichter aus Franken. Valentin Rehefeld . 178 Urban Langhans ... 42 Andreas Pancratins 117 Georg Schultze . 178 Thomas Popel .... 44 Christoph Homagius 118 Stephan Praetorins 179 Cornelius Freundt ... 45 Johann Mylius 118 Theodor Sommer . 181 Christian Schön .... 49 Hieronymus Oertel 122 Wolfgang Striccius 182 Tobias Roth 51 Georg Oesterreicher 124 David Lang . 184 Johann Wagner.... 52 Caspar Uttenhoser . 136 Petrus Bambamins 185 Johann Förster .... 53 137 Johann Neser . Nicolaus Gryse. 186 Michael Schumler ... 57 Georg Grünewald . 138 Friedrich Gundelwein 190 Zachäus Faber d. Ä. 57 Christian Thalhamer 139 Christoph Friccius. 190 Johann Thönniker .. -
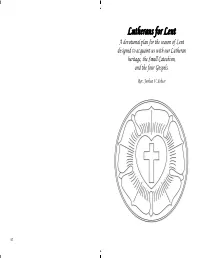
Lutherans for Lent a Devotional Plan for the Season of Lent Designed to Acquaint Us with Our Lutheran Heritage, the Small Catechism, and the Four Gospels
Lutherans for Lent A devotional plan for the season of Lent designed to acquaint us with our Lutheran heritage, the Small Catechism, and the four Gospels. Rev. Joshua V. Scheer 52 Other Notables (not exhaustive) The list of Lutherans included in this devotion are by no means the end of Lutherans for Lent Lutheranism’s contribution to history. There are many other Lutherans © 2010 by Rev. Joshua V. Scheer who could have been included in this devotion who may have actually been greater or had more influence than some that were included. Here is a list of other names (in no particular order): Nikolaus Decius J. T. Mueller August H. Francke Justus Jonas Kenneth Korby Reinhold Niebuhr This copy has been made available through a congregational license. Johann Walter Gustaf Wingren Helmut Thielecke Matthias Flacius J. A. O. Preus (II) Dietrich Bonheoffer Andres Quenstadt A.L. Barry J. Muhlhauser Timotheus Kirchner Gerhard Forde S. J. Stenerson Johann Olearius John H. C. Fritz F. A. Cramer If purchased under a congregational license, the purchasing congregation Nikolai Grundtvig Theodore Tappert F. Lochner may print copies as necessary for use in that congregation only. Paul Caspari August Crull J. A. Grabau Gisele Johnson Alfred Rehwinkel August Kavel H. A. Preus William Beck Adolf von Harnack J. A. O. Otteson J. P. Koehler Claus Harms U. V. Koren Theodore Graebner Johann Keil Adolf Hoenecke Edmund Schlink Hans Tausen Andreas Osiander Theodore Kliefoth Franz Delitzsch Albrecht Durer William Arndt Gottfried Thomasius August Pieper William Dallman Karl Ulmann Ludwig von Beethoven August Suelflow Ernst Cloeter W. -

Luther's Hymn Melodies
Luther’s Hymn Melodies Style and form for a Royal Priesthood James L. Brauer Concordia Seminary Press Copyright © 2016 James L. Brauer Permission granted for individual and congregational use. Any other distribution, recirculation, or republication requires written permission. CONTENTS Preface 1 Luther and Hymnody 3 Luther’s Compositions 5 Musical Training 10 A Motet 15 Hymn Tunes 17 Models of Hymnody 35 Conclusion 42 Bibliography 47 Tables Table 1 Luther’s Hymns: A List 8 Table 2 Tunes by Luther 11 Table 3 Tune Samples from Luther 16 Table 4 Variety in Luther’s Tunes 37 Luther’s Hymn Melodies Preface This study began in 1983 as an illustrated lecture for the 500th anniversary of Luther’s birth and was presented four times (in Bronxville and Yonkers, New York and in Northhampton and Springfield, Massachusetts). In1987 further research was done on the question of tune authorship and musical style; the material was revised several times in the years that followed. As the 500th anniversary of the Reformation approached, it was brought into its present form. An unexpected insight came from examining the tunes associated with the Luther’s hymn texts: Luther employed several types (styles) of melody. Viewed from later centuries it is easy to lump all his hymn tunes in one category and label them “medieval” hymns. Over the centuries scholars have studied many questions about each melody, especially its origin: did it derive from an existing Gregorian melody or from a preexisting hymn tune or folk song? In studying Luther’s tunes it became clear that he chose melody structures and styles associated with different music-making occasions and groups in society. -

„Der Himmel Geht Über Allen Auf“
Feiertag im Deutschlandradio Kultur Theologieprofessor Günter Ruddat aus Bochum „Der Himmel geht über allen auf“ Singen auf Evangelisch 28. Mai 2017 Heute morgen in Berlin, da erinnere ich mich an meinen ersten Kirchentag 1961 – kurz vor dem Mauerbau. Gerade frisch konfirmiert war ich als evangelischer Pfadfinder dabei, wohl einer der jüngsten unter den vielen Helferinnen und Helfern. Zum Abschluss der Gottesdienst im riesigen Olympiastadion, ein einziger Klangteppich. Damals ahnte kaum jemand: dieser Kirchentag sollte für lange Zeit der letzte gesamtdeutsche Kirchentag sein. Heute Mittag um 12 Uhr auf den Elbwiesen am Rande der Lutherstadt Wittenberg wollen Menschen aus aller Welt einen ganz besonderen Festgottesdienst feiern unter dem Motto „Von Angesicht zu Angesicht“. Sie feiern damit nicht nur den Abschluss des diesjährigen Evangelischen Kirchentags in Berlin und Witten- berg, sondern zugleich 500 Jahre Reformation. „Singen und Sagen“, unter diesem Motto löste vor 500 Jahren die Glaubensbewegung der Reformation so etwas wie eine ansteckende Singbewegung aus: die Menschenfreundlichkeit Gottes sollte auch in der Spra- che des Volkes lebendig werden. Aus vielen Volksliedern wurden so Kirchenlieder, die Menschen konnten im wahrsten Sinne des Wortes den Mund aufmachen und aus vollem Herzen singen im Gottesdienst, in den Schulen und zuhause. Heute in Wittenberg werden nicht nur evangelische Christinnen und Christen bewegt von der Losung „Du siehst mich“, sie feiern und stehen ein für ihren Glauben in der Gegenwart, teilen Brot und Wein, bunt, viel- sprachig, hoffnungsvoll. Erwartet werden mehr als 100.000 Menschen, sie wissen sich im Glauben verbunden, setzen ein Friedens- zeichen und zeigen: Gott ist bei uns. Gott verändert uns und unsere Welt. -

5009 Liederheft Druckausgabe.Indd
Dieses Liederheft will mit ansprechenden Liedern auch Jugendliche zum Singen locken, weil Singen ein wesentlicher Ausdruck des christlichen Glaubens ist. Es bietet die Möglichkeit, wichtige Themen des Unterrichts mit Liedern zu erschließen. Es macht vertraut mit Liedern, die zur festen Tradition der evangelischen Kirche gehören. Es stellt für den Unterricht grundlegende Texte bereit. Es gibt Psalmen, Psalmgebete und Liedrufe für Andachten und Gottesdienste an die Hand. Deshalb sind in diesem Liederheft einige wichtige „alte“ Choräle und viele „neue geistliche Lieder“ abgedruckt. Dann gibt es den Textteil für Unterricht und Andacht. Am Schluss finden sich ein paar leere Seiten für eigene Lieder oder Texte. Hennef, April 2006 Matthias Morgenroth 5009 Liederheft Druckausgabe.ind1 1 16.06.2006 15:06:34 Inhalt Lieder: Ach bleib mit deiner Gnade 40 Ausgang und Eingang 54 Bewahre uns, Gott 60 Brich mit den Hungrigen dein Brot 44 Bruder Jesus, du suchst Menschen 41 Da berühren sich Himmel und Erde 6 Damit aus Fremden Freunde werden 46 Danke 10 Das sollt ihr, Jesu Jünger nicht vergessen 37 Der Himmel, der ist 57 Du bist du 30 Du hast uns, Herr, gerufen 27 Du, Herr, gabst uns dein festes Wort 24 Ein feste Burg 56 Erleuchte und bewege uns 13 Esst das Brot 34 Gott gab uns Atem 48 Gott gibt sein Wort 22 Gott liebt diese Welt 32 Gott wird ein Mensch 4 Gottes Geist ist kein Gespenst 25 Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht 23 Herr, gib mir Mut zum Brücken bauen 45 Herr, wir bitten: Komm und segne uns 33 Hewenu schalom alejchem 2 Ich bin getauft auf -

Heurich, Winfried, *13. Febr. 1940 in Neuhof Bei Fulda
Heurich, Winfried , *13. Febr. 1940 in Neuhof bei Fulda, - Kirchenmusiker, Komponist Neuer Geistlicher Lieder. Ab dem 10. Lebensjahr erhielt W. Heurich Klavierunterricht, und ab dem 13. Lebensjahr Orgelunterricht. Die Organistenausbildung und die Lehre zum Speditionskaufmann (der anständige Beruf) liefen genauso parallel wie das Musizieren auf dem Tanzboden und der sonntägliche Organistendienst in seiner Heimatgemeinde ab dem 15. Lebensjahr. Nach Absolvierung der B-Organistenprüfung im Bistum Fulda entschloss sich W. Heurich 1962 zum Studium der Kirchenmusik an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main. Im Jahre 1966 schloss er dieses mit dem A-Examen ab und wurde zum hauptamtlichen Kirchenmusiker an der Frankfurter Liebfrauenkirche berufen, an der er bis Anfang 2000 wirkte. Dem Kirchenmusiker, in der von Kapuzinern geleiteten Pfarrei, boten sich im Spannungsfeld „Kunst" und „Kultur" viele musikalische Möglichkeiten, da sich in der Gemeinde auch zunehmend eine Segmentierung in so genannte „Milieus" oder „Zielgruppen" entwickelte: Die Männerschola sang Gregorianischen Choral, das Vokalensemble widmete sich in „Thematischen Gottesdiensten" dem Neuen Geistlichen Lied. Ein aus Mitgliedern der Frankfurter Oper gebildetes Vokalquartett sang an den hohen Feiertagen. Das Blechbläserquintett des Hessischen Rundfunks begleitete unter der musikalischen Leitung von W. Heurich nicht nur 25 Jahre lang die Stadtfronleichnamsfeiern auf dem Römerberg, sondern erfreute sich auch großer Beliebtheit bei festlichen Gottesdiensten in der Liebfrauenkirche. In über 60 Konzerten, während der 37 Dienstjahre Heurich's, wirkten nicht nur Chor und Orgel zusammen, -bekannte Schauspieler rezitierten Zwischentexte im Wechsel mit einem Saxophonquartett oder anderen solistischen Instrumenten. Neben dem umfangreichen Dienst an dieser City-Kirche interessierte sich Heurich ab den siebziger Jahren zunehmend für das Neue Geistliche Lied.