Lutz Danneberg Das Perforierte Gewand
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

„Psyche Ist Ein Griechisches Wort...“
„Psyche ist ein griechisches Wort...“ Forme e funzioni della cultura classica nell‘opera di Sigmund Freud Inauguraldissertation zur Erlangung des Grades Dr. phil. vorgelegt im Fachbereich Sprach-und Literaturwissenschaften der Bergischen Universität - Gesamthochschule Wuppertal von Paola Traverso aus Gavi Wuppertal, im Juni 2000 INDICE INTRODUZIONE 3 I. LA LETTERATURA CRITICA 17 II. GLI STUDI SULL'ISTERIA 36 II.1. La scelta della professione 36 II.2. Dalla neurologia alla psicopatologia 40 II.3. „Come se l‘anatomia non esistesse...“ 52 II.4. Il metodo catartico e la ridefinizione della katharsis tragica di Jakob Bernays 54 II.5. L'isteria:"Ein wissenschaftliches Märchen" 65 II.6. Ipnosi, suggestione e il potere magico della parola 69 III. NOTE ALLA „TRAUMDEUTUNG“ (parte prima) 78 III.1. Alcune considerazioni sulla scelta del titolo 78 III.2. „Flectere si nequeo superos...“ L‘interpretazione prometeica del motto 80 III.3. L'interpretazione politica e l'interpretazione psicoanalitica 86 III.4. Due proposte interpretative: la catabasi all'Ade e l'inconscio come oltretomba mitico 89 III.5. Catabasi e mondo onirico 95 III.6. „Acheronta movebo“. Geografia freudiana e geografia virgiliana: la metafora degli inferi. 103 IV. NOTE ALLA „TRAUMDEUTUNG“ (parte seconda) 112 IV.1. La scelta classica 112 IV.2. La rivendicazione polemica 117 IV.3. La dinamica del referente classico 123 IV.4. La funzione del riferimento aristotelico 126 IV.5. L‘influsso di Brentano 131 IV.6. Fenomenologia onirica: il modello aristotelico e il modello freudiano. 133 IV.7. Oneirokritiká 145 IV.8. La ‚scoperta‘ freudiana dell‘antichità e la questione della ‚priorità‘ 158 APPENDICE FREUD, IL LATINO, I LATINI 162 1. -

666 Or 616 (Rev. 13,18)
University of Wollongong Research Online Faculty of Engineering and Information Faculty of Informatics - Papers (Archive) Sciences 7-2000 666 or 616 (Rev. 13,18) M. G. Michael University of Wollongong, [email protected] Follow this and additional works at: https://ro.uow.edu.au/infopapers Part of the Physical Sciences and Mathematics Commons Recommended Citation Michael, M. G.: 666 or 616 (Rev. 13,18) 2000. https://ro.uow.edu.au/infopapers/674 Research Online is the open access institutional repository for the University of Wollongong. For further information contact the UOW Library: [email protected] 666 or 616 (Rev. 13,18) Disciplines Physical Sciences and Mathematics Publication Details This article was originally published as Michael, MG, 666 or 616 (Rev. 13, 18), Bulletin of Biblical Studies, 19, July-December 2000, 77-83. This journal article is available at Research Online: https://ro.uow.edu.au/infopapers/674 RULL€TIN OF RIRLICkL STUDies Vol. 19, July - December 2000, Year 29 CONTENTS Prof. Petros Vassiliadis, Prolegomena to Theology of the New Testament 5 Dr. Demetrios Passakos. Luk. 14,15-24: Early Christian Suppers and the self-consciousness of the Lukas community 22 Dr. D. Rudman, Reflections on a Half-Created World: The Sea, Night and Death in the Bible .33 . { Prof. Const. Nikolakopoulos, Psalms - Hymns - Odes. Hermeneutical Contribution of Gregory of Nyssa to biblical hymnological terminology .43 Prof. Savas Agourides, The Meaning of chap. lOin John's Gospel and the difficulties of its interpretation .58 Mr. Michael G. Michael, 666 or 616 (Rev. 13, 18) 77 Dr. Vassilios Nikopoulos, The Legal Thought ofSt. -

Copyright © 2013 Elijah Michael Hixson All Rights Reserved. the Southern Baptist Theological Seminary Has Permission to Reprod
Copyright © 2013 Elijah Michael Hixson All rights reserved. The Southern Baptist Theological Seminary has permission to reproduce and disseminate this document in any form by any means for purposes chosen by the Seminary, including, without limitation, preservation or instruction. SCRIBAL TENDENCIES IN THE FOURTH GOSPEL IN CODEX ALEXANDRINUS A Thesis Presented to the Faculty of The Southern Baptist Theological Seminary In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Theology by Elijah Michael Hixson May 2013 APPROVAL SHEET SCRIBAL TENDENCIES IN THE FOURTH GOSPEL IN CODEX ALEXANDRINUS Elijah Michael Hixson Read and Approved by: __________________________________________ Brian J. Vickers (Chair) __________________________________________ John B. Polhill Date______________________________ To my parents, Mike Hixson and Rachel Hayes TABLE OF CONTENTS Page PREFACE . xi Chapter 1. INTRODUCTION TO THE STUDY OF SCRIBAL TENDENCIES IN THE FOURTH GOSPEL IN CODEX ALEXANDRINUS . 1 A Description of Codex Alexandrinus . 1 Content and significance. 1 Name and history . 4 The scribes of Alexandrinus. 6 Kenyon’s five scribes. 7 Milne and Skeat’s two or three scribes . 7 Written by the hand of Thecla the Martyr? . 8 Scribal Habits through Singular Readings: A Short Summary. 9 2. MANUSCRIPT AND METHODOLOGY. 13 The Manuscript. 13 Method for Selecting Singular Readings . 14 Editions used. 14 Nomina sacra and orthography. 16 “Sub-singulars”. 18 Corrections . 18 Classification of Singular Readings . 20 Hernández’s study . 20 Insignificant singulars. 21 iv Chapter Page Significant singulars . 21 Inherited singulars. 22 Summary of classification. 23 Explanation of the Tables Used . 26 3. SINGULAR READINGS IN THE FOURTH GOSPEL IN CODEX ALEXANDRINUS. 29 Insignificant Singulars. 29 Orthographic singulars . -

H 12 Brakelmann Literaturanhang 01-18
Chronologie und zeitgenössische pro- und antisemitische Literatur 1869 – 1914 Erweiterter Literaturanhang zum Heft 12 Perspektiven Evangelische Günter Brakelmann Luther und die Juden Luther, der Protestantismus und der Holocaust Vorträge zum 500. Reformations - gedenken 2017 Evangelische Perspektiven Schriftenreihe der Evangelischen Kirche in Bochum EVANGELISCHE KIRCHE IN BOCHUM Chronologie und zeitgenössische pro- und antisemitische Literatur 1869 – 1914 Erweiterter Literaturanhang zum Heft 12 der Schriftenreihe Evangelische Perspektiven: Günter Brakelmann Luther und die Juden Luther, der Protestantismus und der Holocaust Vorträge zum 500. Reformations gedenken 2017 Günter Brakelmann Luther und die Juden Luther, der Protestantismus und der Holocaust Vorträge zum 500. Reformations gedenken 2017 Herausgegeben von Arno Lohmann, Evangelische Kirche in Bochum 1. Auflage April 2018 Heft 12, 96 Seiten, 5 €, Paperback ISBN 9783752812466 zu beziehen: http://www.stadtakademie.de Chronologie und Literatur Chronologie und zeitgenössische pro- und 1838: Riesser: „Einige Worte über Lessings für die Gesamtinteressen des Judentums“, Denkmal, an die Israeliten Deutschlands Berlin 1869 ff. anti semitische Literatur, 1869 – 1914 gerichtet“; Festrede zum 100-jährigen Oktober: Berliner Tagung der „Alliance Dieses Verzeichnis gibt einen Einblick in die Geschichte des Antisemitismus Geburtstag Schillers Israelite Universelle“. Präsident: Moritz 1840 – 42: Riesser: „Jüdische Briefe“ (u.a. Lazarus; und in die Fülle der Schriften über den Antisemitismus. gegen Bruno Bauer und Prof. Menzel), Festbankett mit Reden von Lazarus, Isaac „Börne und die Juden“ Adolphe Cremieux und Berthold Auer- 1 8 6 9 1816 Fries, S.F.: Gefährdung des Wohl- 1842: Das System der religiösen Anschau- bach (s. Brief vom 15.10.1869) Ereignisse: standes und des Charakters der Teutschen ungen der Juden und sein Verhältnis zu Deutsches Reichsgesetz vom 3. -

Anmerkungen Und Literatur
163 Anmerkungen und Literatur Vorbemerkung: Vor den Anmerkungen zu den einzelnen Vorlesungen ist jeweils eine Auswahl spezieller Literatur zusammengestellt. Auf diese Titel wird in den zugehörigen Anmerkungen mit einem Sternchen (*) verwiesen. Am Schluß steht ein allgemeines Verzeichnis wichtiger Literatur zum Thema »Nietzsches An tike« nebst Angaben zu den Editionen der Werke Nietzsches sowie zu den verwendeten Abkür• zungen und Siglen. 1. Vorlesung Literatur: Quellen: Die Jugendschriften Nietzsches sind bisher am vollständigsten in HKG/W, Bd. 1-3, zugänglich. Die Briefe von und an Nietzsche sind in KGB I und II abgedruckt. Zu Bildungsgeschichte, Bildungsbegriff und -ideologie: Conze, Werner / Kocka, Jürgen (Hgg.): Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert I: Bildungssystem und Professionalisie rung in internationalen Vergleichen, Stuttgart 1985; Haltern, Utz: Bürgerliche Gesell schaft. Sozialtheoretische und sozialhistorische Aspekte, Darmstadt 1988; Jeismann, Karl-Ernst / Lundgren, Peter (Hgg.): Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte III: 1800-1870. Von der Neuordnung Deutschlands bis zur Gründung des Deutschen Rei ches, München 1987; Koselleck, Reinhart (Hg.): Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert II: Bildungsgüter und Bildungswissen, Stuttgart 1990; Landfester, Manfred: Humanis mus und Gesellschaft im 19. Jahrhundert. Untersuchung zur politischen und gesell schaftlichen Bedeutung der humanistischen Bildung in Deutschland, Darmstadt 1988; Lepsius, M. Rainer: Das Bildungsbürgertum als ständische Vergesellschaftung, in: ders. (Hg.), -

Biblical Criticism Terms Defined
SOME BASIC TEXTUAL CRITICISM TERMS DEFINED copyright © 2006/2013 Mr. Gary S. Dykes Despite Epp's observations (in 1974) that TC (Textual Criticism) and interest in it, was on the decline in America, we are seeing an increase in the popularity of the subject. I am of course, referring to the science of Biblical Textual Criticism. In light of the apparent renewed interest amongst the younger scholars, students, and the laity, I find it advantageous to make certain our corporate understanding of some of the basic terms related to the study. Most of the terms below were chosen because they are often misused. For obvious reasons scholars need to precisely and accurately communicate, we need to adhere to a clear standard! Thus I present these basic definitions of a few IMPORTANT terms. The definitions are related specifically to the task of BIBLICAL TC, they are the typical general definitions, a few are enhanced via my personal research. Some other fields of research may modify these definitions. The terms are listed and defined below in this alphabetical order: ARCHETYPE ATRAMENTUM BOOKHANDS and Other Styles CATENAE CLADISTICS CLAREMONT PROFILE METHOD COLOPHON CORONIS CURSIVE DAUGHTER and SISTER DIPLE DOCUMENTARY TEXTS ECLECTIC EKTHESIS (and Eisthesis) EMENDATION/CONJECTURE ENCAUSTUM EXEMPLAR FAMILY GLOSS GOLD INK (and Others) GOLD LEAF HISTORIATED INTERPOLATION KOLLEMATA LEMMA LIGATURE MAAS'S LAW MAQUETTES MISTERY MENOLOGION/SYNAXARION OBELUS QUIRE READING or RENDERING ERRORS RECENSION RECTO and VERSO SCHOLIA SIZING STEMMA TEXT TEXTUAL CRITICISM TEXT-TYPE TRIBE or CLAN UNCIAL Ur-TEXT VERSION WESTERN NON-INTERPOLATIONS ZOOMORPHIC ARCHETYPE Perhaps overused, an "archetype" is the original form of a group of descendants, sometimes seen as the "chief" MS to which other MSS are related or based upon. -

Scribal Habits in Selected New Testament Manuscripts, Including Those with Surviving Exemplars
SCRIBAL HABITS IN SELECTED NEW TESTAMENT MANUSCRIPTS, INCLUDING THOSE WITH SURVIVING EXEMPLARS by ALAN TAYLOR FARNES A thesis submitted to The University of Birmingham for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY Institute for Textual Scholarship and Electronic Editing Department of Theology and Religion College of Arts and Law The University of Birmingham April 2017 University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property rights of the author or third parties in respect of this work are as defined by The Copyright Designs and Patents Act 1988 or as modified by any successor legislation. Any use made of information contained in this thesis/dissertation must be in accordance with that legislation and must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the permission of the copyright holder. Abstract In the first chapter of this work, I provide an introduction to the current discussion of scribal habits. In Chapter Two, I discuss Abschriften—or manuscripts with extant known exemplars—, their history in textual criticism, and how they can be used to elucidate the discussion of scribal habits. I also present a methodology for determining if a manuscript is an Abschrift. In Chapter Three, I analyze P127, which is not an Abschrift, in order that we may become familiar with determining scribal habits by singular readings. Chapters Four through Six present the scribal habits of selected proposed manuscript pairs: 0319 and 0320 as direct copies of 06 (with their Latin counterparts VL76 and VL83 as direct copies of VL75), 205 as a direct copy of 2886, and 821 as a direct copy of 0141. -
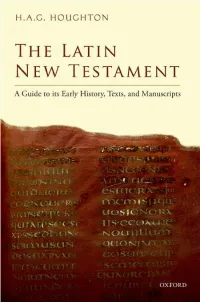
THE LATIN NEW TESTAMENT OUP CORRECTED PROOF – FINAL, 1/12/2015, Spi OUP CORRECTED PROOF – FINAL, 1/12/2015, Spi
OUP CORRECTED PROOF – FINAL, 1/12/2015, SPi THE LATIN NEW TESTAMENT OUP CORRECTED PROOF – FINAL, 1/12/2015, SPi OUP CORRECTED PROOF – FINAL, 1/12/2015, SPi The Latin New Testament A Guide to its Early History, Texts, and Manuscripts H.A.G. HOUGHTON 1 OUP CORRECTED PROOF – FINAL, 14/2/2017, SPi 3 Great Clarendon Street, Oxford, OX2 6DP, United Kingdom Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University’s objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide. Oxford is a registered trade mark of Oxford University Press in the UK and in certain other countries © H.A.G. Houghton 2016 The moral rights of the authors have been asserted First Edition published in 2016 Impression: 1 Some rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, for commercial purposes, without the prior permission in writing of Oxford University Press, or as expressly permitted by law, by licence or under terms agreed with the appropriate reprographics rights organization. This is an open access publication, available online and unless otherwise stated distributed under the terms of a Creative Commons Attribution –Non Commercial –No Derivatives 4.0 International licence (CC BY-NC-ND 4.0), a copy of which is available at http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. Enquiries concerning reproduction outside the scope of the above should be sent to the Rights Department, Oxford University Press, at the address above Published in the United States of America by Oxford University Press 198 Madison Avenue, New York, NY 10016, United States of America British Library Cataloguing in Publication Data Data available Library of Congress Control Number: 2015946703 ISBN 978–0–19–874473–3 Printed in Great Britain by Clays Ltd, St Ives plc Links to third party websites are provided by Oxford in good faith and for information only. -

The Revision Revised by John William Burgon
The Project Gutenberg EBook of The Revision Revised by John William Burgon This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at http://www.gutenberg.org/license Title: The Revision Revised Author: John William Burgon Release Date: July 13, 2011 [Ebook 36722] Language: English ***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK THE REVISION REVISED*** The Revision Revised. Three Articles Reprinted From The “Quarterly Review.” I. The New Greek Text. II. The New English Version. III. Westcott and Hort's New Textual Theory. To Which is Added A Reply to Bishop Ellicott's Pamphlet In Defence Of The Revisers and Their Greek Text of the New Testament: Including a Vindication of the Traditional Reading of 1 Timothy III. 16. By John William Burgon, B.D. Dean of Chichester. “Little children,—Keep yourselves from idols.”—1 John v. 21. Dover Publications, Inc. New York 1971 Contents Dedication. .4 Preface. .7 Article I. The New Greek Text. 27 Article II. The New English Version. 136 Article III. Westcott And Hort's New Textual Theory. 254 Letter To Bishop Ellicott, In Reply To His Pamphlet. 382 Appendix Of Sacred Codices. 530 Index I, of Texts of Scripture,—quoted, discussed, or only referred to in this volume. 542 Index II, of Fathers. 568 Index III, Persons, Places, and Subjects. 577 Footnotes . 613 [Transcriber's Note: This book contains much Greek text, which will not be well-rendered in plain text versions of this E-book. -
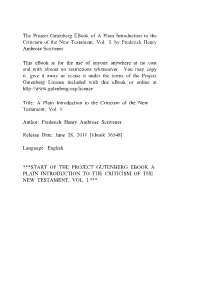
A Plain Introduction to the Criticism of the New Testament, Vol. I. by Frederick Henry Ambrose Scrivener
The Project Gutenberg EBook of A Plain Introduction to the Criticism of the New Testament, Vol. I. by Frederick Henry Ambrose Scrivener This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at http://www.gutenberg.org/license Title: A Plain Introduction to the Criticism of the New Testament, Vol. I. Author: Frederick Henry Ambrose Scrivener Release Date: June 28, 2011 [Ebook 36548] Language: English ***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK A PLAIN INTRODUCTION TO THE CRITICISM OF THE NEW TESTAMENT, VOL. I.*** A Plain Introduction to the Criticism of the New Testament For the Use of Biblical Students By The Late Frederick Henry Ambrose Scrivener M.A., D.C.L., LL.D. Prebendary of Exeter, Vicar of Hendon Fourth Edition, Edited by The Rev. Edward Miller, M.A. Formerly Fellow and Tutor of New College, Oxford Vol. I. George Bell & Sons, York Street, Covent Garden Londo, New York, and Cambridge 1894 Contents Preface To Fourth Edition. .5 Description Of The Contents Of The Lithographed Plates. .9 Addenda Et Corrigenda. 30 Chapter I. Preliminary Considerations. 31 Chapter II. General Character Of The Greek Manuscripts Of The New Testament. 54 Chapter III. Divisions Of The Text, And Other Particulars. 98 Appendix To Chapter III. Synaxarion And Eclogadion Of The Gospels And Apostolic Writings Daily Throughout The Year. 127 Chapter IV. The Larger Uncial Manuscripts Of The Greek Testament. -

A Descriptive Catalogue of the Greek Manuscript Collection of Lambeth Palace Library
A Descriptive Catalogue of the Greek Manuscript Collection of Lambeth Palace Library Christopher Wright, Maria Argyrou and Charalambos Dendrinos Lambeth Palace Library Hellenic Institute Royal Holloway, University of London February 2016 Contents TABLEOFCONTENTS Preface by His Grace Justin Welby, Archbishop of Canterbury ::::::::::::::::::::::: 4 Preface by Mr Anastasios P. Leventis, the A. G. Leventis Foundation ::::::::::::::::: 5 Cataloguing the Greek Manuscripts of Lambeth Palace Library :::::::::::::::::::::: 7 Lambeth Palace Library: a brief history ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 10 Constantinople and Canterbury: contact and collaboration ::::::::::::::::::::::::: 13 Provenance and Sub-Collections ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 19 Notable features of manuscripts in the collection ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 30 List of Abbreviations:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::36 Technical notes and feedback:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::39 Editorial Conventions :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 40 Glossary of Terms Used :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 41 MS. 461 :::::::::::::::::::::::::::: 45 MS. 1194 :::::::::::::::::::::::::: 260 MS. 528 :::::::::::::::::::::::::::: 52 MS. 1195 :::::::::::::::::::::::::: 269 MS. 528 B :::::::::::::::::::::::::: 59 MS. 1196 :::::::::::::::::::::::::: 280 MS. 802 (a–b) ::::::::::::::::::::::: 63 MS. 1197 :::::::::::::::::::::::::: 298 MS. 1175 ::::::::::::::::::::::::::: -

Rethinking the Western Non-Interpolations: a Case for Luke Re-Editing His Gospel
Rethinking the Western Non-interpolations: A Case For Luke Re-editing His Gospel by Giuseppe Capuana BA (Mus), GradDipEd, BTheol (Hons) A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Master of Philosophy University of Divinity 2018 Abstract This thesis presents a new paradigm for understanding the Western non-interpolations. It argues that when Luke originally wrote his Gospel it did not contain 22:19b–20; 24:3b, 6a, 12, 36b, 40, 51b and 52a. However, at a later time, around the time Luke wrote Acts, he returned to his Gospel creating a second edition which contained these readings. My thesis makes the case that the paradigm of scribal interpolation is problematic. Working under this paradigm the results of external and internal evidence appear conflicting and scholars are generally forced to give greater preference to one set of evidence over the other. However, a balanced weighting of the external and internal evidence points us towards the notion that Luke was responsible for both the absence and the inclusion of 22:19b–20; 24:3b, 6a, 12, 36b, 40, 51b and 52a. Chapter one introduces the Western non-interpolations. It also makes the case that the quest for the original text of Luke’s Gospel should not be abandoned. Chapter two is on the history, theory and methodology of the Western non-interpolations. It begins with an overview of the text-critical scholarship emerging during the nineteenth century, particularly the influence of Brooke Foss Westcott and Fenton John Anthony Hort. It also covers the period after Westcott and Hort to the present.