Adobe Photoshop
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Musical Heritage of the Lutheran Church Volume I
The Musical Heritage of the Lutheran Church Volume I Edited by Theodore Hoelty-Nickel Valparaiso, Indiana The greatest contribution of the Lutheran Church to the culture of Western civilization lies in the field of music. Our Lutheran University is therefore particularly happy over the fact that, under the guidance of Professor Theodore Hoelty-Nickel, head of its Department of Music, it has been able to make a definite contribution to the advancement of musical taste in the Lutheran Church of America. The essays of this volume, originally presented at the Seminar in Church Music during the summer of 1944, are an encouraging evidence of the growing appreciation of our unique musical heritage. O. P. Kretzmann The Musical Heritage of the Lutheran Church Volume I Table of Contents Foreword Opening Address -Prof. Theo. Hoelty-Nickel, Valparaiso, Ind. Benefits Derived from a More Scholarly Approach to the Rich Musical and Liturgical Heritage of the Lutheran Church -Prof. Walter E. Buszin, Concordia College, Fort Wayne, Ind. The Chorale—Artistic Weapon of the Lutheran Church -Dr. Hans Rosenwald, Chicago, Ill. Problems Connected with Editing Lutheran Church Music -Prof. Walter E. Buszin The Radio and Our Musical Heritage -Mr. Gerhard Schroth, University of Chicago, Chicago, Ill. Is the Musical Training at Our Synodical Institutions Adequate for the Preserving of Our Musical Heritage? -Dr. Theo. G. Stelzer, Concordia Teachers College, Seward, Nebr. Problems of the Church Organist -Mr. Herbert D. Bruening, St. Luke’s Lutheran Church, Chicago, Ill. Members of the Seminar, 1944 From The Musical Heritage of the Lutheran Church, Volume I (Valparaiso, Ind.: Valparaiso University, 1945). -

Bibliographie Der Literatur Zu Paul Gerhardts Leben, Werk Und Wirkung Zusammengestellt Von Andreas Stegmann Stand: November 2020
Bibliographie der Literatur zu Paul Gerhardts Leben, Werk und Wirkung zusammengestellt von Andreas Stegmann Stand: November 2020 1. Bibliographien und Literaturberichte AMELN, KONRAD: Literaturbericht zur Hymnologie (in: JLH 4, 1958/59, 244–264) [Literatur zum Gerhardt-Jubilä- umsjahr 1957: 248] – : Literaturbericht zur Hymnologie (in: JLH 22, 1978, 231–276) [Literatur zum Gerhardt-Jubiläumsjahr 1976: 238f.] BIBLIOGRAPHIE DER DEUTSCHEN SPRACH- UND LITERATURWISSENSCHAFT 1ff., 1957ff. (für die Jahre seit 1945) DÜNNHAUPT, GERHARD: Personalbibliographien zu den Drucken des Barock. Zweite, verbesserte und wesentlich vermehrte Auflage des Bibliographischen Handbuches der Barockliteratur, dritter Teil, Stuttgart 1991 [zu Gerhardt: 1589–1598] ECKART, RUDOLF: Paul Gerhardt-Bibliographie. Stimmen und Schriften über Paul Gerhardt. Ein Nachklang zum Jubeljahre 1907, Pritzwalk o. J. [1909] FISCHER, ALBERT; TÜMPEL, W.: Das deutsche evangelische Kirchenlied des siebzehnten Jahrhunderts (hg. v. Albert Fischer, vollendet und hg. v. W. Tümpel), Gütersloh 1906 (ND Hildesheim 1964) [zu Gerhardt: Bd. 3, 295– 297] GOEDEKE, KARL: Grundrisz zur Geschichte der deutschen Dichtung aus den Quellen, Bd. 3: Vom dreissigjährigen bis zum siebenjährigen Kriege, Dresden 21887 [zu Gerhardt: 182f.] JAHRESBERICHTE FÜR NEUERE DEUTSCHE LITERATURGESCHICHTE 1–26, 1892–1916 (für die Jahre 1890 bis 1915) [Nach- weise und Berichte zu Gerhardt-Literatur finden sich besonders umfangreich in: Bd. 17/18, 1906/07 (I: 195–198, II: 651–653) und Bd. 19/20, 1908/09 (I: 221, II: 682f.)] JAHRESBERICHTE ÜBER DIE WISSENSCHAFTLICHEN ERSCHEINUNGEN AUF DEM GEBIETE DER DEUTSCHEN LITERATUR 1–16/19, 1924– 1956 (für die Jahre 1921 bis 1939) [JOERDENS]: Art. Paul Gerhardt (in: Lexikon deutscher Dichter und Prosaisten, hg. v. Karl Heinrich Joerdens, Bd. 2, Leipzig 1807, 95–101) [mit Verweisen auf Literatur zu Gerhardt aus dem 18. -

Im Auftrag Der Internationalen Heinrich-Schütz-Gesellschaft E.V. Herausgegeben Von Walter Werbeck in Verbindung Mit Werner Brei
Im Auftrag der Internationalen Heinrich-Schütz-Gesellschaft e.V. herausgegeben von Walter Werbeck in Verbindung mit Werner Breig, Friedhelm Krummacher, Eva Linfield 33. Jahrgang 2011 Bärenreiter Kassel . Basel . London . New York . Praha 2012_schuetz-JB_druck_120531.ind1 1 31.05.2012 10:03:13 Gedruckt mit Unterstützung der Internationalen Heinrich-Schütz-Gesellschaft e.V. und der Landgraf-Moritz-Stiftung Kassel © 2012 Bärenreiter-Verlag Karl Vötterle GmbH & Co. KG, Kassel Alle Rechte vorbehalten / Printed in Germany Layout: ConText, Carola Trabert – [email protected] ISBN 978-3-7618-1689-9 ISSN 0174-2345 2012_schuetz-JB_druck_120531.ind2 2 31.05.2012 10:03:13 Inhalt Vorträge des Schütz-Festes Kassel 2010 Heinrich Schütz und Europa 7 Silke Leopold Heinrich Schütz in Kassel 19 Werner Breig Europa in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts 31 Georg Schmidt Music and Lutherian Devotion in the Schütz Era 41 Mary E. Frandsen »Mein Schall aufs Ewig weist«: Das Jenseits und die Kirchenmusik in der lutherischen Orthodoxie 75 Konrad Küster Medien sozialer Distinktion: Funeral- und Gedenkkompositionen des 17. Jahrhunderts im europäischen Vergleich 91 Peter Schmitz Echos in und um »Daphne« 105 Bettina Varwig Heinrich Schütz und Otto Gibel 119 Andreas Waczkat, Elisa Erbe, Timo Evers, Rhea Richter, Arne zur Nieden Heinrich Schütz as European cultural agent at the Danish courts 129 Bjarke Moe Freie Beiträge Eine unbekannte Trauermusik von Heinrich Schütz 143 Eberhard Möller Heinrich Schütz und seine Brüder: Neue Stammbucheinträge 151 Joshua Rifkin Die Verfasser der Beiträge 168 2012_schuetz-JB_druck_120531.ind3 3 31.05.2012 10:03:13 Abkürzungen ADB Allgemeine deutsche Biographie, München u. Leipzig 1876 – 1912 AfMw Archiv für Musikwissenschaft AmZ Allgemeine musikalische Zeitung Bd., Bde. -

Hymnody of Eastern Pennsylvania German Mennonite Communities: Notenbüchlein (Manuscript Songbooks) from 1780 to 1835
HYMNODY OF EASTERN PENNSYLVANIA GERMAN MENNONITE COMMUNITIES: NOTENBÜCHLEIN (MANUSCRIPT SONGBOOKS) FROM 1780 TO 1835 by Suzanne E. Gross Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of The University of Maryland in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy 1994 Advisory Committee: Professor Howard Serwer, Chairman/Advisor Professor Carol Robertson Professor Richard Wexler Professor Laura Youens Professor Hasia Diner ABSTRACT Title of Dissertation: HYMNODY OF EASTERN PENNSYLVANIA GERMAN MENNONITE COMMUNITIES: NOTENBÜCHLEIN (MANUSCRIPT SONGBOOKS) FROM 1780 TO 1835 Suzanne E. Gross, Doctor of Philosophy, 1994 Dissertation directed by: Dr. Howard Serwer, Professor of Music, Musicology Department, University of Maryland, College Park, Maryland As part of an effort to maintain their German culture, the late eighteenth-century Mennonites of Eastern Pennsylvania instituted hymn-singing instruction in the elementary community schoolhouse curriculum. Beginning in 1780 (or perhaps earlier), much of the hymn-tune repertoire, previously an oral tradition, was recorded in musical notation in manuscript songbooks (Notenbüchlein) compiled by local schoolmasters in Mennonite communities north of Philadelphia. The practice of giving manuscript songbooks to diligent singing students continued until 1835 or later. These manuscript songbooks are the only extant clue to the hymn repertoire and performance practice of these Mennonite communities at the turn of the nineteenth century. By identifying the tunes that recur most frequently, one can determine the core repertoire of the Franconia Mennonites at this time, a repertoire that, on balance, is strongly pietistic in nature. Musically, the Notenbüchlein document the shift that occured when these Mennonite communities incorporated written transmission into their oral tradition. -

Dichtung Und Musik Im Umkreis Der Kürbishütte Frank & Timme
GREIFSWALDER BEITRÄGE ZUR MUSIKWISSENSCHAFT 22 Dichtung und Musik im Umkreis der Kürbishütte Königsberger Poeten und Komponisten des 17. Jahrhunderts Peter Tenhaef / Axel E. Walter (Hg.) Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur Peter Tenhaef / Axel E. Walter (Hg.) Dichtung und Musik im Umkreis der Kürbishütte Greifswalder Beiträge zur Musikwissenschaft, Band 22 Herausgegeben von Martin Loeser, Ekkehard Ochs, Peter Tenhaef, Walter Werbeck, Lutz Winkler Peter Tenhaef / Axel E. Walter (Hg.) Dichtung und Musik im Umkreis der Kürbishütte Königsberger Poeten und Komponisten des 17. Jahrhunderts Verlag für wissenschaftliche Literatur Umschlagabbildung: Titelblatt Heinrich Albert, Musicalische Kürbs-Hütte, Königsberg 1645 ISBN 978-3-7329-0307-8 ISSN 0946-0942 © Frank & Timme GmbH Verlag für wissenschaftliche Literatur Berlin 2016. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts- gesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Herstellung durch Frank & Timme GmbH, Wittelsbacherstraße 27a, 10707 Berlin. Printed in Germany. Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier. www.frank-timme.de Inhaltsverzeichnis Vorwort 7 Fréderíque Renno Peter Hagius – Königsberger Poet und Lehrer Simon Dachs 11 Sigita Barniškienė Isotopien in den Hochzeitsgedichten von Simon Dach 33 MĆra Grudule Simon Dachs Rezeption in der lettischen Kultur – Vom Kirchenlied bis zur sozialen Satire 45 Wladimir Gilmanov Das Geheimnis des Anagramms in der „verborgenen Theologie“ der Barockdichtung (am Beispiel des Königsberger Dichterkreises) 57 Axel E. Walter Christoph Wilkau – „ein unbekannter Auctor“ aus dem Umfeld der Kürbishütte. Mit einer Edition unbekannter Gedichte Simon Dachs 75 Jörg Robert Königsberger Genealogien. -

Lutheran Service Book: Companion to the Hymns
Lutheran Service Book: Companion to the Hymns edited by Joseph Herl, Peter C. Reske, and Jon D. Vieker Quick facts 2,624 pages in two volumes 127 contributing authors 680 biographies, 638 hymn essays, 17 historical and topical essays 3,295 explanatory and source footnotes 2,813 texts, translations, tunes, and settings examined from 1,527 unique primary sources 308 libraries contributed primary sources 564 changed attributions published in December 2019 by Concordia Publishing House biographies separate from hymn essays hymn essays divided into sections for the general reader and for specialists theological commentary for each hymn all essays signed with authors’ names Significant kinds of information included earliest sources of each text, translation, tune, and harmonization, with page numbers date and place of origin for each text and tune historical category of each text and tune religious confession of each text textual changes in LSB from earliest source references to prose translations of foreign-language texts into English references to editions of texts and tunes, commentaries, and other companions original genre of tunes (hymn, folk song, choral music, etc.) origin of tune names statistical bar charts on origins of texts and tunes alternate forms of first lines and tune names performance suggestions, with tempos from 4 sources, plus composers’ tempos when available pronunciation of the names of recent Lutheran authors and composers indexes of individuals by year and by day of birth and death (anniversary -

Inhal! Seite Geschichtliche Einleitung XXIX
Inhal! Seite Geschichtliche Einleitung XXIX Erstes Buch. Alte deutsche Leise 3 Von der Geburt Christi (Gelobet seist du, Jesu Christ) . 3 Off erlieb (Christ ist erstanden) 3 Abendmahl (Gott sei gelobet und gebenedeiet) 4 Von der Himmelfahrt Christi (Christ fuhr gen Himmel) ... 4 Pfingstlied (Nun bitten wir den heiligen Geist) 4 Am Fest der heiligen Dreifaltigkeit (Das helfen uns die Namen drei) 5 O du armer Judas 5 Kreuzleis (In Gottes Namen fahren wir) 5 Veni sancte spiritus (Komm, heiliger Geist, Herre Gott) ... 6 Media vita (Inmitten in des Lebens Zeit) 6 Ymnum dicamus domino (Gott sagen wir Gnade- und Ehrendank) 6 Ave Maria (Ave Maria, ein Ros' ohn alle Dorn) 7 Spervogel (der ältere) . 8 Das Crlösungswerk (Er ist gewaltig und ist stark) .... 8 Hartmann von Aue 9 Kreuzlied (Dem Kreuze ziemet frommer Mut) 9 Walther von der Vogelweide 11 Morgensegen (Mit Segen laß mich heut erstehn) 11 Gott, hilf und vergib (Du hochgelobter Gott, wie selten ich dich Preise) 11 Kreuzigung 1 (Sünder, du sollst der großen Rot bei dir gedenken) 12 Kreuzigung 2 (Der Blinde sprach zu seinem Knechte: „Du sollst kehren") - 12 Der große Sturm (O weh, vernehmt's gewiß, es kommt ein Sturm) 12 Im gelobten Lande (Nun erst leb ich ohne Fährde) .... 13 Gottfried von Straßburg 16 Von der Armut (Kind, und wollte dich das Glück auch meiden) 16 Unbekannter Verfasser 18 Lied von der Gottesminne (Wer Gottes Minne will erjagen) 18 Reinmar von Zweter 22 Gott aller guten Dinge Ursprung (Gott, Ursprung aller guten Ding) 22 Der Marner 22 Sieh nach allen Seiten (Sieh, Sünder, an die Straßen) . -

Bibliografie
Veröffentlichungen: Prof. Dr. Inge Mager 1) Georg Calixts theologische Ethik und ihre Nachwirkungen, SKGNS 19, Göttingen 1969 2) Georg Calixt, Werke in Auswahl, Bd. 3: Ethische Schriften, Göttingen 1970 3) Theologische Promotionen an der Universität Helmstedt im ersten Jahrhundert des Bestehens, JGNKG 69, 1971, 83–102 4) Georg Calixt, Werke in Auswahl, Bd. 4: Schriften zur Eschatologie, Göttingen 1972 5) Conrad Hornejus, NDB 9, 1972, 637f. 6) Lutherische Theologie und aristotelische Philosophie an der Universität Helmstedt im 16. Jahrhundert. Zur Vorgeschichte des Hofmannschen Streites im Jahre 1598, JGNKG 73, 1975, 83–98 7) Bibliographie zur Geschichte der Universität Helmstedt, JGNKG 74, 1976, 237–242 8) Reformatorische Theologie und Reformationsverständnis an der Universität Helmstedt im 16. und 17. Jahrhundert, JGNKG 74, 1976, 11–33 9) Timotheus Kirchner, NDB 11, 1977, 664f. 10) Das Corpus Doctrinae der Stadt Braunschweig im Gefüge der übrigen niedersächsischen Lehrschriftensammlungen, in: Die Reformation in der Stadt Braunschweig. Festschrift 1528–1978, Braunschweig 1978, 111–122.139–143 11) Georg Calixt, Werke in Auswahl, Bd. 1: Einleitung in die Theologie, Göttingen 1978 12) Die Beziehung Herzog Augusts von Braunschweig–Wolfenbüttel zu den Theologen Georg Calixt und Johann Valentin Andreae, in: Pietismus und Neuzeit 6, Göttingen 1980, 76–98 13) Calixtus redivivus oder Spaltung und Versöhnung. Das Hauptwerk des nordfriesischen Theologen Heinrich Hansen und die Gründung der Hochkirchlichen Vereinigung im Jahre 1918, Nordfries. Jb., N.F. 16, 1980, 127–139 14) Aufnahme und Ablehnung des Konkordienbuches in Nord–, Mittel– und Ostdeutschland, in: Bekenntnis und Einheit der Kirche, hrsg. v. M.Brecht u. R.Schwarz, Stuttgart 1980, 271–302 15) Brüderlichkeit und Einheit. -

Contents Humanities Notes
Humanities Notes Humanities Seminar Notes - this draft dated 24 May 2021 - more recent drafts will be found online Contents 1 2007 11 1.1 October . 11 1.1.1 Thucydides (2007-10-01 12:29) ........................ 11 1.1.2 Aristotle’s Politics (2007-10-16 14:36) ..................... 11 1.2 November . 12 1.2.1 Polybius (2007-11-03 09:23) .......................... 12 1.2.2 Cicero and Natural Rights (2007-11-05 14:30) . 12 1.2.3 Pliny and Trajan (2007-11-20 16:30) ...................... 12 1.2.4 Variety is the Spice of Life! (2007-11-21 14:27) . 12 1.2.5 Marcus - or Not (2007-11-25 06:18) ...................... 13 1.2.6 Semitic? (2007-11-26 20:29) .......................... 13 1.2.7 The Empire’s Last Chance (2007-11-26 20:45) . 14 1.3 December . 15 1.3.1 The Effect of the Crusades on European Civilization (2007-12-04 12:21) 15 1.3.2 The Plague (2007-12-04 14:25) ......................... 15 2 2008 17 2.1 January . 17 2.1.1 The Greatest Goth (2008-01-06 19:39) .................... 17 2.1.2 Just Justinian (2008-01-06 19:59) ........................ 17 2.2 February . 18 2.2.1 How Faith Contributes to Society (2008-02-05 09:46) . 18 2.3 March . 18 2.3.1 Adam Smith - Then and Now (2008-03-03 20:04) . 18 2.3.2 William Blake and the Doors (2008-03-27 08:50) . 19 2.3.3 It Must Be True - I Saw It On The History Channel! (2008-03-27 09:33) . -

Chips from a German Workshop. Vol. III. by F
The Project Gutenberg EBook of Chips From A German Workshop. Vol. III. by F. Max Müller This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at http://www.gutenberg.org/license Title: Chips From A German Workshop. Vol. III. Author: F. Max Müller Release Date: September 10, 2008 [Ebook 26572] Language: English ***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK CHIPS FROM A GERMAN WORKSHOP. VOL. III.*** CHIPS FROM A GERMAN WORKSHOP BY F. MAX MÜLLER, M. A., FOREIGN MEMBER OF THE FRENCH INSTITUTE, ETC. VOLUME III. ESSAYS ON LITERATURE, BIOGRAPHY, AND ANTIQUITIES. NEW YORK: CHARLES SCRIBNER AND COMPANY. 1871. Contents DEDICATION. 2 I. GERMAN LITERATURE. 3 LIST OF EXTRACTS FOR ILLUSTRATING THE HISTORY OF GERMAN LITERATURE. 39 II. OLD GERMAN LOVE-SONGS. 48 III. YE SCHYPPE OF FOOLES. 58 IV. LIFE OF SCHILLER. 68 V. WILHELM MÜLLER. 1794-1827. 90 VI. ON THE LANGUAGE AND POETRY OF SCHLESWIG-HOLSTEIN. 108 VII. JOINVILLE. 144 VIII. THE JOURNAL DES SAVANTS AND THE JOUR- NAL DE TRÉVOUX. 179 IX. CHASOT. 187 X. SHAKESPEARE. 200 XI. BACON IN GERMANY. 203 XII. A GERMAN TRAVELLER IN ENGLAND. 217 XIII. CORNISH ANTIQUITIES. 223 XIV. ARE THERE JEWS IN CORNWALL? . 268 XV. THE INSULATION OF ST. MICHAEL'S MOUNT. 294 XVI. BUNSEN. 317 LETTERS FROM BUNSEN TO MAX MÜLLER IN THE YEARS 1848 TO 1859. 360 Footnotes . 485 [i] DEDICATION. TO FRANCIS TURNER PALGRAVE, IN GRATEFUL REMEMBRANCE OF KIND HELP GIVEN TO ME IN MY FIRST ATTEMPTS AT WRITING IN ENGLISH, AND AS A MEMORIAL OF MANY YEARS OF FAITHFUL FRIENDSHIP. -
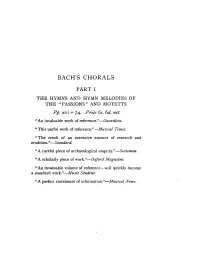
Bach's Chorals Part I
BACH'S CHORALS PART I THE HYMNS AND HYMN MELODIES OF THE "PASSIONS" AND MOTETTS gfl. xvi + 74. Price 6s, 6d. net. "An invaluable work of reference.'_--Guardian. "This useful work of reference. '_--,gu_cal Times. "The result of an extensive amount of research and erudition."--Slandard. "A careful piece of archaeological enquiry."--Scolsman. "A scholarly piece of work."--Oxford MaKazin¢. "An invaluable volume of reference...wdl quickly become a standard work."--3/Zu_c StudenL "A perfect storehouse of information."--Musical ATe_s. PART II THE HYMNS AND HYMN MELODIES OF TIIE CANTATAS AND MOTETTS Pp. xiv+ 615. Price 24s. net. "A monumental and exhaustive study..,a notable contri- bution to musical literature...of permanent value, and hardly likely to be superseded.'--Musical Times. "A perfect encyclopaedia of information on its subject." Yorkshire Post. "Its information is extraordinarily full and comprehen- sive."--Musical News. "This valuable work of reference."--Mthenaeum. "An honour to British scholarship and research." Musical Opinion. "The book is in detail one of which both author and pub- hsher may m every way be proud."-- The Times. "The book must be placed in our bookcases next to Grove."--Music Student. "A work which no student of music on the historical side should be without."--New Statesman. "A real triumph of laboriousness, quite indispensable to the serious student of the subject."--Oxford Magazine. "An admirable and scholarly addition to musical litera- ture. --Cambridge Review. BACH'S CHORALS CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS C. F. CLAY, MANAGZR LONDON : FETTER LANE, E.C.4 NEW YORK THE MACMILLAN CO. CALCUTTA MACMILLAN AND CO.,L'rD. -

Booklet Als PDF-Datei
St. Marien Flensburg Weihnachtsmusik Volume 3 Flensburger Bach-Chor HannaFlensburger Zumsande Bach-ChorConcerto Farinelli Hanna ZumsandeConcertoMatthias Janz Farinelli Auch die dritte Weihnachts-CD des CD (Weihnachtsmusik Vol.2) mit dieser Kantate – wirkte als Organist Flensburger Bach-Chores (Weih- Marc Antoine Charpentiers „Messe und Kirchenmusikdirektor an nachtsmusik Vol.3) ist einem der de Minuit“ (Collegium Vocale des St. Nicolai in Hamburg. beliebten, immer am 4. Advent Flensburger Bach-Chores und Con- in der Flensburger Marien-Kirche certo Farinelli) französische Weih- Dietrich Buxtehude war zunächst stattfindenden Weihnachtskonzerte nachtsmusik aus dem 17. Jahrhun- Organist an St. Marien in Helsingør, nachempfunden. dert, so erklingen auf der dritten CD bevor er von 1668 bis 1707 an Neben vielen, immer wieder neu Weihnachtskantaten norddeutscher St. Marien in Lübeck das in der zusammengestellten Advents- und Meister aus dem 16. und 17. Jahr- damaligen Zeit bedeutendste Orga- Weihnachtsliedern wird in jedem hundert. nistenamt bekleidete. Jahr eine andere Facette weihnacht- Man kann sich gut vorstellen, dass nachtslied „In dulci jubilo“ – in der licher Musik präsentiert: Eine besondere Beziehung zu Flens- die drei, auf dieser CD vorgestellten damals üblichen lateinisch-deutschen brachte die erste CD (Weihnachts- burg ergibt sich durch die Kantate Kantaten erstmals an einem Advents- Version – spielen die beiden Violinen musik Vol.1) mit Benjamin Brittens „Willkommen, süßer Bräutigam“, sonntag in St. Marien Lübeck in einer in Vers 4 Oberstimmen, die den „A Ceremony of Carols“ (Jugend- war doch Vincent Lübeck der Ältere der berühmten, von Franz Tunder vertonten Text „da die Engel singen kammerchor des Flensburger Bach- von 1647 bis 1654 Organist an begründeten „Abendmusiken“ er- und die Schellen (Glöckchen) klin- Chores) englische Weihnachts musik St.