Dipl Loma Arbe
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Wirtschaft Und Kultur Schriftenreihe Des Forschungsbereiches
Wirtschaft und Kultur Schriftenreihe des Forschungsbereiches No. 7 2006 Lebensläufe österreichischer Chefredakteure Eine Ressourcenanalyse nach Pierre Bourdieu Louise Beltzung Axel Kittenberger Susanne Mayer Hg. Johanna Hofbauer, Elfie Miklautz, Gertraude Mikl-Horke, Andreas Resch Institut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte & Institut für Soziologie und empirische Sozialforschung, Wirtschaftsuniversität Wien ©2006 Forschungsbericht aus der Integrierten Projektveranstaltung Creative Industries im Rahmen des Studiums der Sozioökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien unter der Leitung von Ass.Prof.Dr. Elfie Miklautz und a.o.Univ.Prof.Dr. Andreas Reschx Studienjahr 2004/05 Institut für Soziologie und empirische Sozialforschung www.wu-wien.ac.at/sozio Institut für Sozial- und Wirtschaftsgeschicht www.wu-wien.ac.at/geschichte Kurzangaben zu den Autoren: Louise Beltzung (1985) studiert seit 2003 Sozioökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien mit der Spezialisierung Internationale Wirtschaft und Entwicklung. Seit 2002 ist sie Mitarbeiterin des Standard, derzeit leitet sie das Ressort Uni und Schule. Email: [email protected] Axel Kittenberger (1977) studiert nach vierjähriger, hauptberuflicher Tätigkeit als Softwareentwicklicker seit 2003 Sozioökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien mit der Spezialisierung Verhaltenswissenschaftlichorientiertes Management. Email: [email protected] Homepage: www.kittenberger.net Susanne Mayer (1983), gebürtige Vorarlbergin, arbeitete nach Abschluss der Handelsakademie Feldkrich ein halbes -
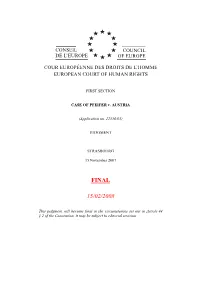
Final 15/02/2008
CONSEIL COUNCIL DE L’EUROPE OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS FIRST SECTION CASE OF PFEIFER v. AUSTRIA (Application no. 12556/03) JUDGMENT STRASBOURG 15 November 2007 FINAL 15/02/2008 This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision. PFEIFER v. AUSTRIA JUDGMENT 1 In the case of Pfeifer v. Austria, The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of: Mr L. LOUCAIDES, President, Mrs N. VAJIĆ, Mr A. KOVLER, Mr K. HAJIYEV, Mr D. SPIELMANN, Mr S.E. JEBENS, judges, Mr H. SCHÄFFER, ad hoc judge, and Mr S. NIELSEN, Section Registrar, Having deliberated in private on 18 October 2007, Delivers the following judgment, which was adopted on that date: PROCEDURE 1. The case originated in an application (no. 12556/03) against the Republic of Austria lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by an Austrian national, Mr Karl Pfeifer (“the applicant”), on 7 April 2003. 2. The applicant was represented by Lansky, Ganzger and Partners, lawyers practising in Vienna. The Austrian Government (“the Government”) were represented by their Agent, Ambassador F. Trauttmansdorff, Head of the International Law Department at the Federal Ministry of Foreign Affairs. 3. The applicant alleged that the Austrian courts had failed to protect his reputation against defamatory allegations made in a magazine. 4. The application was allocated to the First Section of the Court (Rule 52 § 1 of the Rules of Court). -

Antisemitismus in Österreich Beschäftigt
Zwischen Kontinuität und Transformation – Antisemitismus im gegenwärtigen medialen Diskurs Österreichs von Klaus Hödl/Gerald Lamprecht (Graz) erschienen in: Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte XXXIII (2005), Antisemitismus, Antizionismus, Israelkritik, Göttingen 2005, 140-159. Der Bericht der EU-Beobachtungsstelle für Rassismus und Fremdenfeindlichkeit (EUMC) über Antisemitismus in Europa stellt Österreich, zumindest im Vergleich zu anderen europäischen Staaten, ein »relativ akzeptables« Zeugnis aus. Im Gegensatz vor allem zu Frankreich, den Niederlanden oder auch Großbritannien scheint es in Österreich für Juden sicherer zu sein – das Risiko, tätlich angegriffen zu werden, nimmt sich für sie geringer aus.1 Auch wenn der Präsident der Wiener Israelitischen Kultusgemeinde, Ariel Muzicant, zu Beginn des Jahres 2004 anläßlich einer Tagung des Europäischen Jüdischen Kongresses in Jerusalem kundtat, daß seine Kinder Österreich verlassen hätten, weil sie den Stress, in diesem Land Juden zu sein, nicht länger ertragen hätten,2 und in einem Zeitungsinterview darauf hinwies, daß Juden auch in Wien gewalttätigen Übergriffen ausgesetzt seien, so steht für ihn gleichfalls fest, daß physische Gewalt in anderen Ländern häufiger vorkomme als in Österreich.3 Dieser Umstand macht das Land zwar noch zu keiner Vorzeigegesellschaft und soll auch nicht zur Relativierung antisemitischer Zwischenfälle herangezogen werden. Doch kann er als wichtiger Indikator für eine Standortbestimmung dienen, wenn man sich mit dem Phänomen des Antisemitismus in Österreich beschäftigt. Die Beobachtung, daß sich der österreichische Antisemitismus durch eine geringe Gewaltbereitschaft auszeichnet, impliziert nicht, daß er dadurch vernachlässigbar sei.4 Bereits 1 Werner Bergmann/Juliane Wetzel, Manifestations of anti-Semitism in the European Union – First Semester 2002, Synthesis Report, Wien und Berlin 2003, 84-89; nur online verfügbar als »Draft 20 February 2003« u.a. -

British Imperialism in Books from the “Third Reich”
Empire and National Character: British Imperialism in Books from the “Third Reich” Victoria Jane Stiles, MA, MA Thesis submitted to the University of Nottingham for the degree of Doctor of Philosophy July 2015 Abstract This thesis examines the variety of representations and rhetorical deployments of the theme of British Imperialism within books published in the “Third Reich”. The thesis considers these books not only as vehicles for particular ideas and arguments but also as consumer objects and therefore as the product of a series of compromises between the needs of a host of actors, both official and commercial. It further traces the origins of the component parts of these texts via the history of reuse of images and extracts and by identifying earlier examples of particular tropes of “Englishness” and the British Empire. British imperial history was a rich source of material for National Socialist writers and educators to draw on and lent itself to a wide variety of arguments. Britain could be, in turns, a symbol of “Nordic” strength, a civilisation in decline, a natural ally and protector of Germany, or a weak, corrupt, outdated entity, controlled by Germany’s supposed enemies. Drawing on a long tradition of comparing European colonial records, the British Empire was also used as a benchmark for Germany’s former imperial achievements, particularly in moral arguments regarding the treatment of indigenous populations. Through its focus on books, which were less ephemeral than media such as newspaper and magazine articles, radio broadcasts or newsreels, the thesis demonstrates how newer writings sought to recontextualise older material in the light of changing circumstances. -

Wissenschaftsbericht Der Stadt Wien 2005 Teil 1
WISSENSCHAFTSBERICHT DER STADT WIEN 2005 WISSENSCHAFTSBERICHT DER STADT WIEN 2005 HERAUSGEGEBEN VON DER GESCHÄFTSGRUPPE KULTUR UND WISSENSCHAFT DER STADT WIEN AMTSFÜHRENDER STADTRAT FÜR KULTUR UND WISSENSCHAFT DR. ANDREAS MAILATH-POKORNY ©c 2006 Magistrat der Stadt Wien Für den Inhalt verantwortlich: Hubert Christian Ehalt, Gesamtkonzept und -redaktion Heidi Kadensky, Manuela Karlik, Angelika Lantzberg, Susanne Strobl, Daniela Svatek Dokumentation und Redaktion der Wissenschaftsförderungstätigkeit der MA 7, der Fonds, der Veranstaltungstätigkeit und der anderen Beiträge des Berichts MA 5: Richard Neidinger, Andreas Weigl MA 8: Ferdinand Opll, Karl Fischer MA 9: Sylvia Mattl-Wurm MA 18: Thomas Madreiter, Georg Fellner MA 19: Josef Matousek, Peter Scheuchel MA 22: Karin Büchl-Krammerstätter, Herbert Sturm MA 27: Thomas Weninger, Christian Wurm MA 31: Hans Sailer, Wolfgang Zerobin MA 38: Maria Safer, Stefan Chloupek MA 39: Werner Fleck, Georg Pommer, Nikolaus Thiemann MA 45: Walter Redl, Andreas Romanek, Gehard Nagel, Ulrike Goldschmid MA 48: Josef Thon, Wojciech Rogalski MA 49: Andreas Januskovecz, Bernhard Kromp (Bio Forschung Austria), Andreas Schwab MA 57: Karin Spacek MD-Klimaschutzkoordinationsstelle: Christine Fohler-Norek dieSie/Wiener Programm für Frauengesundheit: Beate Wimmer-Puchinger WienMuseum: Wolfgang Kos WWTF: Michael Stampfer, Klaus Zinöcker ZIT: Edeltraud Stiftinger departure: Norbert Kettner, Heinz Wolf Jüdisches Museum: Alfred Stalzer Die Projekte und Aktivitäten werden unter Verwendung der Selbstdarstellungen der Projektträger (Abstracts, Projektberichte, Homepage) dargestellt. Layout: Ulrich Gansert Coverfoto: Pez Hejduk Neugestaltung der Dauerausstellung des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes ©c Fotos Seiten 7-10: Kurt Keinrath (Bgm. Dr. Häupl) Peter Rigaud (Vizebgm. Dr. Rieder, StadträtInnen Mag.a Brauner, Dr. Mailath-Pokorny, Mag.a Wehsely) Hawlicek (Vizebgm. Laska) Agentur Votava (Stadtrat Faymann) Petra Spiola (Stadtrat Dipl.-Ing. -

Hungary and the Holocaust Confrontation with the Past
UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM CENTER FOR ADVANCED HOLOCAUST STUDIES Hungary and the Holocaust Confrontation with the Past Symposium Proceedings W A S H I N G T O N , D. C. Hungary and the Holocaust Confrontation with the Past Symposium Proceedings CENTER FOR ADVANCED HOLOCAUST STUDIES UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM 2001 The assertions, opinions, and conclusions in this occasional paper are those of the authors. They do not necessarily reflect those of the United States Holocaust Memorial Council or of the United States Holocaust Memorial Museum. Third printing, March 2004 Copyright © 2001 by Rabbi Laszlo Berkowits, assigned to the United States Holocaust Memorial Museum; Copyright © 2001 by Randolph L. Braham, assigned to the United States Holocaust Memorial Museum; Copyright © 2001 by Tim Cole, assigned to the United States Holocaust Memorial Museum; Copyright © 2001 by István Deák, assigned to the United States Holocaust Memorial Museum; Copyright © 2001 by Eva Hevesi Ehrlich, assigned to the United States Holocaust Memorial Museum; Copyright © 2001 by Charles Fenyvesi; Copyright © 2001 by Paul Hanebrink, assigned to the United States Holocaust Memorial Museum; Copyright © 2001 by Albert Lichtmann, assigned to the United States Holocaust Memorial Museum; Copyright © 2001 by George S. Pick, assigned to the United States Holocaust Memorial Museum In Charles Fenyvesi's contribution “The World that Was Lost,” four stanzas from Czeslaw Milosz's poem “Dedication” are reprinted with the permission of the author. Contents -

Pfeifer V Austria ECHR 15 Nov 2007
CONSEIL COUNCIL DE L’EUROPE OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS FIRST SECTION CASE OF PFEIFER v. AUSTRIA (Application no. 12556/03) JUDGMENT STRASBOURG 15 November 2007 This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision. PFEIFER v. AUSTRIA JUDGMENT 1 In the case of Pfeifer v. Austria, The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of: Mr L. LOUCAIDES, President, Mrs N. VAJIĆ, Mr A. KOVLER, Mr K. HAJIYEV, Mr D. SPIELMANN, Mr S.E. JEBENS, judges, Mr H. SCHÄFFER, ad hoc judge, and Mr S. NIELSEN, Section Registrar, Having deliberated in private on 18 October 2007, Delivers the following judgment, which was adopted on that date: PROCEDURE 1. The case originated in an application (no. 12556/03) against the Republic of Austria lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by an Austrian national, Mr Karl Pfeifer (“the applicant”), on 7 April 2003. 2. The applicant was represented by Lansky, Ganzger and Partners, lawyers practising in Vienna. The Austrian Government (“the Government”) were represented by their Agent, Ambassador F. Trauttmansdorff, Head of the International Law Department at the Federal Ministry of Foreign Affairs. 3. The applicant alleged that the Austrian courts had failed to protect his reputation against defamatory allegations made in a magazine. 4. The application was allocated to the First Section of the Court (Rule 52 § 1 of the Rules of Court). -

The Catholic Church and the Holocaust, 1930–1965 Ii Introduction Introduction Iii
Introduction i The Catholic Church and the Holocaust, 1930–1965 ii Introduction Introduction iii The Catholic Church and the Holocaust, 1930 –1965 Michael Phayer INDIANA UNIVERSITY PRESS Bloomington and Indianapolis iv Introduction This book is a publication of Indiana University Press 601 North Morton Street Bloomington, IN 47404-3797 USA http://www.indiana.edu/~iupress Telephone orders 800-842-6796 Fax orders 812-855-7931 Orders by e-mail [email protected] © 2000 by John Michael Phayer All rights reserved No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and re- cording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher. The Association of Ameri- can University Presses’ Resolution on Permissions constitutes the only exception to this prohibition. The paper used in this publication meets the minimum requirements of American National Standard for Information Sciences—Perma- nence of Paper for Printed Library Materials, ANSI Z39.48-1984. Manufactured in the United States of America Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Phayer, Michael, date. The Catholic Church and the Holocaust, 1930–1965 / Michael Phayer. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 0-253-33725-9 (alk. paper) 1. Pius XII, Pope, 1876–1958—Relations with Jews. 2. Judaism —Relations—Catholic Church. 3. Catholic Church—Relations— Judaism. 4. Holocaust, Jewish (1939–1945) 5. World War, 1939– 1945—Religious aspects—Catholic Church. 6. Christianity and an- tisemitism—History—20th century. I. Title. BX1378 .P49 2000 282'.09'044—dc21 99-087415 ISBN 0-253-21471-8 (pbk.) 2 3 4 5 6 05 04 03 02 01 Introduction v C O N T E N T S Acknowledgments ix Introduction xi 1. -
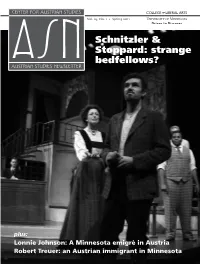
Spring 11 03-07-11.Indd
CENTER FOR AUSTRIAN STUDIES Vol. 23, No. 1 • Spring 2011 Schnitzler & Stoppard: strange bedfellows? ASNAUSTRIAN STUDIES NEWSLETTER plus: Lonnie Johnson: A Minnesota emigrè in Austria Robert Treuer: an Austrian immigrant in Minnesota ASN/TOC Letter from the Director 3 Minnesota Calendar 3 News from the Center: Teachers’ Workshop 4 Of Schnitzler & Stoppard 6 ASN Interview: Lonnie Johnson 8 Anton Treuer: An Austrian in Minnesota 8 Opportunities for Giving 13 Publications: News and Reviews 14 Hot off the Presses 17 News from the Field: Stanley Winters 18 SAHH News 18 Report from New Orleans 19 News from the North 20 CAS Interview: Barbara Spreitzer 22 Writing a Central European Family History 24 Salzburg 2011 Preview 25 Announcements 26 Franz Rössler, Austrian Trade Commisioner, Chicago, presents former CAS director Gary Cohen with a Certificate of Recognition at the 2010 Kann Memo- rial Lecture. Photo: Daniel Pinkerton. CORRECTIONS In the interview “Ambassador Christian Prosl: Around the world in 65 years,” ASN mistakes in transcription and editing resulted in errors. They are listed below Austrian Studies Newsletter with the appropriate corrections by Ambassador Prosl. Volume 23, No. 1 • Spring 2011 1. p. 22, first answer, col.1, line 11: Figl instead of Fiegl 2. p. 22, second answer, col. 1, last line: “Vienna was in the French zone.” Designed & edited by Daniel Pinkerton It shoud read as follows: “Vienna was in the Russian zone, but was itself Editorial Assistants: Linda Andrean, Katie Evans, Mollie Madden, divided into four zones (with the first district being under joint command Ed Snyder by the 4 allies). We lived in the French zone of Vienna, in the Western part of the city.” ASN is published twice annually, in February and September, and 3. -

Lcjlllf EQSG/CENIRAL
UNITED NATIONS NATIONS UNIES POSTAL ADDRESS ADRESSE POSTALE: UNITED NATIONS. N.Y. 1OOIT CABLE ADDRESS ADRESSE TELEGRAPH IOUE: UNAT1ONS NEWYOKK EXECUTIVE OFFICE OF THE SECRETARY-GENERAL CABINET DU SECRETAIRE GENERAL 12 January 1998 REFERENCE: Dear Mr. janitschek, On behalf of the Secretary-General, I am writing in reply to your letter of 16 December 1997 (received on 2 January). The Secretary-General is grateful for your offer of services as a speech-writer. Indeed, we are in the final stages of our search for someone to head the speechwriting unit. However, the Secretary-General is seeking an individual to serve as a staff member, which would disqualify anyone who has retired from service with the Organization. He does appreciate your interest, however, and your offer will be kept in mind should our needs change. With my best wishes,/^ <x LCJLLLf Yours sincerely, JWM3B98 EQSG/CENIRAL /^-O^ Shashi Tharoor Executive Assistant to the Secretary-General Mr. Hans Janitschek 945 Fifth Ave., Suite 18B New York, NY 10021 JANITSCHEK ASSOCIATES jsfT.iHScrjsiSi- •>' "M**"'--*..-*- -. -- — Q 11 IB B lilj f ~F[TOFFiCE Dear r Secretary General, I just watched you? talk with Charlie Rose on Channel 13- and want to congratulate you on how you handled it. I have never s^en a Secretary General of the United Nations ta^k with such authority, quiet charm and frankness before. I think you have found the right way to communicate effectively without offending any of the' powers that be. F -mnd-erstand that you are looking for help with speechrwrittldg, -,. - Iw ould be honoured - ss a lifelong journalist- to be considered and would proudly serve you on an krnorsry basis. -

Luciana Fazio Supervisors: Maria Elena Cavallaro Giovanni Orsina
1 The Socialist International and the Design of a Community Policy in Latin America During the Late 1970s and 1980s: The Case of Spain and Italy Luciana Fazio Supervisors: Maria Elena Cavallaro Giovanni Orsina LUISS-Guido Carli PhD Program in Politics: History, Theory, Science Cycle XXXII Rome, November 2019 Tesi di dottorato di Luciana Fazio, discussa presso l’Università LUISS, in data 2020. Liberamente riproducibile, in tutto o in parte, con citazione della fonte. Sono comunque fatti salvi i diritti dell’Università LUISS di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte. 2 Tesi di dottorato di Luciana Fazio, discussa presso l’Università LUISS, in data 2020. Liberamente riproducibile, in tutto o in parte, con citazione della fonte. Sono comunque fatti salvi i diritti dell’Università LUISS di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte. 3 Acknowledgements I am truly grateful to my supervisors Maria Elena Cavallaro and Giovanni Orsina for their insights and comments to write this thesis. I especially thank all my PhD professors and academics for their support during this process, especially for their advice in terms of literature review and time availability for helping me facing some questions that raised during this process. Special thanks to Professor Joaquin Roy for his support, kindness and hospitality during my visiting exchange program at the University of Miami. Many thanks to the interviewed people (Elena Flores, Luis Yáñez-Barnuevo, Manuel Medina, Beatrice Rangel, Silvio Prado, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, Margherita Boniver, Walter Marossi, Pentti Väänänen, Carlos Parra) for their much needed help to fill the gaps in terms of sources. -

Seit Zehn Jahren Der Euro
Unabhängiges Magazin 2 | 2008 der Österreichischen Liga für die Vereinten Nationen und des Akademischen Forums für Außenpolitik 3 EURO SeitSeit zehnzehn JahrenJahren DerDer EuroEuro DVR: 0875538 Nr.2/2008; ISSN: 1992-9889 GLOBAL VIEW is grateful for the support of: Liebe Leserin! Lieber Leser! ie Weltbank ist eine der wichtigsten Hauptak- schwach gegenüber dem Dollar, hat der Euro die Dteurinnen bei der Bekämpfung der Armut. Für amerikanische Währung mittlerweile überholt. Robert B. Zoellick, den Präsidenten der Weltbank, ist aber vor allen Dingen wichtig, dass Globalisierung Mit der Wahl zu einem neuen zypriotischen Präsi- auf einer nachhaltigen Ebene stattfindet. Dafür es- denten scheint ein neues Kapital im jahrzehntelan- sentiell ist der Privatsektor. gen Streit des griechischen und des türkischen Teils der Mittelmeerinsel geschrieben zu werden. Aller- Die Arktis wird immer mehr zu einem umstrittenen dings gab es in Vergangenheit schon mehrmals ei- Gebiet. Ziel ist es, bei immer weniger werdendem nen unerfüllten Grund zur Hoffnung. Eis, an die reichhaltigen Bodenschätze und Rohstoff- vorkommen zu gelangen. Dabei konkurrieren eine Derweil nutzen terroristische Gruppen und Rebel- Reihe von Anrainerstaaten wie Russland und Kana- lengruppen immer mehr den Handel mit gefährde- da. Die Beanspruchung des Meeresbodens bis zur ten Tierarten, um ihre Kriege zu finanzieren. Das Ge- Tiefseeebene spielt dabei eine wesentliche Rolle. schäft mit Elfenbein und Tierfellen ist mittlerweile zum Big Business geworden und die Erträge bewe- Der Euro wird zehn. Manchen kommt es vor, als gen sich in einigen Millionen Euro Höhe. wäre es gestern gewesen. Aber nein, der Euro feiert heuer seinen 10. Geburtstag. In den Händen haben wir ihn aber erst seit 2002.