Managementplan Für Das FFH-Gebiet Löcknitztal
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Liste Rouge Papillons Diurnes Et Zygènes
2014 > L’environnement pratique > Listes rouges / Gestion des espèces > Liste rouge Papillons diurnes et Zygènes Papilionoidea, Hesperioidea et Zygaenidae. Espèces menacées en Suisse, état 2012 > L’environnement pratique > Listes rouges / Gestion des espèces > Liste rouge Papillons diurnes et Zygènes Papilionoidea, Hesperioidea et Zygaenidae. Espèces menacées en Suisse, état 2012 Publié par l’Office fédéral de l’environnement OFEV et par le Centre suisse de cartographie de la faune CSCF Berne, 2014 Valeur juridique Impressum Liste rouge de l’OFEV au sens de l’art. 14, al. 3, de l’ordonnance Editeurs du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage Office fédéral de l’environnement (OFEV) du Département fédéral de (OPN; RS 451.1), www.admin.ch/ch/f/rs/45.html l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), Berne; La présente publication est une aide à l’exécution de l’OFEV en tant Centre Suisse de Cartographie de la Faune (CSCF), Neuchâtel. qu’autorité de surveillance. Destinée en premier lieu aux autorités d’exécution, elle concrétise des notions juridiques indéterminées Auteurs provenant de lois et d’ordonnances et favorise ainsi une application Emmanuel Wermeille, Yannick Chittaro et Yves Gonseth uniforme de la législation. Elle aide les autorités d’exécution avec la collaboration de Stefan Birrer, Goran Dušej, Raymond Guenin, notamment à évaluer si un biotope doit être considéré comme digne Bernhard Jost, Nicola Patocchi, Jerôme Pellet, Jürg Schmid, Peter de protection (art. 14, al. 3, let. d, OPN). Sonderegger, Peter Weidmann, Hans-Peter Wymann et Heiner Ziegler. Accompagnement à l’OFEV Francis Cordillot, division Espèces, écosystèmes, paysages Référence bibliographique Wermeille E., Chittaro Y., Gonseth Y. -
![ZYGMO] (Kimura 2 Parameter, COI-5P, Length > 550)](https://docslib.b-cdn.net/cover/1205/zygmo-kimura-2-parameter-coi-5p-length-550-21205.webp)
ZYGMO] (Kimura 2 Parameter, COI-5P, Length > 550)
Supplement 2. BOLD TaxonID Tree: DNA barcoding of Zygaenidae moths [ZYGMO] (Kimura 2 Parameter, COI-5P, Length > 550). 2 % Sthenoprocris brondeli|Female|Madagascar Harrisina coracina|Male|Mexico.Veracruz Harrisina metallica|Female|United States.New Mexico Harrisina metallica|Male|United States.California Harrisina metallica|Male|United States.Arizona Harrisina metallica|Male|United States.California Harrisina metallica|Male|United States.Arizona Harrisina metallica|Male|United States.Arizona Harrisina metallica|Male|United States.Arizona Harrisina metallica|Male|United States.Arizona Astyloneura assimilis|Female|Democratic Republic of the Congo Astyloneura sp.|Male|Burundi Syringura triplex|Male|Cameroon Saliunca orphnina|Male|Rwanda Saliunca orphnina|Female|Rwanda Saliunca styx|Female|Democratic Republic of the Congo.Bas-Congo Saliunca styx|Female|Kenya Saliunca styx|Male|Kenya Saliunca styx|Male|Cameroon Saliunca styx|Male|Cameroon Saliunca meruana|Male|Tanzania Tascia finalis|Female|Zimbabwe Aethioprocris togoensis|Male|Ghana.Central Chalconycles sp. 01|Female|Africa Onceropyga anelia|Female|Australia.Queensland Onceropyga anelia|Male|Australia.Queensland Onceropyga anelia|Female|Australia.Queensland Onceropyga anelia|Female|Australia.Queensland Pseudoamuria neglecta|Female|Australia.Queensland Pseudoprocris dolosa|Female|Guatemala.Chimaltenango Pseudoprocris dolosa|Male|Guatemala.Chimaltenango Pseudoprocris gracilis|Male|Guatemala.Chimaltenango Corma maculata|Male|Myanmar.Sagaing Corma maculata|Male|Myanmar.Sagaing Cyclosia panthona|Male|Thailand.Sakon Nakhon Cyclosia panthona|Male|Thailand.Sakon Nakhon Cyclosia panthona|Female|Myanmar.Sagaing Cyclosia panthona|Female|China.Yunnan Cyclosia papilionaris|Female|Myanmar.Sagaing Cyclosia papilionaris|Male|Thailand.Sakon Nakhon Cyclosia papilionaris|Female|Myanmar.Sagaing Cyclosia papilionaris|Female|Myanmar.Sagaing Cyclosia papilionaris|Female|Myanmar.Sagaing Artona sp. 1|Male|Thailand.Chiang Mai Artona sp. 1|Female|Thailand.Chiang Mai Alteramenelikia sp. 1|Female|Ghana.Greater Accra Alteramenelikia sp. -

Révision Taxinomique Et Nomenclaturale Des Rhopalocera Et Des Zygaenidae De France Métropolitaine
Direction de la Recherche, de l’Expertise et de la Valorisation Direction Déléguée au Développement Durable, à la Conservation de la Nature et à l’Expertise Service du Patrimoine Naturel Dupont P, Luquet G. Chr., Demerges D., Drouet E. Révision taxinomique et nomenclaturale des Rhopalocera et des Zygaenidae de France métropolitaine. Conséquences sur l’acquisition et la gestion des données d’inventaire. Rapport SPN 2013 - 19 (Septembre 2013) Dupont (Pascal), Demerges (David), Drouet (Eric) et Luquet (Gérard Chr.). 2013. Révision systématique, taxinomique et nomenclaturale des Rhopalocera et des Zygaenidae de France métropolitaine. Conséquences sur l’acquisition et la gestion des données d’inventaire. Rapport MMNHN-SPN 2013 - 19, 201 p. Résumé : Les études de phylogénie moléculaire sur les Lépidoptères Rhopalocères et Zygènes sont de plus en plus nombreuses ces dernières années modifiant la systématique et la taxinomie de ces deux groupes. Une mise à jour complète est réalisée dans ce travail. Un cadre décisionnel a été élaboré pour les niveaux spécifiques et infra-spécifique avec une approche intégrative de la taxinomie. Ce cadre intégre notamment un aspect biogéographique en tenant compte des zones-refuges potentielles pour les espèces au cours du dernier maximum glaciaire. Cette démarche permet d’avoir une approche homogène pour le classement des taxa aux niveaux spécifiques et infra-spécifiques. Les conséquences pour l’acquisition des données dans le cadre d’un inventaire national sont développées. Summary : Studies on molecular phylogenies of Butterflies and Burnets have been increasingly frequent in the recent years, changing the systematics and taxonomy of these two groups. A full update has been performed in this work. -

Rote Liste Der Tagfalter Und Widderchen
2014 > Umwelt-Vollzug > Rote Listen / Artenmanagement > Rote Liste der Tagfalter und Widderchen Papilionoidea, Hesperioidea und Zygaenidae. Gefährdete Arten der Schweiz, Stand 2012 > Umwelt-Vollzug > Rote Listen / Artenmanagement > Rote Liste der Tagfalter und Widderchen Papilionoidea, Hesperioidea und Zygaenidae. Gefährdete Arten der Schweiz, Stand 2012 Herausgegeben von Bundesamt für Umwelt BAFU und Schweizer Zentrum für die Kartografie der Fauna SZKF/CSCF Bern, 2014 Rechtlicher Stellenwert dieser Publikation Impressum Rote Liste des BAFU im Sinne von Artikel 14 Absatz 3 der Verordnung Herausgeber vom 16. Januar 1991 über den Natur- und Heimatschutz (NHV; Bundesamt für Umwelt (BAFU) des Eidg. Departements für Umwelt, SR 451.1) www.admin.ch/ch/d/sr/45.html Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), Bern. Schweizerisches Zentrum für die Kartografie der Fauna (SZKF/CSCF), Diese Publikation ist eine Vollzugshilfe des BAFU als Aufsichtsbehörde Neuenburg. und richtet sich primär an die Vollzugsbehörden. Sie konkretisiert unbestimmte Rechtsbegriffe von Gesetzen und Verordnungen und soll Autoren eine einheitliche Vollzugspraxis fördern. Sie dient den Vollzugsbehör- Emmanuel Wermeille, Yannick Chittaro und Yves Gonseth den insbesondere dazu, zu beurteilen, ob Biotope als schützenswert in Zusammenarbeit mit Stefan Birrer, Goran Dušej, Raymond Guenin, zu bezeichnen sind (Art. 14 Abs. 3 Bst. d NHV). Bernhard Jost, Nicola Patocchi, Jerôme Pellet, Jürg Schmid, Peter Sonderegger, Peter Weidmann, Hans-Peter Wymann und Heiner Ziegler. Begleitung BAFU Francis Cordillot, Abteilung Arten, Ökosysteme, Landschaften Zitierung Wermeille E., Chittaro Y., Gonseth Y. 2014: Rote Liste Tagfalter und Widderchen. Gefährdete Arten der Schweiz, Stand 2012. Bundesamt für Umwelt, Bern, und Schweizer Zentrum für die Kartografie der Fauna, Neuenburg. Umwelt-Vollzug Nr. 1403: 97 S. -

Wasserwe3ten Fyer.Indd
9. Aussichtspunkt Schermützelsee 10. Wasserrad Stobbermühle Der Schermützelsee ist mit 146 ha der grösste See der Das Wasserrad an der Stobbermühle gehörte zu einem Region. Bei einer Tiefe von ca. 45 Metern befi ndet sich durch Wasserkraft betriebenen Elektrowerk, welches sich die tiefste Stelle ungefähr 19 Meter unter dem Mee- in einem der ältesten Häuser der Stadt Buckow, dem heu- resspiegel. Er entstand ebenfalls durch einen riesigen tigen Parktheater, be- Toteisblock, der zum Ende der letzten Eiszeit vor rund fand. Um den Fischen 12.000 Jahren zurückblieb und erst Jahrhunderte später das Überwinden der völlig aufgetaut war und das große Becken hinterliess. Staustufe zu ermögli- In und um Buckow gibt es viele Quellen. Sie führen chen wurde 1993 der oberfl ächennahes Grundwasser und sind keine Trink- Fischpass gebaut. wasserquellen. Aus diesem Grund mussten die Bucko- wer früher ihr Trinkwasser von weit her holen. In der Sage „Die Weiße Frau“ oder „Anne Susanne“ wird von einer weisen Frau erzählt die den Buckowern eine Stelle für eine ergiebige Trinkwasserquelle zeigte. Gleichzeitig warnte sie die Buckower vor der Kraft der Quelle. Einige junge Männer ignorierten diese Warnung und entfernten den Schutzstein. Eine artesische Quelle öffnete sich und überfl utete das alte Buckow sowie das 11. Brunnen am Markt umliegende Gebiet. An seiner Stelle fi nden wir heute Am 13.07.1924 wurde der Brunnen in seiner heutigen den Schermützelsee. Form eingeweiht. Die Sage erzählt, dass sich tief unter Ein Fischer will die Glocke der versunkenen Stadt in diesem Brunnen soll ein mächtiger Findling, der Flötzstein, seinem Netz gefangen haben, als er sie aber im Netz befi nden soll:Auf diesem Stein ist vor langer Zeit mun- an das Ufer schleppen wollte, riß ihm das Netz und die ter getanzt und Buckower Bier, Flötz genannt, getrunken Glocke versank wieder in der Tiefe. -

Little Switzerland
beech forest and pine forests, »mountains« and ravines, bogs, fields, meadows, hedges and even an inland dune. Melting water in the Ice Age washed out the Buckower Rinne which runs through the nature park. In the »Buckower Kes- sel« (Buckow Kettle) there is the Schermützelsee lake which covers 146 hectares and is 40 metres deep. Just one and a half kilometres away the 129 metre hill, the »Krugberg«, rises The Stobber rushes through round 25 kilometres of the nature cultivation remain intact, the management of the nature park up. In the Pritzhagen Hills there are two lakes – the Kleiner Fuel Station for Birds park and drops 43 metres in height. Once it used to drive many organises contractual nature conservation, such as the mowing Tornowsee and the Großer Tornowsee – which is just 250 mill wheels. They have now largely disappeared. The mill ponds of the water meadow to protect orchids, grazing to maintain metres apart and have a difference in height of 16.5 metres. Almost all of the nature park is a European bird reserve. remain, however: a hurdle which cannot be crossed, not just the species-rich dry grass and the planting of hedges, which This is a landscape with many contours, where at every turn Among the over 140 species of breeding birds which have by migrating fish species. Eight dams were made passable again provides all-round ecology that shapes the landscape in many the Ice Age is within reach: with the boulders which have been been counted, there are the »big ones«: both black and white through the use of »fish stairs«, among other things. -

MÄRKISCH ODERLAND Nach Klosterdorf Mit Schönen Feldsteinhäusern (Km 4)
einer Weile wieder schneller und kehrt aufgrund richtet. Eine davon ist neben dem Kino an der Wrie- KILOMETER 35-41 wehrschlacht der Reichswehr. 100 000 Menschen AUF GRÜNEN WEGEN DURCH einer fast unbemerkbaren Höhe schließlich seinen zener Straße 1. Es gibt einen Wanderweg entlang starben. Noch heute werden Kriegsreste im Boden BRANDENBURG Lauf wieder in die entgegengesetzte Richtung um. der Stobber von Fischtreppe zu Fischtreppe. Von Obersdorf über Trebnitz nach Wulkow. gefunden. Die unbemerkbare Höhe ist die Wasserscheide von Nord- und Ostsee. Niederschläge, die östlich der KILOMETER 26-30 WASSERTOURISMUS Auf dem Radweg „Märkische Schlössertour“ nach www.gruene-fraktion-brandenburg.de/ Wasserscheide niedergehen, gelangen über das Ge- Brandenburg gilt als das gewässerreichste Bun- Neuhardenberg. radtouren/ wässersystem schließlich in die Ostsee, Niederschlä- An der Buckower Kirche in die Königstraße, weiter auf desland. Wer mit einem Kajak oder Kanu auf dem ge westlich der Wasserscheide in die Nordsee. dem Europaradweg R1. Quappendorfer Kanal paddelt, erlebt die Landschaft SCHLOSS NEUHARDENBERG aus einer ganz anderen Perspektive: Sumpf und Nach einem Brand im Jahr 1801 wurde Neuharden- SCHWEDENSCHANZE DREI EICHEN Wildnis - als wäre man im Urwald. Mächtige Er- berg von Karl Friedrich Schinkel im klassizistischen verbrennt Kalorien Zwischen dem großem Däbersee (man kann darin Im Umweltzentrum wird Wildniswissen vermittelt. len, die sich über das Wasser beugen, zwischen den Stil neu aufgebaut. Im Dritten Reich war das Schloss angeln, baden, Bötchen fahren) und dem kleinen An den Sommerwochenenden öffnet das Waldcafé. Baumwurzeln kann man im Sand Brutröhren von Treffpunkt der adligen Regimegegner des 20. Juni, Däbersee liegt die so genannte Schwedenschanze. Im Tipidorf kann man übernachten. -

Bioregiony České Republiky (Bioregions of the Czech Republic)
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/291801175 Bioregiony České Republiky (Bioregions of the Czech Republic) BOOK · FEBRUARY 2014 DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210-6693-2013 CITATIONS READS 2 6 4 AUTHORS, INCLUDING: Martin Culek Masaryk University 15 PUBLICATIONS 9 CITATIONS SEE PROFILE Jan Divíšek Masaryk University 4 PUBLICATIONS 4 CITATIONS SEE PROFILE Available from: Martin Culek Retrieved on: 21 February 2016 Biogeografické regiony České republiky Martin Culek, Vít Grulich, Zdeněk Laštůvka, Jan Divíšek Biogeografické regiony České republiky ASARYKIAN M A S B A R IT ST U E S N R P E E O N V A I S I T I N S T E U N N T F E I I A A C M C S U IU L L T A A R S R TU ERUM NA Masarykova univerzita Brno 2013 Publikace vznikla v rámci projektu OP VK „Inovace výuky geografických studijních oborů“ (reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0222), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Recenzovali: Doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. Doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc. © 2013 Martin Culek, Vít Grulich, Zdeněk Laštůvka, Jan Divíšek © 2013 Masarykova univerzita ISBN 978-80-210-6693-9 DOI 10.5817/CZ.MUNI.M210-6693-2013 Obsah A. TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Úvod .......................................................................... 7 2. Soustava biogeografického členění krajiny .......................................... 8 3. Názvosloví biogeografických jednotek .............................................. 8 4. Cíle biogeografické regionalizace ................................................. 9 5. Definice vyšších biogeografických jednotek ........................................ 10 6. Metodický postup při biogeografické regionalizaci ČR ������������������������������ 10 6.1. Použité podklady ....................................................... -

Unterwegs Auf Der Naturparkroute
Den Schermützelsee muss Über 1000 verschiedene Farn- und Blütenpflan- Ministerium für Ländliche man einfach von oben sehen! Was geh´n den Müller Entwicklung, Umwelt und Die Naturpark-Route führt zen, darunter auch Orchideen, sind im Wechsel Landwirtschaft deshalb hinauf auf die Höhen. der Jahreszeiten am naturbelassenen Fließ, in Hier lassen sich die gewalti gen die Fische an? Kräfte der Eiszeit erahnen, die Mooren und auf Feuchtwiesen oder im gesam- Das Brecht-Weigel-Haus Das Strandbad in Buckow, mit Aufpressung, Stauchung, Bereits sehr früh nutzten die Buckower die Wasserkraft ihrer ten Naturpark zu finden. www.brechtweigelhaus.de Wriezener Straße Faltung und Abschmelzen Bäche mit Mühlen. Die Grunower Mühle am Sophienfließ dieses liebenswerte Fleckchen arbeitete schon im Jahre 1333. Damm-Mühle, Lapnower Brandenburgs „schweizerisch“ Mühle, Eichendorfer und Stadtmühle – auf engem Raum Vogelkonzert verschiedenster Arten begleitet Wer wandert, bekommt Durst und Hunger! formten. gab es eine relativ hohe Zahl. den Wanderer hier von März bis Juli. Aber beson- Entlang der Route – oder einige Schritte abseits Der See selbst entstand aus einem gewaltigen Eis block, der sich ver- deren Glücks bedarf es schon, um einmal den – gibt es einige Möglichkeiten zur Einkehr. mutlich beim Rückzug des Gletschers abspaltete und verschüttet wurde Staustufen in den Fließen sorgten früher dafür, Aufmerksame Beobachter Fischotter zu Gesicht zu bekommen. – deshalb als Toteisblock bezeichnet. Mit seinem Abschmel zen bildeten entdecken Biberspuren Achten Sie dabei besonders auf dieses Zeichen: Schweizerisches Flair sich mit Wasser gefüllte Hohlräume, die nach und nach einbrachen. dass der Müller übers gesamte Jahr genügend an Bäumen, sogar Dämme, Diese wanderfreundlichen Gastgeber verpflichten sich u. a. Über die Jahrtausende konnte so der Schermützelsee entstehen. -

ROTES LUCH UND TIERGARTEN Landkreis Märkisch-Oderland
ROTES LUCH UND TIERGARTEN Landkreis Märkisch-Oderland Status: FFH- und Naturschutzgebiet sowie europäisches Vogelschutzgebiet im Landkreis Märkisch-Oderland Größe des Gesamtgebietes: 1.256 ha NABU-Flächenbesitz: 174,67 ha T. Dove G. Bussmann G. Bussmann Ansprechpartner Während der Mittelspecht ausreichend Nahrung und Unterschlupf in den naturnahen Wäldern des „Tiergarten“ findet, fühlen sich NABU-Stiftung Nationales Naturerbe Biber und Eisvogel im Roten Luch wohl. www.naturerbe.de Kurzbeschreibung - Gebietscharakteristik Bedeutende Tier- und Pflanzenarten Zwischen dem Barnimer Hochland und der Lebuser Hochfläche Vögel: Eisvogel, Braunkehlchen, Neuntöter, Mittelspecht liegt das Rote Luch, das größte Niedermoor Ostbrandenburgs. Säugetiere: Fischotter, Europäischer Biber Weichtiere: Es erstreckt sich auf einer Länge von elf Kilometern bis in die Bachmuschel, Flaches Posthörnchen, Feingerippte Gras- Urstromebene der Spree und bildet eine malerische Wiesen- schnecke Fische: Steinbeißer, Schlammpeitzger und Auenlandschaft. Pflanzen: Geflecktes Knabenkraut, Braune Brunnenkresse, Acker-Gipskraut, Breitblättriges Knabenkraut Das naturnahe Flüsschen Stobber hat hier seinen Ursprung und fließt in zwei entgegengesetzte Richtungen ab. Ursache für Lage und Schutzstatus dieses Naturphänomen ist eine Talwasserscheide, eine geringe Das Schutzgebiet liegt rund 30 Kilometer östlich von Berlin Erhöhung in der Landschaft des Luchs. Der Stobber fließt zum und erstreckt sich auf einer Länge von elf Kilometer zwi- einen durch die Märkische Schweiz über die Oder in die Ostsee schen Müncheberg und Rehfelde. Im Norden grenzt es an die und zum anderen über Spree und Elbe in die Nordsee. In der Gemeinde Waldsieversdorf südlich von Buckow. Nachsteinzeit war das Rote Luch ein großer See, der im Laufe der Zeit verlandete. Heute leben in der vielfältigen Niederung eine große Anzahl gefährdeter Tier- und Pflanzenarten. So finden Eisvogel und Biber im weitläufigen Feuchtgebiet Nah- rung und Unterschlupf und seltene Orchideen blühen auf den Feuchtwiesen. -
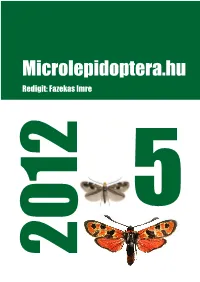
Microlepidoptera.Hu Redigit: Fazekas Imre
Microlepidoptera.hu Redigit: Fazekas Imre 5 2012 Microlepidoptera.hu A magyar Microlepidoptera kutatások hírei Hungarian Microlepidoptera News A journal focussed on Hungarian Microlepidopterology Kiadó—Publisher: Regiograf Intézet – Regiograf Institute Szerkesztő – Editor: Fazekas Imre, e‐mail: [email protected] Társszerkesztők – Co‐editors: Pastorális Gábor, e‐mail: [email protected]; Szeőke Kálmán, e‐mail: [email protected] HU ISSN 2062–6738 Microlepidoptera.hu 5: 1–146. http://www.microlepidoptera.hu 2012.12.20. Tartalom – Contents Elterjedés, biológia, Magyarország – Distribution, biology, Hungary Buschmann F.: Kiegészítő adatok Magyarország Zygaenidae faunájához – Additional data Zygaenidae fauna of Hungary (Lepidoptera: Zygaenidae) ............................... 3–7 Buschmann F.: Két új Tineidae faj Magyarországról – Two new Tineidae from Hungary (Lepidoptera: Tineidae) ......................................................... 9–12 Buschmann F.: Új adatok az Asalebria geminella (Eversmann, 1844) magyarországi előfordulásához – New data Asalebria geminella (Eversmann, 1844) the occurrence of Hungary (Lepidoptera: Pyralidae, Phycitinae) .................................................................................................. 13–18 Fazekas I.: Adatok Magyarország Pterophoridae faunájának ismeretéhez (12.) Capperia, Gillmeria és Stenoptila fajok új adatai – Data to knowledge of Hungary Pterophoridae Fauna, No. 12. New occurrence of Capperia, Gillmeria and Stenoptilia species (Lepidoptera: Pterophoridae) ………………………. -

List of Publications Gerhard Tarmann
List of Publications Gerhard Tarmann Last update: 30‐10‐2019 1. Tarmann, G. 1975. Die Zygaeniden Nordtirols (Insecta Lepidoptera). Veröff. Mus. Ferdinandeum Innsbr. 55: 113–251. (FP001) 2. Tarmann, G. 1975. Raritäten aus Tirols Bergen. Zeitschrift 'TIROL' 46: 44–49. 3. Tarmann, G. 1976. Geschützte Tierarten in Tirol. ‐ In: Kofler, W., Natur und Land, Natur und Umweltschutz in Tirol. Taschenbuchreihe Natur und Land 1: 41–84. 4. Tarmann, G. 1976. Katalog zur Ausstellung 'Lebende Schlangen' im Zeughaus in Innsbruck (1.6.‐ 28.11.1976). 16pp. 5. Tarmann, G. 1977. Procris (Jordanita) chloros (Hübner, 1808–1813) in Südtirol (Lep.: Zygaen.). NachrBl. bayer. Ent. 26: 28–29. (FP002) 6. Tarmann, G. 1977. Ino kruegeri TURATI,1930, ein Synonym zu Procris (Praviela) anatolica Naufock, 1929. Z. ArbGem. öst. Ent. 29: 93–96. (FP003) 7. Tarmann, G. 1977. Beschreibung einer neuen Grünzygaene, Procris (Procris) storaiae n.sp. aus der östlichen Türkei, nebst einiger kurzer Bemerkungen zur Systematik und Biologie der statices‐Gruppe des Genus Procris F. (Lepidoptera, Zygaenidae). NachrBl .bayer. Ent.26: 97–108. (FP004) 8. Tarmann, G. 1977. Neue Funde von Procris (Lucasiterna) horni Alberti, 1937 (Lepidoptera, Zygaenidae). Mitt. Münch. Ent. Ges. 67: 91–94. (FP005) 9. Burmann, K. & Tarmann, G. 1977. Walter Schwarzbeck (1914–1975), Lehrer und Naturforscher. Veröff. Mus. Ferdinandeum Innsbr. 57: 5–33. 10. Tarmann, G. 1978. Mineralien aus aller Welt aus dem Naturhistorischen Museum in Wien und von privaten Sammlern. Ausstellungskatalog zur Ausstellung im Zeughaus in Innsbruck vom 15.6.‐ 10.10.1978. 20pp. 11. Tarmann, G. 1978. Wanderfalterbericht 1975 für Österreich. Atalanta 9: 1–40. 12. Tarmann, G.