Der Bundestagswahlkampf 1961
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Biafran War and Postcolonial Humanitarianism
The Biafran War and Postcolonial Humanitarianism In the summer of 1968, audiences around the globe were shocked when newspapers and TV stations confronted them with photographs of starving children in the secessionist Republic of Biafra. This global con- cern fundamentally changed how the Nigerian Civil War was perceived: an African civil war that had been fought for one year without fostering any substantial interest from international publics became “Biafra” – the epitome of a humanitarian crisis. Based on archival research from North America, Western Europe, and sub-Saharan Africa, this book is the first comprehensive study of the global history of the conflict. A major addition to the flourishing history of human rights and human- itarianism, it argues that the global moment “Biafra” is closely linked to the ascendance of human rights, humanitarianism, and Holocaust memory in a postcolonial world. The conflict was a key episode for the restructuring of the relations between “the West” and the “Third World.” lasse heerten is currently head of the “Imperial Gateway: Ham- burg, the German Empire, and the Making of a Global Port” project, funded by the DFG (German Research Council) at the Freie Uni- versität Berlin. He has previously served as a Postdoctoral Fellow in Human Rights at the University of California at Berkeley. Human Rights in History Edited by Stefan-Ludwig Hoffmann, University of California, Berkeley Samuel Moyn, Harvard University, Massachusetts This series showcases new scholarship exploring the backgrounds of human rights today. With an open-ended chronology and international perspective, the series seeks works attentive to the surprises and contingencies in the historical origins and legacies of human rights ideals and interventions. -

Katholieke Documentatie- En Onderzoekscentrum Voor Religie
1 PROJECT APPLICATION Project Title: Transnational Party Cooperation between Christian Democratic and Conservative Parties in Europe from 1965 to 1979 (Editorial Project) Applicants and Potential Recipients: Karl von Vogelsang-Institut zur Erforschung der Geschichte der Christlichen Demokratie in Österreich (Vienna) and Institut für Geschichte der Stiftung Universität Hildesheim Project Leader: Univ.-Prof. Dr. Michael Gehler, Univ.-Prof. Dr. Dieter A. Binder Academic Employees: Dr. Hannes Schönner, as well as one project employee with an academic degree at the Stiftung Universität Hildesheim Possible International Cooperation Partners: Katholieke Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving (KADOC) KU Leuven (Belgium), Konrad Adenauer-Stiftung (KAS), Archiv für Christlich-Demokratische Politik (ACDP) St. Augustin (Federal Republic of Germany), Archiv für Christlich-Soziale Politik der Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) Munich (Federal Republic of Germany) Project Duration: January 1, 2009-December 31, 2012 (48 months = four years) Filing Date: Autumn 2008 2 I. Description of Contents 1. The History and Organizational Development of Christian Democratic and Conservative Transnational Party Cooperation in Europe After the Second World War, Catholic-conservative and Christian Democratic people’s parties played an increasingly more important role in Western Europe. After 1945, there was no lack of new incentives, nor of necessary challenges for transnational contacts and organized party cooperation. Nevertheless, the secret -

Die Protokolle Des CDU-Bundesvorstands 1969-1973
13 Düsseldorf, Samstag 24. Januar 1971 Sprecher: Barzel, [Brauksiepe], Schröder. Vorbereitung des Bundesparteitags. Bericht Dr. Gerhard Schröders über seine Moskau-Rei- se. Bericht Dr. Rainer Barzels über seine Warschau-Reise. Beginn: 14.00 Uhr Ende: 16.00 Uhr Vorbereitung des Bundesparteitags Der Bundesvorstand nimmt die Vorschläge des Präsidiums für die personelle Be- setzung des Parteitagspräsidiums und der Antragskommission sowie den Vorschlag des Zeitplans für die Programmdiskussion einstimmig an. Auf Anregung von Frau Brauksiepe wird in das Parteitagspräsidium zusätzlich Frau Pieser aufgenommen. Vorschläge des Präsidiums (Sitzung am 20. Januar 1971) an den Bundesvorstand für den Ablauf des 18. Bundesparteitages 25.–27. Januar 1971 in Düsseldorf 1. Präsidium des Parteitages: Präsident: Heinrich Köppler; Stellvertreter: Frau Becker-Döring1; Mitglieder: Dr. Alfred Dregger, Dr. Georg Gölter2, Wilfried Hasselmann, Peter Lorenz, Adolf Müller (Remscheid), Heinrich Windelen, Dr. Manfred Wörner. 2. Mitglieder der Antragskommission: Vorsitzender: Dr. Bruno Heck; Stellvertreter: Dr. Rüdiger Göb; Mitglieder: Ernst Benda, Irma Blohm, Professor Dr. Walter Braun, Bernhard Brinkert3, Professor Dr. Fritz Burgbacher, Jürgen Echternach, Dr. Heinrich Geißler, Dr. Baptist Gradl, Frau Griesinger, Leisler Kiep, Dr. Konrad Kraske, Egon Lampersbach, Gerd Langguth4, 1 Dr. Ilse Becker-Döring (1912–2004), Rechtsanwältin und Notarin; 1966–1972 Erste Bürger- meisterin in Braunschweig (CDU), 1970–1978 MdL Niedersachsen. Vgl. Protokolle 5 S. 177 Anm. 7. 2 Dr. Georg Gölter (geb. 1938), Gymnasiallehrer; 1958 JU, 1965–1971 Landesvorsitzender der JU Rheinland Pfalz, 1967–1969 Referent für Grundsatzfragen im Büro von Kultusminister Bernhard Vogel, 1968–1977 Vorsitzender des KV Speyer, 1969–1977 MdB, 1975–1979 Vor- sitzender des BV Rheinhessen-Pfalz, 1977–1979 Minister für Soziales, Gesundheit und Sport, 1979–1981 für Soziales, Gesundheit und Umwelt, 1981–1991 für Kultus, 1979–2006 MdL Rheinland-Pfalz. -

2 Fraktionsvorsitzende Und Parlamentarische Geschäftsführer Geschäftsführer
ARCHIVALIE CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag Seite: 102 Karton/AO Signatur: 08-001 Datum 2 Fraktionsvorsitzende und Parlamentarische Geschäftsführer Geschäftsführer 2.1 Fraktionsvorsitzende 2.1.1 Heinrich von Brentano Fraktionsvorsitzender 1949 - 1955 sowie 1961 - 1964. 292/4 - Brentano, Heinrich von 01.11.1949 - 03.12.1949 Hier: Bundeshauptstadt, Sitz: Zuschriften von Wählern und der Deutschen Wählergemeinschaft zur Abstimmung über den Sitz der Bundeshauptstadt 303/3 - Brentano, Heinrich von 03.11.1949 - 10.09.1955 Hier: Südweststaat: Informationsmaterial, Eingaben und Stellungnahmen von CDU-Gremien zur Badener Frage; Gutachten von Paul Zürcher zum Entwurf eines Neugliederungsgesetzes (1951); Informationsmaterial zu dem Rücktritt von Wilhelm Eckert; Ausarbeitung von Leo Wohleb; Schriftwechsel u.a. mit: Adenauer, Konrad Wuermeling, Franz-Josef Müller, Gebhard 292/3 - Brentano, Heinrich von 1950 Hier: Regierungsbauten Schriftwechsel zur Ausstattung, Kostenaufstellung 301/1 - Brentano, Heinrich von 1950 - 1951 Hier: Neuordnung der Eisen- und Stahlindustrie und des Kohlebergbaus: Schriftwechsel, Informationsmaterial 292/7 - Brentano, Heinrich von 1952 Hier: Verwaltungsrat der Deutschen Bundesbahn: Besprechungen, Schriftwechsel. 296/1 - Brentano, Heinrich von 1954 Hier: Bildung eines Koordinierungsausschusses: Schriftwechsel Paul Bausch/Rudolf Vogel; Ausarbeitung von Otto Lenz 313/3 - Brentano, Heinrich von 1954 Hier: Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte: Interfraktioneller Schriftwechsel mit Theodor -

14. April 1964: Fraktionssitzung 1
FDP – 04. WP Fraktionssitzung: 14. 04. 1964 14. April 1964: Fraktionssitzung ADL, Bestand Wolfgang Mischnick, A40-761. Überschrift: »Kurzprotokoll der Frakti- onssitzung am 14. April 1964«. Zeit: 14.10–18.00 Uhr. Vorsitz: Mischnick; später: Zog- lmann. Anwesende Fraktionsmitglieder: keine Angabe. Sitzungsverlauf: A. Aussprache über die Berlin-Hilfe, das Steueränderungsgesetz und die Parteienfinanzie- rung. B. Geschäftliche Mitteilungen. C. Bericht über ein Gespräch mit Bundeskanzler Erhard über die Zuständigkeiten des Bun- desministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit. D. Aussprache über das Prämiensparen. E. Bericht aus dem Ältestenrat. F. Vorbereitung auf die zweite Beratung des Gesetzentwurfs über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Rechnungsjahr 1964. G. Berichte aus den Bundestagsausschüssen. [A.] Zu TO Punkt 1): Mischnick: Es müssen vorweg 3 Fragen behandelt werden, a) Berlin-Hilfe (132 Mio.), b) Steueränderungsgesetz, c) Parteienfinanzierung. Zur letzteren ist zu bemerken, daß der Kanzler Erler1 in der Sache angehört hat, da die SPD diese Frage hochspielen will. Genscher2: Es fand ein Gespräch zu diesen Fragen statt, an dem von seiten der SPD der Schatzmeister Nau3, von seiten der CDU deren Schatzmeister Burgbacher4 und von seiten der FDP, da Rubin5 verhindert war, er selbst teilnahmen. Dabei bat Nau, dem Wunsche des Parteipräsidiums der SPD zu entsprechen und den Beschluß der Bewilli- gung von 38 Mio. auf den bisherigen Betrag von 20 Mio. rückgängig zu machen. Zu- mindest für dieses laufende Jahr. Burgbacher hat in dieser Sache eindringlich an Nau appelliert. Es ist hierzu zu bemerken, daß in der Klagebegründung des Prozesses, den das Land Hessen in dieser Sache der Parteienfinanzierung vor dem Bundesverfassungsgericht geführt hat, ausdrücklich vermerkt ist, daß eine andere Finanzierung gefunden werden müsse. -

3 Parteivorsitzende
Seite: 405ÿ CDU-Bundesparteiÿÿ(07-001) Signaturÿ Laufzeitÿ 3ÿParteivorsitzende 3.1ÿKonradÿAdenauerÿ1950ÿ-ÿ1966 3.1.1ÿLeitungÿundÿStabsorgane 3.1.1.1ÿBundeskanzleramt 10084ÿ -ÿ BundeskanzlerÿKonradÿAdenauerÿ(1) 1953ÿ-ÿ1955ÿ StaatssekretärÿHansÿGlobke:ÿUnterlagenÿ04.1954ÿ- 12.1955 1955ÿ UnterlagenÿzuÿCDU-Bundesvorstandÿund CDU-Bundesausschussÿ1954ÿ-ÿ1955 SchreibenÿvonÿLudwigÿErhardÿanÿKonradÿAdenauerÿüber dieÿallgemeineÿpolitischeÿSituation SchreibenÿvonÿGerhardÿSchröderÿundÿReinoldÿvon Thadden-TrieglaffÿanÿKonradÿAdenauerÿmitÿdem Wunsch,ÿEdoÿOsterlohÿeinÿwichtigesÿAmtÿzuÿgeben EntwurfÿeinerÿSatzungÿderÿGesellschaftÿfür Christlich-demokratischeÿBildungsarbeit BerichtÿvonÿBrunoÿHeckÿüberÿdieÿSitzungÿdes Bundesparteivorstandesÿamÿ10.11.1955;ÿdarunter GegenüberstellungÿderÿaltenÿundÿneuenÿFassungÿdes CDU-Statutsÿvomÿ22.09.1955 SchreibenÿvonÿKonradÿAdenauerÿanÿKurtÿGeorg Kiesinger,ÿinÿdemÿerÿdessenÿÄußerungenÿzurÿpolitischen Lageÿkritisiertÿ(Durchschlag) RedeÿvonÿJosefÿMüllerÿinÿMünchenÿzumÿzehnten JahrestagÿderÿGründungÿderÿCSU ArtikelÿvonÿErichÿPeterÿNeumannÿzurÿSaarfrage:ÿAus einemÿanderenÿLand SchreibenÿvonÿJosephÿBolligÿanÿKonradÿAdenauerÿzur ReformÿdesÿWahlrechts VorschlagÿvonÿKonradÿAdenauerÿgegenüberÿHanns Seidel,ÿimÿkleinenÿKreisÿeineÿoffeneÿAussprache zwischenÿCDUÿundÿCSUÿdurchzuführen Zeitschrift:ÿDieÿPrognose,ÿ7.Jahrgang.,ÿNr.38, 22.09.1955 SchreibenÿvonÿOttoÿLenzÿanÿBundeskanzlerÿAdenauer überÿaktuelleÿpolitischeÿFragen KorrespondenzÿzwischenÿJohannÿB.ÿGradlÿundÿKonrad AdenauerÿüberÿdieÿNotwendigkeit,ÿmitÿderÿZeitungÿ"Der Tag"ÿinÿBerlinÿeineÿderÿCDUÿnahestehendeÿZeitungÿzu -
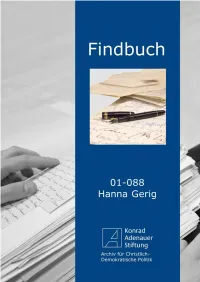
Kas 48002-544-1-30.Pdf
ARCHIV FÜR CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE POLITIK DER KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG E.V. 01 – 088 HANNA GERIG SANKT AUGUSTIN 2017 I Inhaltsverzeichnis 1 Persönliches 1 2 Korrespondenz 3 3 Verfolgtenorganisationen 6 3.1 Bund der Verfolgten des Naziregimes (BVN) 6 3.2 Weitere Verfolgtenorganisationen 6 4 Materialsammlung 8 4.1 Presseausschnitte 8 4.2 Veröffentlichungen (Hefte, Broschüren, Bücher) 8 4.3 Fotos 10 4.4 Heinrich Brüning 10 Sachbegriff-Register 11 Personenregister 12 Biographische Angaben: 31.05.1900 geboren in Potsdam als Hanna Degenhardt, Vater: Oberpostsekretär Anton Degenhardt, Ortsvorsitzender des Zentrums, Mutter: Emma von Rönne bis 1916 Städtisches Lyzeum in Potsdam, danach Handelsschule und Handelshochschule in Potsdam als Gasthörerin 1917 Angestellte der Deutschen Bank in Potsdam, später Hauptverwaltung in Berlin 1924 Heirat mit dem Reichstagsabgeordneten Otto Gerig, 5 Kinder (eines verstarb früh) 1944 Otto Gerig nach dem 20. Juli 1944 im Rahmen der "Aktion Gewitter" verhaftet, am 03.10.1944 im KZ Buchenwald an Folgen der Haft verstorben 1944-1945 Engagement für die Gefangenen des NS-Regimes in den Messehallen Köln-Deutz ("Engel der Messehallen") 1945 Mitgründerin der CDU in Köln (Mitgliedsnummer 32), an der Abfassung der "Kölner Leitsätze" beteiligt 07.06.1945 Teilname an den Walberberger Gesprächen seit 1945 Mitglied der Deutschen Angestellten Gewerkschaft, später Leiterin der DAG Frauenvereinigung Nordrhein-Westfalen und Mitglied im Hauptvorstand 1945-1948 Sozialreferentin bei der RHENAG - Rheinische Energie A.G. 1946-1965 Stadtverordnete -

Vom Mitarbeiter Zum Miteigentümer. Der Burgbacher-Plan Von 1969
1 2 3 Vom Mitarbeiter zum Miteigentümer. 4 Der Burgbacher-Plan von 1969 5 6 Von Günter Buchstab 7 8 Auf der 50-Jahr-Feier der »Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Partner- 9 schaft in der Wirtschaft« Anfang April 2000 stellte Bundeskanzler Schröder 10 – ohne in Einzelheiten zu gehen – Grundzüge eines Konzepts zur Beteiligung 11 der Arbeitnehmer am Kapital und Gewinn ihrer Unternehmen vor.1 Gewerk- 12 schaften und Arbeitgeber sollten bei Tarifverhandlungen ihr besonderes Au- 13 genmerk auf Investiv-Lohnmodelle richten, bei denen Teile von Lohnerhö- 14 hungen nicht in bar ausgezahlt, sondern in Aktien, Investmentfonds, Ge- 15 nußscheinen oder in vergleichbare Unternehmensbeteiligungen investiert 16 werden. Der Ausbau der Vermögensbildung und insbesondere die Gewinnbe- 17 teiligung der Arbeitnehmer böten – so Schröders Einschätzung – gerade jetzt, 18 da die Deutschen die Aktien entdeckt hätten, eine Reihe von Vorteilen: Bei 19 den Beschäftigten steigere die Beteiligung am Unternehmenskapital und -er- 20 folg die Motivation und Verantwortung, was nicht nur die Betriebsergebnisse, 21 sondern auch das Verständnis für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge 22 verbessere. Die Beteiligung der Menschen in den Betrieben »am Haben und 23 Sagen« sei eine der Säulen der Sozialen Marktwirtschaft, was gelegentlich ver- 24 gessen werde. Auch könne der Export von Arbeitsplätzen ins Ausland durch 25 bessere Einbindung und Beteiligung der Beschäftigten am eigenen Unterneh- 26 men vermieden und somit Arbeitslosigkeit abgebaut werden. Und nicht zuletzt 27 sei in diesem Zusammenhang auch die Frage einer kapitalgedeckten zusätz- 28 lichen Altersversorgung zu klären, an der künftig kein Weg vorbeigehe. 29 Mit diesen Vorstellungen sah sich Schröder »im Zentrum entschiedener Mo- 30 dernisierungsbestrebungen«. Mehr noch: »Eine Vorreiterrolle in der Beteili- 31 gungswirklichkeit« weist er Sozialdemokraten wie Georg Leber und Philipp 32 Rosenthal zu. -

Katalog Ansehen
Antiquariat + Verlag Klaus Breinlich April/Mai 2021 Antiquari Atskatalog MMXXI/I Res Publica AntiquariAtskatalog MMXXI/I Res Publica April/Mai 2021 Staatsverfassung und politische Theorie von der Antike bis zur Verfassung des deutschen Grundgesetzes State Constitution and Political Theory from Antiquity to the Constitution of the German Grundgesetz 1. Pluralismus und offene Gesellschaft [1-60] Die Grundrechte im Verfassungsleben des Grundgesetzes und die Verhältnismäßigkeit staatlichen Handelns Pluralism and Open Society - Fundamental Rights in the Constitutional Life of the German Grundgesetz and the Proportionality of State Action 3 2. Bundesstaatsrecht und Staatsorganisation [61-131] Verfassung und Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland Federal State Law and State Organisation - Constitution and Constitutional Law of the Federal Republic of Germany 7 3. Kirche und Staat [132-170] Kirchliche Bewegungen im Konflikt mit Staat und demokratischer Öffentlichkeit Church and State - Church Movements in Conflict with the State and the Democratic Public 11 4. Staatsrecht, Staatsorganisation, Kirchenrecht [171-492] Festschriften zu Ehren gefeierter Staats- und Verfassungsrechtler Constitutional Law, State Organisation, Canon Law - Festschriften in Honour of celebrated Law Scholars 16 5. Soziale Bewegung und politische Verfassung [493-577] Gesellschaftstheoretische Betrachtungen über Staat, Recht und Politik Social Movement and Political Constitution – Sociological Reflections on State, Law and Politics 43 6. Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen [578-667] Weimarer Demokratie, Notstand und nationalsozialistische Diktatur The Value of the State and the Importance of the Individual - Weimar Democracy, State of Emergency and National Socialism Dictatorship 48 7. Staatswissenschaften, öffentliche Meinung und politische Bewegungen [668-817] Reform, Revolution und Restauration im 19. Jahrhundert Political Science, Public Opinion and Political Movements - Reform, Revolution and Restoration in the 19th Century 54 8. -

CDU/CSU-Fraktion – 5
CDU/CSU – 05. WP Archivalien (1966–1969) CDU/CSU-Fraktion – 5. Wahlperiode (1965–1969) Verzeichnis der Archivalien [Das folgende Verzeichnis wurde der Buchausgabe für den Zeitraum von 1966 bis 1969 entnommen.1] Verzeichnis der Archivalien Archiv für Christlich-Demokratische Politik der Konrad-Adenauer-Stiftung, Sankt Augustin (ACDP) 01-004 Nachlass Peter Wilhelm Brand 01-048 Nachlass Elisabeth Schwarzhaupt 01-108 (Teil-)Nachlass Richard Jaeger 01-157 Nachlass Kai-Uwe von Hassel 01-158 Nachlass Fritz Burgbacher 01-226 Nachlass Kurt Georg Kiesinger 01-349 Nachlass Ernst Majonica 01-433 Nachlass Kurt Birrenbach 01-483 Nachlass Gerhard Schröder 01-539 Nachlass Olaf Baron von Wrangel 01-588 Nachlass Eugen Maucher 03-016 Präsidium der CDU in Nordrhein-Westfalen 04-007 Junge Union Deutschlands 04-013 Christlich Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA) 06-025 Arbeitsgemeinschaft Demokratischer Kreise (ADK) 07-001 CDU-Bundespartei 08-001 CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages 08-003 CDU/CSU-Fraktion, Arbeitskreis II 08-004 CDU/CSU-Fraktion, Arbeitskreis III 08-005 CDU/CSU-Fraktion, Arbeitskreis IV 08-007 CDU/CSU-Fraktion, Arbeitskreis VI Pressedokumentation Archiv für Christlich-Soziale Politik der Hanns-Seidel-Stiftung, München (ACSP) CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, 5. Wahlperiode Nachlass Josef Bauer Nachlass Franz Josef Strauß, Aktengruppe Ministerbüro Bundesminister der Finanzen 1 Vgl. »Die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Sitzungsprotokolle 1966–1969«, bear- beitet von Stefan Marx. Düsseldorf 2011 (Quellen zur Geschichte des Parlamentarismus und der poli- tischen Parteien, Vierte Reihe, Bd. 11/V). Copyright © 2016 KGParl Berlin 1 CDU/CSU – 05. WP Archivalien (1966–1969) Nachlass Richard Stücklen Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn (AsD) DGB-Archiv, DGB-Bundesvorstand Sekretariat Maria Weber, Sign. -

A Contrast to Roe V. Wade West German Abortion Decision: a Contrast to Roe V
UIC Law Review Volume 9 Issue 3 Article 4 Spring 1976 West German Abortion Decision: A Contrast to Roe v. Wade West German Abortion Decision: A Contrast to Roe v. Wade, 9 J. Marshall J. Prac. & Proc. 605 (1976) Robert E. Jonas John D. Gorby Follow this and additional works at: https://repository.law.uic.edu/lawreview Part of the Comparative and Foreign Law Commons, and the Health Law and Policy Commons Recommended Citation Robert E. Jonas, West German Abortion Decision: A Contrast to Roe v. Wade West German Abortion Decision: A Contrast to Roe v. Wade, 9 J. Marshall J. Prac. & Proc. 605 (1976) https://repository.law.uic.edu/lawreview/vol9/iss3/4 This Article is brought to you for free and open access by UIC Law Open Access Repository. It has been accepted for inclusion in UIC Law Review by an authorized administrator of UIC Law Open Access Repository. For more information, please contact [email protected]. WEST GERMAN ABORTION DECISION: A CONTRAST TO ROE v. WADEt Translated by ROBERT E. JONAS* AND JOHN D. GORBY** Guiding Principles applicable to the judgment of the First Senate of the 25th of February, 1975: - 1 F.C.C. 1/74 - - 1 F.C.C. 2/74 - - 1 F.C.C. 3/74 - - 1 F.C.C. 4/74 - - 1 F.C.C. 5/74 - - 1 F.C.C. 6/74 --A 1. The life which is developing itself in the womb of the mother is an independent legal value which enjoys the protec- tion of the constitution (Article 2, Paragraph 2, Sentence 1; Article 1, Paragraph 1 of the Basic Law). -

09-001 EPP Group in the European Parliament
09-001 EPP Group in the European Parliament ARCHIV FÜR CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE POLITIK DER KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG E.V. 09 – 001 EPP Group in the European Parliament SANKT AUGUSTIN 2017 I Table of Contents 1 Meetings of the Group’s Executive Bodies ........................................................................................... 1 1.1 Presidency ...................................................................................................................................... 1 1.2 Bureau ............................................................................................................................................ 7 2 Meetings of the Group ........................................................................................................................ 13 3 Other Executive Bodies and Conferences ........................................................................................... 33 3.1 Conference of Presidents of the EP .............................................................................................. 33 3.2 Assemblies of the Secretaries-General of the Parliamentary Groups in the EP .......................... 35 3.3 Bureau of the EP ........................................................................................................................... 35 3.4 Standing Conference (CD) of the Six ............................................................................................ 37 4 Correspondence of the General Secretariat ......................................................................................