Siemens-Jahrbuch-1930.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Publication Series JOURNEYS THROUGH HISTORY, Vol. 1, Siemensstadt (De)
Martin Münzel Bauen für die Zukunft DIE SIEMENssTADT Die Siemensstadt in Berlin ist untrennbar mit der Geschichte des weltweit agierenden Elektrokonzerns Siemens verbunden. Ab 1897 errichtete das Unter- nehmen hier einen modernen Industriestandort, der Bauen sich durch seine einzigartige Architektur und die gleichzeitig geschaffene Wohnbebauung auszeichnet. Die Broschüre unternimmt einen Streifzug von der Vorgeschichte der Siemensstadt im 19. Jahrhundert über ihre Blütezeit Anfang der 1930er-Jahre bis hin zu für die den gegenwärtigen Plänen einer neuen Siemensstadt. Zukunft Martin Münzel, Dr. phil., arbeitet als Historiker und im Archivverbandswesen in Berlin. Er hat insbesondere zur Geschichte von Unternehmern und Unternehmen, der deutsch-jüdischen Emigration und der deutschen Arbeitsministerien geforscht und publiziert. Martin Münzel Bauen für die Zukunft DIE SIEMENssTADT Siemens Historical Institute ZEITREISEN – Band 1 Inhalt Vorwort 4 Einleitung 6 Aufstieg im Kaiserreich 10 Siemens und die Elektropolis Berlin 18 Aufbruch zum Nonnendamm 24 Zwischen Spandau und Charlottenburg 32 Stadt der Industrie 40 Forschung und Verwaltung 54 Die Wohnstadt 64 Mobilität 76 Zäsuren 86 Im Wandel der Zeit 96 Anmerkungen 110 Literatur und Archive 112 Vorwort Gelegentlich führe ich Besucher der Siemens- stadt auf eines der Dächer des Standorts. Dort oben hat man einen hervorragenden Blick über das weitläufige Areal. Das ist für alle ein beein- druckender Moment, denn die schiere Größe und kompakte Bebauung überraschen immer wieder. Gerne denke ich in solchen Momenten an die Gründungslegende. Dieser zufolge durchwan- derten Wilhelm von Siemens und sein 17 Jahre jüngerer Halbbruder Carl Friedrich – die Söhne Die Elektrifizierung der Metropole elektrisierte des Firmengründers Werner von Siemens – bei auch die Menschen. Berlin wurde Modellstadt Anbruch des 20. -

SPD-Verkehrskonzept Charlottenburg-Wilmersdorf
Ausgangslage Das 2016 vom Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf auf der Grundlage des „Stadtentwicklungsplan Verkehr“ verabschiedete bezirkliche Verkehrskonzept1 bedarf einer Fortschreibung, da sich wichtige verkehrspolitische Rahmenbedingungen in unserem Bezirk geändert haben: • Die Zunahme der Einwohnerzahl in der Hauptstadtregion Berlin ist erheblich höher als damals prognostiziert. Auch in Charlottenburg-Wilmersdorf machen sich die ansteigenden Pendler*innenzahlen aus dem Umland und aus dem äußeren Stadtraum bemerkbar. Zwar ist die Motorisierung der Wohnbevölkerung der City West weiterhin mit unter 300 Pkw / 1000 Einwohner*innen bemerkenswert niedrig, doch die Zahl der Einpendler pro Werktag stieg allein von 2009 bis 2018 von ca. 260.000 auf 321.000 in Berlin. • Vor dem Hintergrund der wachsenden Zielverkehre in die City West sowie des zunehmenden Durchgangsverkehrs im Personen- und Wirtschaftsverkehr haben sich die bisherigen Maßnahmen des Luftreinhalteplans als zu schwach erweisen. Sie müssen durch weitere Maßnahmen ergänzt werden: z.B. eine flächendeckende und preislich differenzierte Weiterentwicklung der Parkraumbewirtschaftung, ergänzt durch Durchfahrverbote für Dieselfahrzeuge. • Auch in Charlottenburg-Wilmersdorf wird es einen Zuwachs an Wohnungen geben. Diese neuen Wohnquartiere müssen durch ein nachhaltiges Verkehrskonzept, das auf gut funktionierende Multimodalität, wie z.B. Mobilitäthubs mit Angeboten verschiedener Verkehrsformen setzt, erschlossen werden. Dieses ist nicht nur von der öffentlichen Hand zu bewerkstelligen, sondern ist auch von den Investoren zu leisten. • Der Klimaschutz spielt bei vielen Bürger*innen unseres Bezirks eine wachsende Rolle. Eine preiswerte, wirkungsvolle und schnell zu realisierende Maßnahme zum Klimaschutz ist die Förderung des CO2-freien Rad- und Fußverkehrs. Mit dem am 5. Juli 2018 verabschiedete Mobilitätsgesetz wurden für die Gestaltung der bezirklichen Radverkehrsinfrastruktur neue Qualitätsstandards definiert und eine höhere Verbindlichkeit für die Verwaltungen geschaffen. -
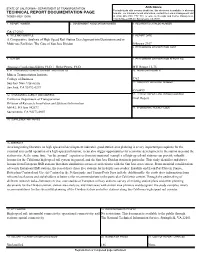
TECHNICAL REPORT DOCUMENTATION PAGE Formats
STATE OF CALIFORNIA • DEPARTMENT OF TRANSPORTATION ADA Notice For individuals with sensory disabilities, this document is available in alternate TECHNICAL REPORT DOCUMENTATION PAGE formats. For alternate format information, contact the Forms Management Unit TR0003 (REV 10/98) at (916) 445-1233, TTY 711, or write to Records and Forms Management, 1120 N Street, MS-89, Sacramento, CA 95814. 1. REPORT NUMBER 2. GOVERNMENT ASSOCIATION NUMBER 3. RECIPIENT'S CATALOG NUMBER CA-17-2969 4. TITLE AND SUBTITLE 5. REPORT DATE A Comparative Analysis of High Speed Rail Station Development into Destination and/or Multi-use Facilities: The Case of San Jose Diridon February 2017 6. PERFORMING ORGANIZATION CODE 7. AUTHOR 8. PERFORMING ORGANIZATION REPORT NO. Anastasia Loukaitou-Sideris Ph.D. / Deike Peters, Ph.D. MTI Report 12-75 9. PERFORMING ORGANIZATION NAME AND ADDRESS 10. WORK UNIT NUMBER Mineta Transportation Institute College of Business 3762 San José State University 11. CONTRACT OR GRANT NUMBER San José, CA 95192-0219 65A0499 12. SPONSORING AGENCY AND ADDRESS 13. TYPE OF REPORT AND PERIOD COVERED California Department of Transportation Final Report Division of Research, Innovation and Systems Information MS-42, PO Box 942873 14. SPONSORING AGENCY CODE Sacramento, CA 94273-0001 15. SUPPLEMENTARY NOTES 16. ABSTRACT As a burgeoning literature on high-speed rail development indicates, good station-area planning is a very important prerequisite for the eventual successful operation of a high-speed rail station; it can also trigger opportunities for economic development in the station area and the station-city. At the same time, “on the ground” experiences from international examples of high-speed rail stations can provide valuable lessons for the California high-speed rail system in general, and the San Jose Diridon station in particular. -

Ig Nahverkehr
IG NAHVERKEHR LandesArbeitsGemeinschaft Berlin –- Verkehrsforum Erarbeitet Juni 2017 Aktualisiert Oktober 2018 25.10.2018 Verkehrserschließung der Neubaugebiete Wasserstadt Oberhavel / Gartenfeld In der Koalitionsvereinbarung für 2016 bis 2021 heißt es (in den Abschnitten „Quartiersleitli- nien und neue Stadtquartiere …“ und „Öffentlichen Personennahverkehr bedarfsgerecht ausbauen“): „Für neue Stadtquartiere muss eine leistungsfähige ÖPNV-Erschließung ge- währleistet sein.“ … „… wird die Koalition sicherstellen, dass bei der Aufstellung von Bebau- ungsplänen … die Anforderungen durch einen Straßenbahnbetrieb berücksichtigt werden.“ Grundsätzliche Aussagen dazu finden sich im „Leitbild Moblität in Berlin“ der LINKEN vom Mai 2015, insbesondere in den Kapiteln „Was wir wollen“ und „Verkehrsvermindernde Stadt- planung“. Beschreibung der Entwicklungsgebiete Die Wasserstadt Oberhavel im Bezirk Spandau besteht aus Wohngebieten beiderseits der Havel, westlich zum Ortsteil Hakenfelde, östlich zum Ortsteil Haselhorst gehörend. Ge- schätzt 70 bis 80 % der Flächen sind bereits bebaut, überwiegend mit 4- bis 6-Geschossern, nördlich der Rhenaniastraße in Haselhorst auch mit 2- und 3-Geschossern. Konzentrierter Wohnungsbau findet zur Zeit in Hakenfelde im Winkel zwischen Mertens- und Goltzstraße statt. In Haselhorst sind beiderseits der Daumstraße noch Brachflächen erkennbar, die be- baut werden sollen. Das Entwicklungsgebiet Gartenfeld gehört zum Ortsteil Siemensstadt und beinhaltet die Insel im Dreieck zwischen dem Alten und dem Neuen Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal. Das ist das derzeitige Betriebsgelände der Firma TRIKO mit Lagerhallen. Gemäß Entwurf zur Änderung des Flächennutzungsplans soll die „gewerbliche Baufläche umstrukturiert und Wohnbaufläche geschaffen“ werden. Eine überörtliche Hauptstraße und eine Bahntrasse sollen das Gebiet parallel zum Neuen Spandauer Schifffahrtskanal etwa in der Mitte von Südost nach Nordwest durchqueren und am Westrand den Alten Spandauer Schifffahrtska- nal überqueren. Die beiden Entwicklungsgebiete grenzen aneinander. -

Vorlage – Zur Beschlussfassung –
Drucksache 18/3593 14.04.2021 18. Wahlperiode Vorlage – zur Beschlussfassung – Änderung des Berliner Flächennutzungsplans (FNP Berlin) Abgeordnetenhaus von Berlin Seite 2 Drucksache 18/3593 18. Wahlperiode Der Senat von Berlin - StadtWohn I B 12 - Tel.: 90139-5873 An das Abgeordnetenhaus von Berlin über Senatskanzlei - G Sen - V o r b l a t t Vorlage - zur Beschlussfassung - über eine Änderung des Berliner Flächennutzungsplans (FNP Berlin) A. Problem Aus der Veränderung örtlicher Rahmenbedingungen und der Weiterentwicklung von teilräumlichen Planungszielen und gesamtstädtischen Nutzungsvorstellungen ergibt sich die Notwendigkeit, den Flächennutzungsplan zu ändern. Indem der FNP ständig auf diese Veränderungen eingeht, erfüllt er seine stadtentwicklungspolitische Funktion als eine wesentliche Grundlage für die Steuerung einer nachhaltigen Stadtentwicklung. B. Lösung Änderungen des Flächennutzungsplans. C. Alternative / Rechtsfolgenabschätzung Keine. Der Flächennutzungsplan entwickelt als vorbereitender Bauleitplan gegenüber Behörden und Trä- gern öffentlicher Belange unmittelbare Bindungswirkung. Die rechtsverbindliche Wirkung gegen- über Dritten wird durch die aus dem Flächennutzungsplan zu entwickelnden verbindlichen Bauleit- pläne (Bebauungspläne) erfolgen. Diese sind Grundlage für die Anwendung des Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung. D. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und / oder Wirtschaftsunternehmen: Keine. E. Gesamtkosten Keine. F. Flächenmäßige Auswirkungen Entsprechend Inhalt der Vorlage. 2 G. Auswirkungen -

Mobilitätswende in SPANDAU: Alles Auf GRÜN
Mobilitätswende in SPANDAU: Alles auf GRÜN. Grünes Verkehrskonzept Unser Anspruch auf Mitgestaltung der Mobilitätswende ..................................................................... 2 1. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) ................................................................................. 4 2. Radverkehr in Spandau ............................................................................................................. 8 3. Fußverkehr in Spandau ........................................................................................................... 11 4. Motorisierter Individualverkehr & Wirtschaftsverkehr .......................................................... 13 5. weitere Verkehrsmittel ............................................................................................................ 15 1 Unser Anspruch auf Mitgestaltung der Mobilitätswende Wir, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Spandau, legen hiermit ein selbstständiges Verkehrskonzept für Spandau vor. Wir sind davon überzeugt, dass Spandau eine Mobilitätswende benötigt und diese auch politisch gestaltet werden muss. Dabei wollen auch wir gewährleisten, dass wie bisher auch jede*r Spandauer*in selbst entscheiden kann, welches Verkehrsmittel er oder sie nutzen möchte. Hierbei wird es zu Veränderungen und Einschnitten in den verschiedenen Bereichen und Flächen der verschiedenen Verkehrsmittel kommen. Wir dürfen insbesondere nicht ignorieren, dass die verschiedenen Verkehrsmittel in einer Flächenkonkurrenz zueinander stehen. Wenn wir die Mobilität in -

Les Ceintures Ferroviaires Des Grandes Agglomerations Et Amenagement Urbain ______
INSTITUT D'AMÉNAGEMENT & URBANISME DE LILLE LES CEINTURES FERROVIAIRES DES GRANDES AGGLOMERATIONS ET AMENAGEMENT URBAIN _______ Expériences en Europe et projets pour la ceinture ferroviaire lilloise Master 2 AUDT Spécialité "Ville et Projets" Tuteur professionnel : M.DUBUS (RFF) Année 2006-2007 Tuteur universitaire : M.L'HOSTIS Rapport atelier de groupe Atelier réalisé par : Marie BOULANGER, Caroline CANY, Aurore KRESSER, Antoine QUELAVOINE Les ceintures ferroviaires des grandes agglomérations : expériences en Europe et projets pour Lille SOMMAIRE Remerciements ................................................................................................................................................................................................. 3 Introduction....................................................................................................................................................................................................... 4 PARTIE 1 : LES CEINTURES FERROVIAIRES EN EUROPE ET DANS LE MONDE Section 1 : REALISATION DE L'INVENTAIRE I – Méthodologie et définition...................................................................................................................................................................... 5 A – Méthodologie ........................................................................................................................................................................................ 5 B – La notion de ceinture ferroviaire........................................................................................................................................................ -

Bauinfoportal
Siemensbahn Reaktivierung Die von 1927 bis 1929 erbaute Siemensbahn ist eine S-Bahn-Strecke in Berlin und verläuft auf 4,5 Kilometern von Jungfernheide bis Gartenfeld. Die Strecke erschließt dabei die Siemensstadt auf dem Schienenweg. Seit dem Eisenbahnerstreik im September 1980 ist sie außer Betrieb. Mit der Entscheidung der Siemens AG, das Areal auf dem Industriegelände in Berlin-Spandau neu zu gestalten, ist auch geplant, die Verbindung bis Ende 2029 zu reaktivieren. Das großflächige Industrieareal wird zu einem innovativen, vielfältigen und urbanen Stadtteil ausgebaut. Es ist geplant, die Strecke der Siemensbahn bis zum Jahr 2029 zu reaktivieren (Februar 2020) [Quelle: Deutsche Bahn AG/Jonas Holthaus] Projekt In den nächsten Jahren entstehen dort circa 10.000 neue Wohnungen. Gleichzeitig werden im Zusammenwirken von Wissenschaft und Wirtschaft Schlüsseltechnologien und Innovationsfelder gestärkt. Dafür möchte die Siemens AG Forschungs-, Fach- und Gründungszentren ansiedeln – ebenso wie außeruniversitäre und wissenschaftliche Einrichtungen sowie deren Partnerunternehmen. Für dieses Entwicklungsgebiet ist eine gute Verkehrsanbindung entscheidend. Die Planungen hierfür sind jedoch sehr anspruchsvoll. Insbesondere sind dabei Auflagen des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. Der Bahnhof Jungfernheide erhält außerdem zum Anschluss an die Ringbahn eine dritte Bahnsteigkante. https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/siemensbahn-reaktivierung PDF erzeugt am 18. August 2021 © Deutsche Bahn AG Seite 1 Des Weiteren muss eine rund 70 Meter lange Brücke über die Spree gebaut werden. Die vorhandene Trasse der Siemensbahn wird mit den gegebenen Trassierungsparametern von maximal 60 km/h reaktiviert. Beim notwendigen Neubau der Strecke zwischen dem Bahnhof Jungfernheide und der zweiten Spreequerung wird im gegebenen Linienverlauf eine Höchstgeschwindigkeit auf der Strecke von 80 km/h angestrebt. Für die Reaktivierung der Siemensbahn müssen rund zehn Kilometer Gleise verlegt und neue Weichen eingebaut werden. -

Wiederinbetriebnahme Der Siemensbahn Aus SIGNAL 02/2019 (Juli 2019), Seite 15-19 (Artikel-Nr: 10004215) Berliner Fahrgastverband IGEB
i2030 Wiederinbetriebnahme der Siemensbahn aus SIGNAL 02/2019 (Juli 2019), Seite 15-19 (Artikel-Nr: 10004215) Berliner Fahrgastverband IGEB Als am 4. Oktober 2017 mit der Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung der offizielle Startschuss für i2030 gegeben wurde, war die Wiederinbetriebnahme S-Bahnhof Siemensstadt, unter Denkmalschutz, der Siemensbahn noch nicht einmal Bestandteil des Teilprojektes seit 1980 ohne Züge. Der Bahnhof soll der zentrale ÖPNV-Zugang zum geplanten »Engpassbeseitigung und Weiterentwicklung S-Bahn-Netz« Siemensstadt 2.0-Campus werden. (Foto: Florian Müller) Ein Jahr später einigten sich Berlin und Siemens, dem schwächelnden Industrieund Wohnstadtteil Siemensstadt eine neue Chance zu geben und ihn als »Siemensstadt 2.0« zukunftsfähig zu machen. Am 31. Oktober 2018 verkündete Berlin: »Die In der ersten Karte zu i2030 vom 4. Oktober 2017 (Abb. links) war die Siemensbahn noch gar Siemens AG hat sich klar zum Industriestandort Deutschland und zur nicht eingezeichnet. Dann wurde ihre Wiederinbetriebnahme Bestandteil des Innovationsmetropole Berlin bekannt. Mit einer Investition von über 600 Millionen Teilprojektes »Engpassbeseitigung und Weiterentwicklung im S-Bahn-Netz« (Abb. Mitte Euro wird das Unternehmen am traditionsreichen Standort Siemensstadt zusammen von 2018). Inzwischen ist die Siemensbahn ein eigenes, neuntes i2030-Teilprojekt (rechts, Grafik mit dem Bezirk [Spandau] und dem Senat einen neuen Stadtteil entwickeln, der vom Mai 2019). (Grafiken: VBB GmbH) moderne Urbanität, also die Verbindung verschiedener Nutzungen wie Arbeiten, Wohnen, Freizeitgestaltung vereint.« Damit nicht genug: Am 8. April 2019 teilte der Berliner Senat mit: »Ab heute reiht sich die Siemens AG mit dem Siemensstadt-Projekt als 11ter Ort in die Reihe der Im wirksamen Flächennutzungsplan (links) ist die Berliner Zukunftsorte ein.« Siemensbahn mit einer Verlängerung von Gartenfeld um zwei Stationen bis in den Ortsteil Hakenfelde dargestellt. -
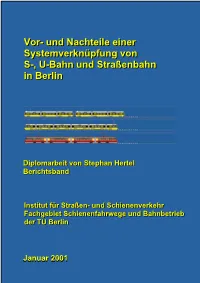
U -B Ahnund S Tra ß Enbahn In
VVoorr-- uunndd NNaacchhtteeiillee eeiinneerr SSyysstteemmvveerrkknnüüppffuunngg vvoonn SS--,, UU--BBaahhnn uunndd SSttrraaßßeennbbaahhnn iinn BBeerrlliinn DDiipplloommaarrbbeeiitt vvoonn SStteepphhaann HHeerrtteell BBeerriicchhttssbbaanndd IInnssttiittuutt ffüürr SSttrraaßßeenn-- uunndd SScchhiieenneennvveerrkkeehhrr ''aacchhggeebbiieett SScchhiieenneennffaahhrrwweeggee uunndd BBaahhnnbbeettrriieebb ddeerr TTUU BBeerrlliinn Januar 200011 Vor- und Nachteile einer Systemverknüpfung von S-, U-Bahn und Straßenbahn in Berlin Berichtsband Diplomarbeit am Institut für Straßen- und Schienenverkehr Fachgebiet Schienenfahrwege und Bahnbetrieb der Technischen Universität Berlin Prof. Dr.-Ing. habil. J. Siegmann Betreuerin: Dipl.-Ing. C. Große vorgelegt von cand.-ing. Stephan Hertel Matr.-Nr. 97217 Berlin, den 08.01.2001 Die selbständige und eigenhändige Anfertigung dieser Arbeit versichere ich, Stephan Hertel, an Eides Statt. Berlin, den ................................... ...................................................... (Unterschrift) Systemverknüpfung von S-, U-Bahn und Straßenbahn i Zusammenfassung Zusammenfassung Die Untersuchung der Möglichkeiten für Systemverknüpfungen von Straßenbahn, U-Bahn und S- Bahn zeigt deutlich, daß durch gezielte Verknüpfungsmaßnahmen ein Nutzen zugunsten von Betreiber und Kunden auftreten kann. Als ideal stellt sich die Systemverknüpfung von Tram und Kleinprofil-U-Bahn in Berlin dar. Die wenigen technischen Systemunterschiede erlauben eine besonders kostengünstige Form des Mischbetriebs, was die Entwicklungschancen -

Mitteilung – Zur Kenntnisnahme –
Drucksache 18/2865 07.08.2020 18. Wahlperiode Mitteilung – zur Kenntnisnahme – Rad- und Wanderweg an der Spree schnellstmöglich fertig stellen Drucksachen 18/0725 Neu, 18/0841, 18/1197, 18/1533, 18/2091 und 18/2413 – Wiederkehrender Bericht – Abgeordnetenhaus von Berlin Seite 2 Drucksache 18/2865 18. Wahlperiode Der Senat von Berlin UVK IV B 31 Tel.: 9025-2651 An das Abgeordnetenhaus von Berlin über Senatskanzlei - G Sen - M i t t e i l u n g - zur Kenntnisnahme - über Rad- und Wanderweg an der Spree schnellstmöglich fertig stellen - Drucksachen Nrn. 18/0725 Neu, 18/0841, 18/1197, 18/1533, 18/2091 u. 1872413 - - Wiederkehrender Bericht - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Der Senat legt nachstehende Mitteilung dem Abgeordnetenhaus zur Besprechung vor: Das Abgeordnetenhaus hat in seiner Sitzung am 22.02.2018 Folgendes beschlossen: „Der Senat wird aufgefordert, umgehend alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um den Rad- und Wanderweg entlang der Spree schnellstmöglich fertig zu stellen. Die noch fehlenden Bauplanungsunterlagen (BPU) für Abschnitte in den Bezirken Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf und Spandau sind umgehend zu erstellen. Bürgerinitiativen und Anwohnerschaft sind im Vorfeld früh genug zu informieren und in die Planungen einzubeziehen. Im Anschluss sind die entsprechenden Baumaßnahmen umzusetzen und abzuschließen. Notwendige Abstimmungen im Zusammenhang mit dem Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 17 (VDE 17) sind umgehend mit den betreffenden Bundesbehörden -

I2030 Ein Kurzer Einblick
i2030 Ein kurzer Einblick Schieneninfrastrukturentwicklung für Berlin und das Umland Brandenburg Stand April 2020 i2030 Warum gibt es das Programm? Zur Umsetzung der verkehrlichen und politischen Zielstellungen wurde das Programm i2030 initiiert. Seite 2 i2030 Hintergründe: Nahtlose Schnittstelle Platz in der Stadt! Perspektiven für das zwischen EU- Land! Verkehrsnetz und städtischer Mobilität! Ein generell steigendes Mehr Schienenverkehr Brandenburger Region Verkehrsaufkommen schafft mehr rückt näher an die City. auf der Schiene wird Lebensqualität: Das entlastet den bei den integrierten weniger Stau, weniger Wohnungsmarkt im Planungen mitgedacht. zugeparkte Straßen Verdichtungsraum und Entscheidend ist dabei und Plätze, weniger wertet die Gemeinden eine Infrastruktur, die Lärm, dafür saubere der „zweiten Reihe“ auf, Entlastung bietet, um Luft und mehr Raum für sichert die soziale Engpässe im Fußgänger, Radfahrer Infrastruktur und bietet Personen- und sowie Flächen mit Potenziale zum Güterverkehr zu hoher attraktiven Leben, beseitigen. Aufenthaltsqualität. Wohnen Zuverlässig, schnell Klimaziele einhalten! und bequem unterwegs! Dichte Takte, kürzere Die Verkehrswende Fahrzeiten und mehr zum umweltfreund- Platz in der Bahn lichen Verkehr liefert erleichtern Verzicht einen entscheidenden aufs Auto. Beitrag zur Umsetzung Dabei wird in modernen der gemeinsamen Seite 3 Zügen Reisezeit zur Klimaziele. Nutzzeit i2030 Wo stehen wir, und wie geht es weiter? Planungen brauchen Zeit, auch wenn viele lieber sofort losbauen würden. ▪ Ergebnisoffenes