Marktredwitz in Weiter Verkehrsferne Liegen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
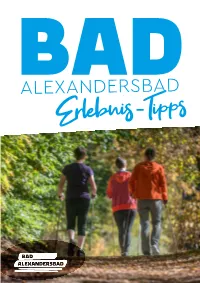
Bad Alexandersbad Quelle Meiner Kraft
BADALEXANDERSBAD Erlebnis Vorwort Bad Alexandersbad Quelle meiner Kraft. ir heißen Sie in Bad Alexandersbad, dem kleinsten Heilbad Bayerns, herzlich will- W kommen. Bei uns erwartet Sie moderne Gesundheitsvorsorge mit den traditionellen ortsge- bundenen Heilmitteln Heilwasser der Luisenquelle und Naturmoor. Hier finden Sie Erholung und Ent- spannung in unberührter Natur inmitten des Natur- parks Fichtelgebirge. Ihr Peter Berek Erster Bürgermeister Inhalt 4 Geschichte & Zukunft 12 Gesundheit & Prävention 6 Tradition trifft Innovation 14 Traditionelle Heilmittel Wir interpretieren Tradition neu – Tauchen Sie in unsere Naturschätze in den Bereichen Gesundheit & Städtebau. ein und spüren Sie die Wirkung von Heilwasser und Naturmoor. 8 Ein Heilbad mit kraftvoller Geschichte 16 Therapieangebote Es ist beeindruckend, wie unsere Tanken Sie Kraft bei einer Behandlung Heilquelle die Ortsgeschichte prägt. durch unsere Physiotherapeuten. 10 Kraft auf ganzer Linie 18 Innovative Gesundheitsangebote Kommen Sie – wir nehmen Sie Entwickeln Sie mit uns nachhaltig auf einen Spaziergang mit. einen gesunden Lebensstil. 2 Bad Alexandersbad Inhalt 20 ALEXBAD 36 Ausflugsziele Wählen Sie Bad Alexandersbad als 22 Gesundheitserlebnisse Startpunkt für kulturelle Ausflüge. Nehmen Sie sich Zeit für sich und lassen Sie sich treiben. 38 Kulinarik & Einkaufen Bei uns werden feinste regionale 24 Kraftquellen Zutaten sorgsam zubereitet. Wir laden Sie zu einer Auszeit inmitten unberührter Natur ein. 40 Gastgeber 26 Natur & Aktiv 42 Übernachten Unsere Gastgeber empfangen Sie 28 Outdoor-Aktivitäten mit Herzlichkeit, Gastlichkeit und Verschiedene Wander- und Radwege oberfränkischem Charme. führen durch die außergewöhnliche Felsenlandschaft des Fichtelgebirges. 44 Tagen Tagen Sie in ruhiger und idyllischer 30 Ausflugsziele Lage mitten in der traumhaften Wählen Sie Bad Alexandersbad als Landschaft des Fichtelgebirges. Startpunkt für Ausflüge in die Natur. -

Selbst Portrait Journal Für Selb Und Umgebung Mit Veranstaltungskalender
SELBST PORTRAIT JOURNAL FÜR SELB UND UMGEBUNG MIT VERANSTALTUNGSKALENDER Abstrakte Malereien offen für Interpretationen Seite 3 1. Bayerisch- Tschechisches Drachenfest Seite 4 „Stille Stars“ in Film und Werbung Seite 5 Landkreisturnier der Jugendverkehrs- schulen in Selb Seite 14 Ebru-Kunst bei SelbKultur Seite 16 September 2019 SELBST PORTRAIT Rathaus IMPRESSUM: 3000. Besucher auf dem Wohnmobilstellplatz Herausgeber: Mit knapp 40.000 Übernachtungen Stadt Selb im Jahr zählt Selb zu einem der be- Ludwigstraße 6 liebtesten Urlaubsorte in der Regi- on. So ist es auch nicht verwunder- 95100 Selb lich, dass auch auf dem städtischen Verantwortlich Wohnmobilstellplatz im Papier- für den Inhalt: mühlweg reges Treiben herrscht. Oberbürgermeister Anfang August konnte der 3.000. Ulrich Pötzsch Besucher auf dem Stellplatz be- grüßt werden und Oberbürgermeis- Redaktion: ter Ulrich Pötzsch freute sich ganz Kristina Stoll, besonders den Eheleuten Krämer Tel. 09287 883-113, persönlich zu gratulieren. Familie [email protected] Krämer aus dem niedersächsischen Kristina Rödig, Emsland ist bereits zum dritten Mal Tel. 09287 883-118, mit ihrem Wohnmobil in Selb zu und in den Sanitärgebäuden. Auch auf den Weg nach Selb machen [email protected] Gast. Besonders gut gefällt ihnen im nächsten Jahr möchten sich die und den Stellplatz im Papiermühl- die Barrierefreiheit auf dem Gelände beiden zum Porzellinerfest wieder weg anfahren. Verantwortlich für die Anzeigen: Sarah Thon und Lars Wawrzik, Druck u. Verlag Eheschließungen Oberweißenbach 44, 95100 Selb Der Selb-Knirps Reiner Zörntlein 27.07.2019 24.08.2019 Hohenberger Str. 49, Julia Grobosch, Hölderlinweg 1, ist da 95100 Selb, Sven Wolfgang Hollering und 95100 Selb und Sandro Werner Seit nun knapp zwei Jahren bietet Tel. -

Vier Flüsse – Vier Himmelsrichtungen Unterwegs an Der Hauptwasserscheide Europas
MEDIEN -INFORMATION Januar 2019 Vier Flüsse – vier Himmelsrichtungen Unterwegs an der Hauptwasserscheide Europas Fichtelberg/München, 29. Januar 2019. Der erste fließt nach Norden, der zweite nach Süden, der dritte nach Osten und der vierte nach Westen – das Fichtelgebirge ist eine europäische Wasserscheide, von der die vier Flüsse Sächsische Saale, Fichtelnaab, Eger und Weißer Main ihre Wasser in alle vier Himmelsrichtungen aussenden. Neben diesen vier Hauptquellen entspringen in der Region zahlreiche kleine Quellen, die es per pedes oder mit dem Fahrrad zu entdecken gilt. Denn das wald- und gesteinsreiche Fichtelgebirge zeichnet sich nicht nur durch das hohe Granit- Vorkommen, sondern auch durch seine über 1.200 kartierten Quellen aus. v.l.n.r.: Flusslandschaft Weißer Main, Panoramabad im ALEXBAD, Egerquelle. © Tourismuszentrale Fichtelgebirge e.V. Radeln und Wandern „mit dem Strom“ Auf speziellen Themenwegen geht es für Aktive entlang der vier Hauptquellen Sächsische Saale, Eger, Weißer Main und Fichtelnaab, die unter anderem wichtige Zubringer für bedeutende deutsche Flüsse wie Elbe, Donau und Main sind. Der Fichtelnaab Radweg beginnt am Ursprung des Flusses in den Höhen des Fichtelgebirges bei Fichtelberg. Auf 56 Kilometern führt er über interessante Ortschaften in der Oberpfalz – wie beispielsweise Brand, dem Geburtsort des Komponisten Max Reger – und durch die Felsenwelt des Naturparks Steinwald sowie das malerische Waldnaabtal im Oberpfälzer Wald bis zum GEO-Zentrum in Windischeschenbach. Die Weißmainquelle entspringt in Bischofsgrün – hier startet der Mainradweg, auf dem es meist talabwärts vorbei an romantischem Fachwerk in Bad Berneck und markgräflichem Prunk in Kulmbach geht. Der Eger-Radweg, der 2019 komplett neu konzipiert wird, eignet sich dank seiner geringen Steigungen vor allem gut für Familien. -

Liniennetzplan Der VGF VGF-Linienverzeichnis
hf sb D u f B B h Liniennetzplan der VGF 8 VGF-Linienverzeichnis Liniennetzplan der VGF b VGF-Linienverzeichnis t p 5 u Abzw. Sophienreuth 8 Asch a B Rehau Erklärung der Zeichen: H D Hof 1 Abzw. Siedlung Schönwald Liniennummer Linienverlauf Schwarzen- Porzellanfabrik 000060 Gemeinde / Stadt mit gesondertem Linien- Neue Str. W., Wirts- netzplan (mit allen Haltestellen) bach/Saale Rathaus Lauterbach häusl (Hof) - Schönwald - Selb - Thierstein - Schönwald Wildenau, Grenze 1 Gemeinde / Stadt ohne eigenen Liniennetz- Schule Höchstädt - Thiersheim - Marktredwitz Selber Str. 2 15 W., Fw-Haus plan Vielitz, Plößberg Erkersreuth (7601) Siedlung Prinzenweg 1 Mühlbach Buchhaus Haltestelle mit Haltestellenbezeichnung Schatzbach 2 Wunsiedel - Bernstein / Göpfertsgrün - Hutschenreuther B Markt 19 Thiersheim - Arzberg - Schirnding Umsteigehaltestelle (Bus/Bus) Erkersreuth 4 D (7602 / 7619) Bahnhof B8 15 Selb-Plößberg DB 5 Umsteigehaltestelle (Bus/Bus und Bus/Bahn) 5 Kirchenlamitz Ost, Vielitz Selb-Nord Marktredwitz - Wunsiedel - Tröstau - Oberschieda Bahnhof 3 B Nagel - Mehlmeisel - Fichtelberg (7603) DB Bahnhof Umsteigehaltestelle (Bus/Bahn) D Bahnhof Schiller- Selb Bahnüberg. DB straße Röslau Haltepunkt der DB AG Steinselb Ober- 11 11 Längenau (Hof) - Kirchenlamitz - Marktleuthen - Nieder- weißenbach Sommer- Dürre- Schützenhaus lamitz Spielberg 4 7 VGF-Buslinien (1 - 24) 5 11 mühle wiesen Buchwald Röslau - Wunsiedel - Marktredwitz (7604) Abzw. Vorwerk Schule Stein- Mittelw. 8509 sonstige Buslinien Abzw. Niederl. Mittelweißenbach 24 Großw., mühle Nord 6 Weißenst. Abzw. Unter- Selb - Marktleuthen - Röslau - DB 855 Bahnlinien (855, 858, 860) Kirchenlamitz Straße Großw., Ort Spiel- 5 Wunsiedler berg weißenbach Bahnüberg. Heidelheim Stabhammer Abzw. Wellerthal Wunsiedel (7605) Fuchsmühle Str. Fahrtrichtung Überbruck Abzw. vollständige Darstellung im Landkreisgebiet 24 Raumeten- Bahnhof Großwendern Schwarzenhammer grün Buchhaus DB Kaiserhammer Selb - Hohenberg - Schirnding - Sparneck und Hofer Str. -

Charles University in Prague Faculty of Social Sciences Institute of Political Studies
Charles University in Prague Faculty of Social Sciences Institute of Political Studies Master’s Thesis Breaking Down Barriers: Euroregional Cooperation of the Czech Republic Author: Bc. Karen Benko Subject: IEPS Supervisor: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D Academic Year: 2013/2014 Date of Submission: May 14, 2014 Declaration of Authorship I hereby declare that this thesis is my own work, based on the sources and literature listed in the appended bibliography. The thesis as submitted is 130,962 keystrokes long including spaces, i.e. 51 manuscript pages excluding the initial pages, the list of references and appendices. Prague, 14.05.2014 Bc. Karen Benko 2 Acknowledgement I would like to express my gratitude to my supervisor, PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D, for her guidance during the writing process. 3 Abstract: Cooperation between people of different nations has existed throughout Europe for centuries on an informal basis as borders have shifted and power has found its way into different hands. During the European integration process of the 1950s, this cooperation was formalized with the creation of the Euroregions, or cross-border regions. These regions were formed to promote common interests and cooperation to counteract barriers and benefit the people residing in the area. The Czech Republic is currently a member of 13 different Euroregions either exclusively or with multiple neighboring countries: Poland (7), Austria (3), Germany (4), and Slovakia (2). Of these 13 regions, four – Silva Nortica (Czech-Austrian, 2002), Bílé-Biele Karpaty (Czech- Slovak, 2000), Silesia (Czech-Polish, 1998), and Egrensis (Czech-German, 1993) – have been chosen to further evaluate how the creation of Euroregions has facilitated regional development. -

Bürgerbote; Mai 2011
GERB BURGER R O Ü T Informationen aus der Brücken-Allianz Bayern-Böhmen e.V. B E ¨ 069 Auflage 9.000 Mai 2011 Bote Für herausragende Dienste für die Brücken-Allianz Bayern-Böhmen e.V. „Wir sagen danke!“ Von links: Bürgermeister Reiner Wohlrab - Schirnding, Dieter Thoma, Bürgermeister Jürgen Hoffmann THEMEN - Hohenberg an der Eger, Bürgermeister Stefan Göcking - Arzberg Attraktiv (S. 2) Thiersheim ... natürlich Der ehemalige Bürgermei- sitzender der Brücken-Alli- Zum neuen stellvertre- Grenzenlos (S. 5) ster der Stadt Hohenberg anz, würdigte die herausra- tenden Vorsitzenden der Neuer Geschäftsführer an der Eger – Dieter Tho- genden Verdienste von Die- Brücken-Allianz Bayern- Informativ (S. 6) ma – war seit Gründung der ter Thoma und überreichte Böhmen e.V. wurde Schirn- Postkarten-Ausstellung Brücken-Allianz Bayern- ihm als Dank zum Abschied dings Bürgermeister Reiner Aktiv (S. 11) Böhmen e.V. im Februar einen Blumenstrauß und Wohlrab gewählt. Die Auf- Gausternwanderung 2004 stellvertretender Vor- ein Porzellangeschenk. gabe des Schatzmeisters Gemeinsam (S. 12) Ein Lauftag für alle sitzender. Als Gründungs- Auf dem – in Porzellan ge- übernimmt ab sofort der Professionell (S. 13) mitglied der Brücken-Alli- branntem – Bild sind Motive frisch gebackene Hohen- Jugendcamp anz stand er von Anfang an aus allen sechs Allianzge- berg Bürgermeister Jürgen Unterhaltsam (S. 14) hinter diesem kommunalen meinden zu sehen, es war Hoffmann. The Beatles Tribute Zusammenschluss und das Titelbild der 13. Ober- Veranstaltungskalender unterstütze tatkräftig alle fränkischen Malertage, ge- Als Abschiedgeschenk auf den Seiten 7 - 10 Ideen und Projekte im Lau- malt von Christel Gollner wurde Dieter Thoma das fe der letzten sieben Jahre aus Bayreuth. Titelbild der 13. -

Wegweiser Für Senioren
Wegweiser für Senioren www.landkreis-wunsiedel.de Sie suchen ein sicheres Zuhause SENIORENRESIDENZ für ein gepflegtes Leben im Alter? MARKTREDWITZ Willkommen bei uns! Im Jahr 2014 eröffnete Residenz mit 129 stationären Pflegeplätzen Extras für Ihr Wohlbefinden: • Vitalclub • Raum der Sinne • Wohlfühlbad K&S Seniorenresidenz Marktredwitz Kraußoldstraße 5 | 95615 Marktredwitz | Telefon: 0 92 31 / 9 73 05 0 | Fax: 0 92 31 / 9 73 05 100 www.ks-unternehmensgruppe.de Sie suchen ein sicheres Zuhause SENIORENRESIDENZ für ein gepflegtes Leben im Alter? MARKTREDWITZ Willkommen bei uns! Im Jahr 2014 eröffnete Residenz mit 129 stationären Pflegeplätzen Extras für Ihr Wohlbefinden: • Vitalclub • Raum der Sinne • Wohlfühlbad K&S Seniorenresidenz Marktredwitz Kraußoldstraße 5 | 95615 Marktredwitz | Telefon: 0 92 31 / 9 73 05 0 | Fax: 0 92 31 / 9 73 05 100 www.ks-unternehmensgruppe.de Unser Leitbild! Unser◗ Verkürzung Leitbild! von Krankenhausaufenthalten Unser◗ Nachsorge Leitbild! von Operationen und Wunden ◗ Verkürzung von Krankenhausaufenthalten ◗ Verkürzung von ◗Krankenhausaufenthalten Vermeidung von Heim-Aufenthalten ◗ Nachsorge von Operationen◗ Entlastung und der Wunden Angehörigen ◗ ◗Vermeidung Nachsorge von von Heim-Aufenthalten Operationen◗ Förderung der Gesundheitund Wunden ◗ ◗Entlastung der Angehörigen◗ Einbindung in die Gesellschaft ◗ Vermeidung von Heim-Aufenthalten Förderung der Gesundheit◗ Aktivierende Pfl ege ◗ ◗Einbindung Entlastung in dieder Gesellschaft Angehörigen ◗ ◗Aktivierende Förderung Pflege der GesundheitFlexibilität, Einsatzbereitschaft, -

Jugendübernachtungshäuser Und Zeltplätze in Oberfranken Selbstversorgerhaus Behindertengerecht Nach Einrichtungsname Bettenanzahl
Jugendübernachtungshäuser und Zeltplätze in Oberfranken Selbstversorgerhaus behindertengerecht nach Einrichtungsname Bettenanzahl Einrichtungsname Straße PLZ Ort Landkreis Telefon Fax e-mail Website Einrichtungsart "Räuberschlößl" Birkenbühl Fichtelgebirge Schloß 95199 Thierstein-Birkenbühl Wunsiedel 097973/5613 07973/910734 [email protected] Jugendübernachtungshaus ja 18 - Bert-Nowak-Haus Röthenweg 96215 Rothmannsthal Lichtenfels 0911/262766 0911/269283 [email protected] www.dpsg-bamberg.de Sonstige ja 40 X Blockhütte Neukirchen Mühlgasse 3 96450 Coburg Coburg 09561/95762 09561/238605 [email protected] www.sjr-coburg.de Jugendübernachtungshaus ja 15 - des Bund Naturschutz Coburg BLSV-Sport- und Jugendheim Fichtelseestraße 23 a 95686 Fichtelberg/Neubau Bayreuth 09272/324 09272/6097 blsv-jugendheim-fi [email protected] www.blsv.de/sportcamp-fi chtelberg Sonstige nein 84 - Christian-Keyßer-Haus Schillerstr. 14 95131 Schwarzenbach am Wald Hof 09289/1443 09289/6392 [email protected] www.christian-keysser-haus.de Jugendtagungshaus nein 18 - CVJM-Freizeitenheim Lesauer Str. 47 96110 Scheßlitz/Burglesau Bamberg 0951/2996766 [email protected] www.cvjm-bamberg.de Jugendheim ja 30 - CVJM-Freizeitheim Im Seulbitzer Wald 95126 Schwarzenbach/Saale Hof 09284/1370 [email protected] www.cvim.de Jugendübernachtungshaus ja36- CVJM-Jugendheim Trogen Regnitzstr. 12 95183 Trogen Hof 09281/47677 [email protected] www.cvjm-trogen.de Jugendübernachtungshausja20- CVJM-Waldheim Dachstadt Guttenburger Weg 91338 -

Lichtdesign Dient Neben Der Ästhetischen Ge- Staltung Genauso Der Sicherheit Und Barrierefreiheit Von Öffentlichen Räu- Men
Oberfranken leuchtet Von der Idee über das Konzept zur Wirklichkeit INHALT 01 Einleitung 5 Vorwort / Übersicht temporäre Illuminationen / Projekthistorie 02 Light-Faden 15 Schritt für Schritt von der Idee zur Wirklichkeit 03 Plan Lumière – Lichtmasterplan 23 Definition / Merkmale einer tadtS / Lichtplanung in der Städtebauförderung 04 Vergleich 45 Bestand – temporäre Illumination 05 Vision und mögliche Realisierung 71 Nachwort Kontakt / Impressum 78 Einleitung 01 Einleitung 01 Vorwort Licht schafft Emotionen, erzeugt Wär- Die Beiträge der Veranstaltungsreihe me und Vertrauen. Licht verleiht Orten „Oberfranken leuchtet“ haben zur Sen- angenehme Atmosphäre, Stimmung sibilisierung gegenüber dieser Thema- und einzigartigen Charakter. Oberfran- tik einen wichtigen Beitrag geleistet, es ken Offensiv e.V. hat in Zusammenar- wurden nicht nur ausgezeichnete Bei- beit mit der Hochschule Coburg und spiele vorgelegt, sondern der Anstoß dem Coburger Designforum Oberfran- gegeben, innovative Beleuchtungskon- ken e.V. in den letzten Jahren einen zepte auch über die Dauer der zeitlich großen Beitrag zum Einsatz von Licht begrenzten Veranstaltungen hinaus zu in den Städten und Gemeinden der installieren. Lichtmasterpläne und lang- Region geleistet: Seit 2005 sind fast fristige Beleuchtungskonzepte, wie sie 30 Lichtevents durchgeführt worden, zum Beispiel in Bamberg und Bayreuth bei denen immer wieder aufs Neue die bereits umgesetzt werden, sollen am Qualitäten der oberfränkischen Städte Ende des Prozesses stehen. und Gemeinden in Szene gesetzt wurden. -

Landkreis Wunsiedel Im Fichtelgebirge Nr
LANDKREIS WUNSIEDEL IM FICHTELGEBIRGE NR. 28 / Jahresausgabe 2018 Gedanken zum Titelblatt Gewalt gegen Einsatzkräfte Das Titelblatt der diesjährigen Landkreiszei- Mensch oder Tier losgeht, begeht einen Wir sind die Guten und 12 Monate, 52 tung des Kreisfeuerverbands Wunsiedel Mordversuch. Wochen, 365 Tage, ehrenamtlich, unent- widmet sich, aus gegebenen Anlass, dem Wir, die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Roten geltlich und aus Überzeugung helfen zu kön- sehr wichtigen Thema „Gewalt gegen Ein- Kreuz und Technischen Hilfswerk bilden uns nen und zu wollen für Sie da. satzkräfte“. in unserer Freizeit sehr vielseitig in den ver- schiedensten Bereichen fort, um helfen zu IHRE FEUERWEHREN Dieses Thema ist neben den Themen können. Wir geben hier sehr viel Freizeit „Schaulustige behindern Rettungskräfte“ auf, auch unsere Familien müssen sehr oft Armin Welzel ein weiteres Indiz dafür, dass die Arbeit der auf uns verzichten, wenn wir zu Einsatz oder Kreisbrandinspektor Rettungskräfte immer schwieriger wird. Ausbildung unterwegs sind. Hinzu kommen Die Einsatzkräfte aller Hilfsorganisationen nun auch noch Deeskalationstrainings und und der Polizei kommen um zu helfen. Selbstverteidigungskurse, damit wir Ang- Feuerwehrleute und Sanitäter retten dabei, riffen stets angemessen begegnen können. bei vielen ihrer Einsätze, Leben. Hier gibt es nur eine richtige Antwort: Impressum Doch neben Dankbarkeit und Anerkennung Wer Einsatzkräfte verbal oder körperlich an- Herausgeber und Gesamtherstellung: bekommen sie seit einigen Jahren auch greift gehört angezeigt und mit der vollen Kreisfeuerwehrverand Wunsiedel im noch etwas Anderes, etwas Unverständli- Härte des Gesetzes bestraft! Fichtelgebirge e.V. ches zu spüren. Hass, Beschimpfungen, Wenn man verschiedenen Studien zufolge in Intoleranz, Aggressionen und Gewalt spüren manchen deutschen Großstädten als Feuer- Satz und Druck: die Helfer fast täglich bei ihren Einsätzen. -

Tag Der Ffenen Kirchen 5
Tag der ffenen Kirchen 5. Oktober 2014, Erntedank Weidenberg Pilgramsreuth Großwendern Evangelisch-Lutherische Döbra Kirche in Bayern 1 Gemeinsam für die Region Foto: pfarrbriefservice.de 2 Vorwort Liebe Kirchenbesucher und Besucherinnen! Standen Sie schon einmal vor einer Kirche und die Kirchentür war zu? Viele sind enttäuscht, wenn sie das erleben. Doch das wird an Erntedank 2014 in den über 30 beteiligten Gemeinden bestimmt nicht geschehen. Ganz im Gegenteil: Die Erntedankaltäre sind geschmückt, die Kirchen sind offen, überall gibt es einen kleinen Happen zu essen. Von Naila bis Weiden sind Gemeinden beteiligt. Ich danke allen, die sich engagieren und gratuliere allen, die sich zu Fuß, Rad oder Auto auf den Weg machen. Wir haben solch wunderschöne Kirchen! Sie sind der größte sichtbare Ausdruck des christlichen Glaubens. Sie prägen unsere Landschaft und die Ortschaften. Sie sind ihre spirituelle Mitte. Ein Tag der offenen Kirchen! Vielleicht wirkt dieser Tag weiter und bringt Schubkraft für viele Tage offener Kirchen – ja Dr. Dorothea Greiner sogar Jahre offener Kirchen. Unsere Kirchen sind viel zu schade, als dass sie nur zur Gottesdienstzeit betreten werden Regionalbischöfin sollten. Sie sind Raum des Gebetes, der Ruhe, der Begegnung mit Gott – und an Erntedank 2014 hoffentlich Ort der des Kirchenkreises Begegnung vieler Menschen. Sie sind herzlich willkommen. Bayreuth Ihre 3 Tag der offenen Kirchen in Nordostbayern Die Idee eines „Tages der offenen Kirchen“ wurde geboren im Anschluss an die in den größeren Orten statt- findenden „Nächte der Kirchen“. Denn nicht nur in den Städten, sondern auch in den Dörfern und Klein- städten finden sich viele sehr schöne und in den letzten Jahren aufwändig sanierte Kirchen. -

Selb-Wunsiedel
Gut zu wissen! Wegweiser für Familien und Jugendliche Selb-Wunsiedel Wir unterstützen Familien: bilden: - Kindertagesstätten beraten: - Beratungsstellen in Marktredwitz, Selb und Wunsiedel pflegen: - Martin-Schalling-Haus - Paul-Gerhardt-Haus - Diakoniestationen - Fachstelle für pflegende Angehörige - EDE – Entlastung durch Engagierte - DIANA – Betreutes Wohnen zu Hause Diakonisches Werk Selb-Wunsiedel e.V. Bezirksamtsstr. 8 95632 Wunsiedel Telefon 09232 / 9949-0 www.diakonie-wun.de GRUSSWORT Liebe Kinder, Jugendliche und Familien im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge, es ist das erklärte Ziel des Landkreises Wunsiedel i. Fichtelgebirge, ein Lebensumfeld für seine Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, in dem Familie und Beruf gut vereinbar sind. Familien sollen sich hier wohlfühlen. Zusammen mit vielen Organisationen und Ein- richtungen ist es in den vergangenen Jahren gelungen, die Rah- menbedingungen für Familien in unserem Fichtelgebirge ständig zu verbessern. Familienfreundlichkeit ist hier nicht Schlagwort, sondern ständige Aufgabe. Mit einer besonderen Qualität der Bil- dungs- und Betreuungsangebote, einer lebendigen Kultur, zahlrei- chen Sport- und Freizeitangeboten sowie vielen familienfreund- lichen Bau- und Wohngebieten steht den Familien im Landkreis eine umfassende Infrastruktur zur Verfügung. Dennoch stehen Sie als Familie immer wieder vor neuen Aufgaben und Anforderungen, die sich aus den Herausforderungen des All- tags oder finanziellen Fragen ergeben können. Es ist uns deshalb besonders wichtig, gerade Familien frühzeitig zu informieren, zu unterstützen und zu beraten. Mit diesem Familienwegweiser bieten wir Ihnen einen Überblick über das vielfältige Angebot für Kinder, Jugendliche und Familien in unserem Landkreis. Er soll Ihnen helfen, sich bei den Fragen des familiären Zusammenlebens zu orientieren, und Ihnen Entschei- dungen erleichtern. Informieren Sie sich und nutzen Sie die Mög- lichkeiten, die Ihnen hier geboten werden.