Die Kunst Des Vernetzens
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Public Service Broadcasting Resists the Search for Independence in Brazil and Eastern Europe Octavio Penna Pieranti OCTAVIO PENNA PIERANTI
Public Service Broadcasting Resists The search for independence in Brazil and Eastern Europe Octavio Penna Pieranti OCTAVIO PENNA PIERANTI PUBLIC SERVICE BROADCASTING RESISTS The search for independence in Brazil and Eastern Europe Sofia, 2020 Copyright © Author Octavio Penna Pieranti Translation Lee Sharp Publisher Foundation Media Democracy Cover (design) Rafiza Varão Cover (photo) Octavio Penna Pieranti ISBN 978-619-90423-3-5 A first edition of this book was published in Portuguese in 2018 (“A radiodifusão pública resiste: a busca por independência no Brasil e no Leste Europeu”, Ed. FAC/UnB). This edition includes a new and final chapter in which the author updates the situation of Public Service Broadcasting in Brazil. To the (still) young Octavio, who will one day realize that communication goes beyond his favorite “episodes”, heroes and villains Table of Contents The late construction of public communication: two cases ............. 9 Tereza Cruvinel Thoughts on public service broadcasting: the importance of comparative studies ............................................................................ 13 Valentina Marinescu QUESTIONS AND ANSWERS .......................................................... 19 I ........................................................................................................... 21 THE END .............................................................................................. 43 II ........................................................................................................ -
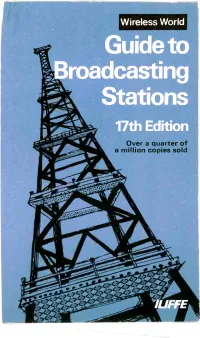
Wireless World
Wireless World Over a quarter of a million copies sold Wireless World Guide to Broadcasting Stations LONDON ILIFFE BOOKS THE BUTTERWORTH GROUP ENGLAND Butterworth & Co (Publishers) Ltd London: 88 Kingsway, WC2B 6AB AUSTRALIA Butterworths Pty Ltd Sydney: 586 Pacific Highway, NSW 2067 Melbourne: 343 Little Collins Street, 3000 Brisbane: 240 Queen Street, 4000 NEW ZEALAND Butterworths of New Zealand Ltd Wellington: 26 -28 Waring Taylor Street, 1 SOUTH AFRICA Butterworth & Co (South Africa) (Pty) Ltd Durban: 152 -154 Gale Street First published in 1946 Seventeenth Edition 1973 Published for 'Wireless World' by Iliffe Books, an imprint of the Butterworth Group R Butterworth & Co (Publishers) Ltd 1973 ISBN 0 592 00081 8 Distributed in the United States of America and Canada by Gilfer Associates, Inc. , P.O, Box 239, Park Ridge, NJ, 07656, U.S.A. Printed in England by The Pitman Press, Bath CONTENTS A GUIDE TO LISTENING 1. Receivers ... 1 2. Aerial and Earth Systems 3 3. Propagation ... 7 4. Signal Identification ... .. 10 5. Reception Reports ... ... 13 LONG- AND MEDIUM -WAVE EUROPEAN STATIONS 1. In order of frequency ... ... 16 2. Geographically 43 SHORT -WAVE STATIONS OF THE WORLD 1. In order of frequency ... 53 2. Geographically 159 EUROPEAN V. H. F. SOUND BROADCASTING STATIONS ... ... 197 ACKNOWLEDGEMENT Thanks are due to the B. B.C. for the lists of broadcasting stations, which were prepared by the Tatsfield Receiving Station. A GUIDE TO LISTENING 1 RECEIVERS It is probably true that the majority of sound radio receivers spend most of their time tuned to local stations. This is a pity because much interest can be derived from listening to more distant stations and even modest receivers can pick up a number of these. -

Must-Carry Rules, and Access to Free-DTT
Access to TV platforms: must-carry rules, and access to free-DTT European Audiovisual Observatory for the European Commission - DG COMM Deirdre Kevin and Agnes Schneeberger European Audiovisual Observatory December 2015 1 | Page Table of Contents Introduction and context of study 7 Executive Summary 9 1 Must-carry 14 1.1 Universal Services Directive 14 1.2 Platforms referred to in must-carry rules 16 1.3 Must-carry channels and services 19 1.4 Other content access rules 28 1.5 Issues of cost in relation to must-carry 30 2 Digital Terrestrial Television 34 2.1 DTT licensing and obstacles to access 34 2.2 Public service broadcasters MUXs 37 2.3 Must-carry rules and digital terrestrial television 37 2.4 DTT across Europe 38 2.5 Channels on Free DTT services 45 Recent legal developments 50 Country Reports 52 3 AL - ALBANIA 53 3.1 Must-carry rules 53 3.2 Other access rules 54 3.3 DTT networks and platform operators 54 3.4 Summary and conclusion 54 4 AT – AUSTRIA 55 4.1 Must-carry rules 55 4.2 Other access rules 58 4.3 Access to free DTT 59 4.4 Conclusion and summary 60 5 BA – BOSNIA AND HERZEGOVINA 61 5.1 Must-carry rules 61 5.2 Other access rules 62 5.3 DTT development 62 5.4 Summary and conclusion 62 6 BE – BELGIUM 63 6.1 Must-carry rules 63 6.2 Other access rules 70 6.3 Access to free DTT 72 6.4 Conclusion and summary 73 7 BG – BULGARIA 75 2 | Page 7.1 Must-carry rules 75 7.2 Must offer 75 7.3 Access to free DTT 76 7.4 Summary and conclusion 76 8 CH – SWITZERLAND 77 8.1 Must-carry rules 77 8.2 Other access rules 79 8.3 Access to free DTT -

DDR-Sprachgebrauch Nach Der Wende - Eine Erste Bestandsaufnahme
Erschienen in: Muttersprache Jg. 100 (1990) Nr. 2-3, S. 266-286. DDR-Sprachgebrauch nach der Wende - eine erste Bestandsaufnahme Von MANFRED W. HELLMANN Das Neue Deutschland heute zu lesen ist, verglichen mit der Zeit vor der Wende, sprachlich ein Vergnügen. Inhaltlich mag man die im ND vertretenen Positionen ableh- nen, auch sind bestimmte Einseitigkeiten unverkennbar. So spart das ND nicht mit Kri- tik an den desolaten Zuständen z. B. in der Wirtschaft, im Medienwesen, im Wohnungs- wesen der DDR, wohl aber ist es sehr sparsam mit der Benennung der dafür Verantwort- lichen, nämlich der SED. Wohl beklagt das ND Erscheinungen wie Intoleranz, Manipu- lationen, Diffamierungen in der politischen Auseinandersetzung, thematisiert aber nicht seine eigene jahrzehntelange »Vorbildrolle« in dieser Hinsicht. Und während früher mit der üblichen Schwarz-Weiß-Technik Ängste und Befürchtungen der Bevölkerung nur im kapitalistischen Westen vorkamen, erwähnt diese Zeitung heute Ängste, Sorgen, Befürch- tungen, Furcht, Unruhe in der DDR-Bevölkerung in einer Ausgabe häufiger als früher in einem ganzen Jahrgang. Das politische Interesse hieran ist offenkundig, wenngleich nicht ohne reale Grundlage. Ebenso offenkundig ist das Interesse, die alten, völlig dis- kreditierten Schlüsselwörter real existierender Sozialismus und kommunistisch zu ersetzen durch demokratischer Sozialismus einerseits und stalinistisch/Stalinismus andererseits. Andererseits befleißigt sich das ND einer neutralen, teilweise sogar positiven Bericht- erstattung auch über die Bundesrepublik -

©2017 Renata J. Pasternak-Mazur ALL RIGHTS RESERVED
©2017 Renata J. Pasternak-Mazur ALL RIGHTS RESERVED SILENCING POLO: CONTROVERSIAL MUSIC IN POST-SOCIALIST POLAND By RENATA JANINA PASTERNAK-MAZUR A dissertation submitted to the Graduate School-New Brunswick Rutgers, The State University of New Jersey In partial fulfillment of the requirements For the degree of Doctor of Philosophy Graduate Program in Music Written under the direction of Andrew Kirkman And approved by _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ New Brunswick, New Jersey January 2017 ABSTRACT OF THE DISSERTATION Silencing Polo: Controversial Music in Post-Socialist Poland by RENATA JANINA PASTERNAK-MAZUR Dissertation Director: Andrew Kirkman Although, with the turn in the discipline since the 1980s, musicologists no longer assume their role to be that of arbiters of “good music”, the instruction of Boethius – “Look to the highest of the heights of heaven” – has continued to motivate musicological inquiry. By contrast, music which is popular but perceived as “bad” has generated surprisingly little interest. This dissertation looks at Polish post-socialist music through the lenses of musical phenomena that came to prominence after socialism collapsed but which are perceived as controversial, undesired, shameful, and even dangerous. They run the gamut from the perceived nadir of popular music to some works of the most renowned contemporary classical composers that are associated with the suffix -polo, an expression -

1998, 24. Jahrgang
Rundfunk und Geschichte Mitteilungen des Studienkreises Rundfunk und Geschichte Informationen aus dem Deutschen Rundfunkarchiv 24. Jahrgang Nr. 2 I 3- April I Juli 1998 Buch und Rundfunk im Dritten Reich Rezeptionsforschung in Ostdeutschland (1945 - 1965) Gespräch mit SR-Intendanten a.D. Franz Mai Reportage aus dem KZ Oranienburg (1933) Rezensionen Bibliographie Mitteilungen des Studienkreises Rundfunk und Geschichte Informationen aus dem Deutschen Rundfunkarchiv Zitierweise: RuG -ISSN 0175-4351 Redaktion: Ansgar Diller Edgar Lersch Redaktionsanschrift Dr. Ansgar Diller, Deutsches Rundfunkarchiv Frankfurt am Main - Berlin, Bertramstraße 8, 60320 Frankfurt am Main, Tel. 069-15687212, Fax 069-15687200 Dr. Edgar Lersch, Süddeutscher Rundfunk, Historisches Archiv, Neckarstraße 230, 70190 Stuttgart, Tel. 0711-9293233, Fax 0711-9292698 Redaktionsassistenz: Dr. Stefan Niessen Herstellung: Michael Friebel Redaktionsschluß: 10. Juli 1998 Das Inhaltsverzeichnis von »Rundfunk und Geschichte« wird ab Jg. 19 (1993), H. 1, im INTERNET (http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/zeitschr/RuGe/rugindex.htm) angeboten. Inhalt 24. Jahrgang Nr. 2 I 3- April I Juli 1998 Aufsätze Annegret Bischof Zwischen Medienverbund und Medienkonkurrenz Buch und Rundfunk im Dritten Reich 105 Konrad Dussel Der DDR-Rundfunk und seine Hörer Ans~tze zur Rezeptionsforschung in Ostdeutschland (1945-1965) 122 Dokumentation »Am Ende des Jahrtausends eine multikulturelle Großfamilie« Gespr~ch mit dem Gründungsintendanten des SR Franz Mai (Wolfgang Becker) 137 Miszellen Helmut Hammerschmidt (1920 - 1998) (Stephan Rechlin) 160 Clemens Münster (1906 -1998) (Bettina Hasselbring) 161 »Wir können vielleicht die Schlafr~ume besichtigen« Originalton einer Reportage aus dem KZ Oranienburg (1933) (Muriel Favre) 164 Das Historische Archiv des Südwestfunks in Baden-Baden (Jana Berendt) 170 Rezensionen lnge Marßolek I Adelheid von Saldern (Hrsg.) Zuhören und Gehört werden. -

DX Log for Hans Sundgren in Linköping 1970 to 1973
Europe GERMANY (Federal Republic) Deutschlandfunk Neumiinster 600 kW 1268 kHz 70.03.21 AGA/Linkoping oSL-c. letter 22 days 70.oA-.i4 1268 kiiz, 5 70.06.02 1263 kHz DUX 17 70.11.23 1268 kHz DUX 31 71*03.09 1268 kHz 60 82 71.06.05 1268 kHz P<jnnant 71.10.23 1268 kHz DTJ: :/S. Finno 112 Europe USSR Radio Iioscow Lvov 100 kW 7l60 kHz 7O.O3.I6 AGA/Linkoping QSL-c. 28 days Europe POLAND Radio Warszawa Warsaw Ilokotow J0.52E/52.04N 300 kW 1302 kill 70.03.21 AGA/Linkoping QSL-c. pennant, letter 32 days 70.08.07 95^0 kHz kO kW 26 70.12.14 5995 kHz 10 kW 29 71.02.05 1502 kHz 57 71.03.22 5995 kHz 10 kW 81 71.10.28 1502 kHz 123 72.12.28 1502 kHz 12S II 130 Europe GERMANY (Democratic Republic) Radio Berlin International Nauen/Konigswusterhauson 100 kW 6080 klk 70.03.17 AGA/Linkoping QSL-c . h-G days 71.04.04 6115 kHz pennant 75 Europe USSR Radio Riga Riga 100 kW 575 kHs 70.03.21 AGA/Linkoping QSL-c. pennant letter 59 days 70.12.22 575 kHz 39 70.12.24 575 kHz 40 burope ITALY Radio Roma Rome 12.31E/41.48N, Caltanisetta 14.04E/37-30N 100 kW 9710 kHz 70.03.27 AGA/Linkoping QSL-c. letter 36 days \ Europe FINLAND Finnish Broadcasting Company Fori 21.52E/61.28N 15 kW j120 kHz 70.04.09 AGA/Linkoping QSL-c. -

Mitteilungen - ·
Studienkreis Rundfunk und Geschichte Mitteilungen - ·- . .. Nachrichten und Informationen: Seite 81 22. Jahrestagung 12.-14. September in München - Wilhelm Treue-Stipendium des Studienkreises - Wechsel in Hilversum Schwarzes Brett: Offener Brief in Sachen "Studenti Seite 84 sche Fenster" Forschungsdefizite in der Rundfunkhistorie. Seite 85 Grundsätzliche Überlegungen anläßlich des 19. Dokto randen-Kolloquiums (Fernseh-Informationen) Eduard Gröninger (1909-1990) - Zum Tod des "Vaters" Seite 88 der Capella Coloniensis (Concerto, Das Magazin für Alte Musik) Nachdenken. über Deutschland - Ei~ Jahr Seite 91 "Deutschlandsender Kultur", Fakten und Dokumente (Wolf Bierbach) Ein deutscher Hitler-Gegner, Sprecher beim franzö• Seite 108 sischen Rundfunk (Januar 1937- 13. Mai 1940). Aus: Gavroche, Revue d'Historie populaire, Mai/August 1991 Bibliographie: Rundfunkbezogene Hochschulschriften aus kommunika Seite 120 tionswissenschaftliehen Fachinstituten - Institut für Publizistik der Universität Münster Zeitschriftenlese 56 (1.1. - 31.5.1991 und Seite 128 Nachträge) Besprechungen: Thierry Kubler et Emmanuel Lemieux: Seite 137 Cognacq Jay 1940 (Winfried B. Lerg) Communaute des Radios Publiques de Langue Seite 138 Fran9ais I Helene Eck (Hrsg.): La Guerre des Ondes (Winfried B. Lerg) Stud:enkreis Rundfunk und Geschichte eV Redakt1on Waller Först (verantw) Vorsitzender: Fr1edrich P Kahlenberg. Koblenz Wolf 81erbach · Joachim Drengberg Schnftfuhrer Wolf Bierbach , Westdeutscher Rundfunk Friednch P Kahlenberg Postfach 10 19 50, 5000 Köln 1. Tel. 02 21 I 2 20 32 50 Arnulf Kutsch Zitierweise: Mitteilungen StRuG- ISSN 0175-4351 - 81 - NACHRICHTEN UND INFORMATIONEN 22. Jahrestagung vom 12. bis 14. September 1991 in München Der Studienkreis richtet seine 22. Jahrestagung vom 12.-14. Septem ber in der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) in München 90, Frankenthaler Straße 23 aus. -

Überlegungen Zur Weiteren Entwicklung Eines
www.ssoar.info Überlegungen zur weiteren Entwicklung eines Rundfunkprogramms für die junge Generation: Diskussionsmaterial Felber, Holm; Müller, Margrit; Stiehler, Hans-Jörg Forschungsbericht / research report Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Felber, H., Müller, M., & Stiehler, H.-J. (1987). Überlegungen zur weiteren Entwicklung eines Rundfunkprogramms für die junge Generation: Diskussionsmaterial. Leipzig: Zentralinstitut für Jugendforschung (ZIJ). https://nbn-resolving.org/ urn:nbn:de:0168-ssoar-404977 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer Deposit-Lizenz (Keine This document is made available under Deposit Licence (No Weiterverbreitung - keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt. Redistribution - no modifications). We grant a non-exclusive, non- Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares, transferable, individual and limited right to using this document. persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses This document is solely intended for your personal, non- Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für commercial use. All of the copies of this documents must retain den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt. all copyright information and other information regarding legal Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle protection. You are not allowed to alter this document in any Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen way, to copy it for public or commercial purposes, to exhibit the Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument document in public, to perform, distribute or otherwise use the nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie document in public. dieses Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke By using this particular document, you accept the above-stated vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder conditions of use. anderweitig nutzen. Mit der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die Nutzungsbedingungen an. -

LETTRES D'un PAYS EFFACÉ Tome 2
LETTRES D’UN PAYS EFFACÉ Tome 2 : Et l’Orchestre Continue de Jouer Olivier GABIN Décembre 2016 ii Olivier GABIN – Lettres d’un Pays Effacé – Tome 2 : Et l’Orchestre Continue de Jouer iii “Le mur de Berlin sera encore là dans 50 ans, et même dans 100 ans” Erich HONECKER – 19 janvier 1989 Olivier GABIN – Lettres d’un Pays Effacé – Tome 2 : Et l’Orchestre Continue de Jouer iv Olivier GABIN – Lettres d’un Pays Effacé – Tome 2 : Et l’Orchestre Continue de Jouer v Le monde du travail n’est pas forcément de tout repos, même en RDA en 1987. C’est ce que découvre Renate Mendelsohn-Levy, embauchée du VEB Johannes Be- cher, entre ses collègues sympas, sa direction inepte, et l’ambiance de travail assez particulière. Mais il y a l’Association Internationale des Étudiants Berlinois, avec ses rencontres avec des étudiants de l’autre côté, dont les inénarrables cousins Martin-Georges Pey- reblanque et Roger Llanfyllin. Et, surtout, Dieter Hochweiler, brillant juriste et futur juge. Sous l’œil de l’omniprésente Stasi, pendant que Mikhaïl Gorbatchev lance sa politique de réformes à Moscou, Renate passe à l’âge adulte, avec tout ce que cela implique, surtout du point de vue activisme politique. Et ses copines, Milena Von Strelow et Siegrid Neumeyer, sont toujours le nez dans leurs études, élève-officier pour Milena, doctorante en mathématiques appliquées pour Siegrid. Malgré les interférences de la Stasi, les deux jeunes femmes s’accrochent à leurs futures carrières, leur meilleur atout dans un monde changeant et incertain. De son côté, toujours sous surveillance de son alter ego de la Bundeswehr, le général Wolfgang Hochweiler, le général Kolpke et sa subordonnée préférée, Renate Von Strelow, voient de l’intérieur leur pays stagner, malgré les nouvelles orientations définies à Moscou. -

Vor 20 Jahren: Das Ende Der „Einrichtung Standbild Geschalteten MAZ, Schwarzbild, Nach Artikel 36 Des Einigungsvertrags“ Aus
Rückblick programm zum Silvesterabend, dessen Pro- grammansagen („... mich wollten sie schon nicht mehr reinlassen, es geht nur noch mit Sondergenehmigung“) nochmals eine tech- nische Brücke zu den Olympischen Spielen von 1972 schlugen: Aufgenommen wurden sie mit einer jener Bosch-Studiokameras KCU 40, die nach ihrem Einsatz in Mün- chen als kostengünstige Gebrauchtgeräte in die DDR gelangt waren und das Adlershofer Fernsehen in die Lage versetzten, seine Schwarzweißtechnik einzumotten und zur durchgängigen Farbproduktion überzuge- hen. Letzter Akt unter DFF-Flagge war schließlich eine allerletzte Ausgabe der tra- ditionellen, wie stets vorab im einstigen Chemnitzer Kulturpalast aufgezeichneten Silvestersendung, die mit der bekannten, aus Tänzerinnen des „Fernsehballetts“ ge- bildeten Uhr endete, auf der die letzte Minu- te heruntertickte. Stillstand, Zeilensprung- flimmern der noch von einem Techniker auf Vor 20 Jahren: Das Ende der „Einrichtung Standbild geschalteten MAZ, Schwarzbild, nach Artikel 36 des Einigungsvertrags“ Aus. Hüpfendes Bild der harten Umschal- tung der Sendeleitung. Aufblende des Ost- In diesen Tagen jährt sich zum 20. Mal schen Rundfunk (NDR), der die bestehenden deutschen Rundfunks Brandenburg (ORB) der Abschluss eines Vorgangs, der in Euro- Regionalstudios übernahm und ansonsten mit seinem Intendanten Hansjürgen Rosen- pa seinesgleichen sucht: Die vollständige seine Hamburger Programme durchschalte- bauer, der sich mit einem Gang in die Sen- Auflösung von Rundfunk und Fernsehen der te, die bis heute keine rechte -

Programmvorschau 16. Bis 22. Juni 2014
Programmvorschau 16. bis 22. Juni 2014 Mitschnitt: Die mit M gekenn zeichneten Sendungen sind für private Zwecke ausschließlich gegen Rechnung unter Angabe von Name und Adresse für 10,– EUR erhältlich bei: Deutschlandradio Service GmbH, Hörerservice Raderberggürtel 40, 50968 Köln Weitere Informationen erhalten Sie unter Telefon 02 21.3 45-18 47 deutschlandradio.de Hörerservice Telefon 02 21.3 45-18 31 Telefax 02 21.3 45-18 39 [email protected] 25. +++ Nachtrag zur 22./23./24. Woche +++ Von Michael Stegemann Mi 28. Mai Regie: der Autor Sa 7. Juni Mit Maria Hartmann, Friedhelm 20.03 Konzert Ptok, Gerd Wameling und 13.30 Kakadu Die vorletzten Tage der Menschheit Michael Stegemann ☛ Entdeckertag für Kinder oder: Sechs Wochen bis zum Schuss Ton: Philipp Adelmann Die ganze Wahrheit über Europa vor dem großen Krieg – DKultur 2014 Hotzenplotz 18. Mai bis 28. Juni 1914 (2/6) (Teil 4 am 11.6.14) Legenden und wahre 25. bis 31. Mai 1914 anschließend Geschichten über die Bedeutung Von Michael Stegemann Festival ›Intonations‹ und Herkunft von Ortsnamen Regie: der Autor Jüdisches Museum Berlin Von Elisabeth Hautmann Mit Maria Hartmann, Friedhelm Aufzeichnung vom 10./11.5.14 und Heike Weber Ptok, Gerd Wameling und Max Reger Moderation: Michael Stegemann Johannes Nichelmann Klarinettenquintett op. 146 Ton: Philipp Adelmann 14.00 Nachrichten Pascal Moraguès, Klarinette DKultur 2014 Michael Barenboim, Violine (Teil 3 am 4.6.14) 19.05 Themenabend Musik Kathrin Rabus, Violine anschließend Komponist zwischen den Madeleine Carruzzo, Viola Festival