32. Bundesparteitag 9 Mai 1984 Stuttgart
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

BACHELORARBEIT Die Causa Nikolaus Brender Und Die Politische
BACHELORARBEIT Frau Angelina Niederprüm Die Causa Nikolaus Brender und die politische Intervention in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Eine Untersuchung der Berichterstattung regionaler und überregionaler Zeitungen und Zeitschriften 2015 Fakultät: Medien BACHELORARBEIT Die Causa Nikolaus Brender und die politische Intervention in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Eine Untersuchung der Berichterstattung regionaler und überregionaler Zeitungen und Zeitschriften. Autorin: Frau Angelina Niederprüm Studiengang: Angewandte Medien Seminargruppe: AM11wJ1-B Erstprüfer: Prof. Dr. phil. Otto Altendorfer Zweitprüfer: Dipl. Sportwissenschaftler Holger Tromp Einreichung: Bad Rappenau, 23.01.2015 Faculty of Media BACHELOR THESIS The Case of Nikolaus Brender and the political intervention in public broadcasting. A study about the coverage in regional and national newspapers and magazines. author: Ms. Angelina Niederprüm course of studies: applied media seminar group: AM11wJ1-B first examiner: Prof. Dr. phil. Otto Altendorfer second examiner: Qualified Sports-Academic Holger Tromp submission: Bad Rappenau, 23.01.2015 Bibliografische Angaben VI Bibliografische Angaben Niederprüm, Angelina: Die Causa Nikolaus Brender und die politische Intervention in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Eine Untersuchung der Berichterstattung regionaler und überregi- onaler Zeitungen und Zeitschriften. The case of Nikolaus Brender and the political intervention in public broadcasting. A study about the coverage in regional and national newspapers -

Cdu Spd Fdp Grüne 1
11. Bundesversammlung Berlin/ Reichstagsgebäude 23.05.1999 Zahl der Mitglieder der Bundesversammlung: 1338 Vom Hessischen Landtag gewählte Mitglieder der Bundesversammlung: 47 Präsident der Bundesversammlung: Bundespräsident Wolfgang Thierse Stimmenzahl 1. Wahlgang 2. Wahlgang 3. Wahlgang abgegebene Stimmen insgesamt 1333 1333 Johannes Rau (SPD) 657 690 Dagmar Schipanski (CDU/ CSU) 588 572 Uta Ranke-Heinemann 69 62 Enthaltungen 17 8 ungültige Stimmen 2 1 gewählt: Johannes Rau im 2. Wahlgang mit 690 Stimmen (erforderliche Mehrheit für den 1. und 2. Wahlgang: 670 Stimmen) Eidesleistung in einer gemeinsamen Sitzung des Deutschen Bundestages und des Bundesrates gemäß Art. 56 GG: 1. Juli 1999 Amtszeit: 1.Juli 1999 - Wahlvorschläge Mitglieder des Landes Hessen der 11. Bundesversammlung CDU SPD FDP GRÜNE 1. Abg. Roland Koch 1. Abg. Hans Eichel 1. Abg. Ruth Wagner 1. Abg. Priska Hinz 2. Abg. Norbert Kartmann 2. Abg. Armin Clauss 2. Abg. Jörg-Uwe Hahn 2. Abg. Frank Kaufmann 3. Dr. Alfred Dregger 3. Abg. Veronika Winterstein 3. Abg. Dieter Posch 3. Abg. Barbara Weitzel 4. Dr. Walter Wallmann 4. Walter Riester 4. Abg. Dorothea Henzler 4. Abg. Tarek Al-Wazir 5. Petra Roth 5. Abg. Barbara Stolterfoht 5. Abg. Evelin Schönhut-Keil 6. Margret Härtel 6. Holger Börner 6. Abg. Ursula Hammann 7. Dieter Fischer 7. Eva-Maria Tempelhahn 8. Dr. Rolf Müller 8. Abg. Gerhard Bökel 9. Abg. Rudolf Friedrich 9. Abg. Christel Hoffmann 10. Abg. Klaus Peter Möller 10. Michael Herrmann 11. Abg. Heide Degen 11. Dieter Hooge 12. Abg. Frank Lortz 12. Abg. Hildegard Pfaff 13. Abg. Volker Bouffier 13. Karl-Eugen Becker 14. Abg. Prof. Dr. -
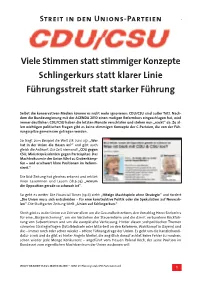
Streit-CDU/CSU-NEU 2
Streit in den Unions-Parteien Viele Stimmen statt stimmiger Konzepte Schlingerkurs statt klarer Linie Führungsstreit statt starker Führung Selbst die konservativen Medien können es nicht mehr ignorieren: CDU/CSU sind außer Tritt. Nach- dem die Bundesregierung mit der AGENDA 2010 einen mutigen Reformkurs eingeschlagen hat, wird immer deutlicher: CDU/CSU haben die letzten Monate verschlafen und stehen nun „nackt“ da. Zu al- len wichtigen politischen Fragen gibt es keine stimmigen Konzepte der C-Parteien, die von der Füh- rungsspitze gemeinsam getragen werden. So fragt zum Beispiel die Welt (18. Juni 03): „Wer hat in der Union die Hosen an?“ und gibt auch gleich die Antwort: Zur Zeit niemand! „CDU gegen CSU, Ministerpräsidenten gegen Parteispitze: Das Machtvakuum in der Union führt zu Grabenkämp- fen – und erschwert klare Positionen im Reform- streit.“ Die Bild-Zeitung hat gleiches erkannt und erklärt ihren Leserinnen und Lesern (18.6.03) „warum die Opposition gerade so schwach ist“. So geht es weiter. Die Financial Times (19.6) sieht „Hitzige Machtspiele ohne Strategie“ und fordert „Die Union muss sich entscheiden – für eine konstruktive Politik oder die Spekulation auf Neuwah- len“.Die Stuttgarter Zeitung titelt „Union auf Schlingerkurs“. Streit gibt es in der Union zur Zeit vor allem um die Gesundheitsreform, den Vorschlag Horst Seehofers für eine „Bürgersicherung“, um ein Vorziehen der Steuerreform und die damit verbundene Rückfüh- rung von Subventionen und um die europäische Verfassung. Hinter diesen sachpolitischen Themen schwelen Strategiefragen (Totalblockade oder Mitarbeit an den Reformen, Wahlkampf in Bayern) und die – immer noch oder schon wieder – offene Führungsfrage der Union. Es geht um die Kanzlerkandi- datur 2006 und da gibt es hinter Angela Merkel, die ängstlich darauf achtet keine Fehler zu machen, schon wieder jede Menge Konkurrenz – angeführt vom Hessen Roland Koch, der seine Position im Bundesrat zum eigentlichen Machtzentrum der Union ausbauen will. -

Was Wusste Roland Koch? Immer Neue Enthüllungen Aus Dem Hessen-Sumpf: Die Industrie Sponserte CDU-Spitzenmann Roland Koch Gezielt Mit Spenden an Einen CDU-Verein
Deutschland A. VARNHORN Ministerpräsident Koch: (Fast) immer ehrlich, (fast) nichts gewusst, (fast) alles aufgeklärt CDU HESSEN Was wusste Roland Koch? Immer neue Enthüllungen aus dem Hessen-Sumpf: Die Industrie sponserte CDU-Spitzenmann Roland Koch gezielt mit Spenden an einen CDU-Verein. Ermittlungen der Justiz belegen, dass schwarze Kassen bis vor kurzem zum Alltag der Union gehörten. ussitzen hat er gelernt. Gern beruft chen. In der Wiesbadener Zentrale war, sich der hessische Ministerpräsident das zeigt das Verfahren gegen den früheren ARoland Koch, 41, auf das große Vor- CDU-Chef Manfred Kanther und andere bild Helmut Kohl, 70, nach dem die Nach- Helfer und Funktionäre der Partei, der welt eines Tages „Straßen und Plätze“ be- lockere Umgang mit Schwarzgeld nicht die nennen werde. Ausnahme, sondern die Regel. Der Untersuchungsausschuss, der den Und Koch, der gelernte Wirtschaftsan- hessischen Schwarzgeldskandal aufklären walt, der zielstrebige, intelligente Macher, soll, will Akten haben? Nicht mit Koch, der schon mit 20 Jahren den CDU-Vorsitz der mauern und verzögern lässt, wie es in seiner Heimatregion nahe Frankfurt er- nur geht. Die Richter, die entscheiden müs- oberte, bekam davon nie etwas mit? sen, ob Koch und seine CDU mit rechts- Seit Monaten lodern die Vorwürfe im- widrigen Methoden an die Macht kamen, mer wieder auf, Koch sei ein Lügner und wollen die Ermittlungen der Staatsanwalt- müsse zurücktreten. Niemand überblickt schaft lesen? Die können lange warten. noch, mit wie vielen Dementis der CDU- Koch hat gute Gründe, das CDU-Kon- Chef ein ums andere Mal zu löschen ver- volut so lange wie möglich unter Verschluss sucht: Er war (fast) immer ehrlich, er hat zu halten. -

BUNDESRAT Stenografischer Bericht 824
Plenarprotokoll 824 BUNDESRAT Stenografischer Bericht 824. Sitzung Berlin, Freitag, den 7. Juli 2006 Inhalt: Amtliche Mitteilungen ......... 203 A Beschluss zu a): Kein Antrag gemäß Art. 77 Abs. 2 GG .........247*D Zur Tagesordnung ........... 203 B Beschluss zu b): Zustimmung gemäß Art. 84 Abs. 1 GG .........248*A 1. Gesetz über die Feststellung des Bundes- haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2006 (Haushaltsgesetz 2006) (Drucksache 4. Investitionszulagengesetz 2007 (InvZulG 435/06) .............. 223 A 2007) (Drucksache 407/06) ...... 228 D Michael Breuer (Nordrhein-West- Rainer Wiegard (Schleswig-Hol- falen) ............247*C stein) ............250*A Beschluss: Kein Antrag gemäß Art. 77 Beschluss: Zustimmung gemäß Art. 105 Abs. 2 GG ............ 223 A Abs. 3 und Art. 108 Abs. 5 GG ....248*A 2. Gesetz zur Fortentwicklung der Grund- 5. Gesetz über die Errichtung einer sicherung für Arbeitsuchende (Druck- Bundesanstalt für den Digitalfunk der sache 404/06) ........... 223 B Behörden und Organisationen mit Günther H. Oettinger (Baden- Sicherheitsaufgaben (BDBOS-Gesetz – Württemberg) ......... 223 B BDBOSG) (Drucksache 408/06) .... 228 D Volker Hoff (Hessen) ....... 224 C Beschluss: Zustimmung gemäß Art. 84 Franz Müntefering, Bundesminister Abs. 1 GG ............248*A für Arbeit und Soziales ..... 226 A Geert Mackenroth (Sachsen) ...247*C 6. Gesetz zur Änderung personenbeför- derungsrechtlicher Vorschriften und Beschluss: Zustimmung gemäß Art. 84 arbeitszeitrechtlicher Vorschriften für Abs. 1 GG – Annahme einer Entschlie- Fahrpersonal (Drucksache 409/06 [neu]) 229 A ßung ..............228 C, D Dr. Michael Freytag (Hamburg) 229 A, 250*C 3. a) Gesetz über die Bereinigung von Bun- desrecht im Zuständigkeitsbereich des Beschluss: Zustimmung gemäß Art. 84 Bundesministeriums für Arbeit und Abs. 1 GG ............ 229 B Soziales und des Bundesministeriums für Gesundheit (Drucksache 405/06) 7. -

Germany's Flirtation with Anti-Capitalist Populism
THE MAGAZINE OF INTERNATIONAL ECONOMIC POLICY 888 16th Street, N.W. Suite 740 Washington, D.C. 20006 Phone: 202-861-0791 Blinking Fax: 202-861-0790 Left, www.international-economy.com Driving Right B Y K LAUS C. ENGELEN ecent rhetorical attacks against interna- tional corporate investors from the top echelons of Germany’s governing Social Democratic Party, coupled with the crashing defeat of the Red-Green coalition in the latest state elections and the German chancellor’s unexpected move to call a national election a year Germany’s flirtation with earlier than scheduled—all these developments can be seen as Rpart of an “end game” for Gerhard Schröder and the Red-Green coalition. anti-capitalist populism. In a major speech on the future SPD agenda at the party headquarters on April 13, party chairman Franz Müntefering zoomed in on “international profit-maximization strategies,” “the increasing power of capital,”and moves toward “pure cap- italism.” Encouraged by the favorable response his anti-capi- talistic rhetoric produced among party followers and confronted with ever more alarming polls from the Ruhr, he escalated the war of words. “Some financial investors spare no thought for the people whose jobs they destroy,” he told the tabloid Bild. “They remain anonymous, have no face, fall like a plague of locusts over our companies, devour everything, then fly on to the next one.” When a so-called “locust list” of financial investors leaked from the SPD headquarters to the press, the “droning buzz” of Klaus C. Engelen is a contributing editor for both Handelsblatt and TIE. -

Hans Eichel Bundesminister A.D. Im Gespräch Mit Werner Reuß
BR-ONLINE | Das Online-Angebot des Bayerischen Rundfunks Sendung vom 27.4.2010, 20.15 Uhr Hans Eichel Bundesminister a.D. im Gespräch mit Werner Reuß Reuß: Verehrte Zuschauer, ganz herzlich willkommen zum alpha-Forum. Unser heutiger Gast ist Hans Eichel, er war u. a. Ministerpräsident des Bundeslandes Hessen und in den Jahren von 1999 bis 2005 Bundesminister der Finanzen. Ich freue mich, dass er hier ist, ganz herzlich willkommen, Herr Eichel. Eichel: Guten Tag, Herr Reuß. Reuß: Es gab Zeiten, da hat man Sie fast täglich im Fernsehen gesehen. Vor Ihren sechs Jahren als Bundesfinanzminister waren Sie 16 Jahre lang in Kassel Oberbürgermeister und acht Jahre Ministerpräsident in Hessen gewesen. "Es gibt auch ein Leben nach der Politik", hat Ihr Vor-Vorgänger im Amt des Bundesfinanzministers, Theo Waigel, einmal gesagt. Wie sieht denn Ihr Leben nach der Politik aus? Was macht Hans Eichel heute? Eichel: Ein Leben vollkommen ohne Politik gibt es im "Leben nach der Politik" eigentlich nicht, wenn man ein wirklich politischer Mensch ist. Ich war das übrigens schon von klein auf: Ich habe mit der Zeitung lesen gelernt und habe meine erste Wahlrede als Quintaner, also als Sechstklässler, gehalten – damals noch für Konrad Adenauer. Ich bekam dann sogar noch vor ihm in meiner Klasse die absolute Mehrheit. Das waren halt Jugendsünden, die dann aber spätestens ab der Oberstufe zu Ende waren. Nein, man bleibt einfach immer ein politischer Mensch, und wenn man nicht mehr selbst Politik macht, dann erklärt man sie. Das mache ich jetzt als Leiter des Politischen Klubs der Evangelischen Akademie in Tutzing und als Arbeitskreisleiter bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. -

Koch Und Kanzler CDU-Ministerpräsident Roland Koch Will Die Hessen-Wahl Zur Abstimmung Gegen Rot-Grün Stilisieren
Deutschland „Steuererhöhungen sind in der jetzigen konjunkturellen Situation „Ich erwarte bei den gesetzlichen ökonomisch unsinnig, und deshalb ziehen Krankenkassen keine wir sie auch nicht in Betracht.“ Beitragserhöhung auf breiter Front.“ Bundeskanzler Gerhard Schröder am 26. Juli 2002 Gesundheitsministerin Ulla Schmidt am 8. August 2002 WAHLKAMPF Koch und Kanzler CDU-Ministerpräsident Roland Koch will die Hessen-Wahl zur Abstimmung gegen Rot-Grün stilisieren. Der von dem skandalerprobten Hardliner erfundene Lügen-Ausschuss verunsichert die Koalition. Offenbar war Finanzminister Hans Eichel über die düstere Kassenlage gut informiert. ie Rede des hessischen Ministerprä- Kochs Gesicht leuchtete – sofort änder- kompromissloser als beim Duell ums Kanz- sidenten plätscherte vor sich hin. te er den Redetext: Nun gebe es endlich ei- leramt will Koch vor den Landtagswahlen DErst klagte Roland Koch über rot- nen Beleg dafür, dass die Regierung ihre in Hessen und Niedersachsen Anfang Fe- grüne Fortschrittsverhinderer, dann empör- Wähler über den Zustand des Landes be- bruar auftreten und den Fehlstart von Rot- te er sich über den „missionarisch-ideolo- trogen habe, triumphierte er. Gleich nach Grün zur nationalen Katastrophe stilisie- gischen Eifer“ der Berliner Regenten. Eher seiner Wiener Rede rief er die CDU-Vor- ren. Das heimliche Motto: Rache für den routiniert referierte der Christdemokrat am sitzende Angela Merkel an, um sie von sei- 22. September. Das strategische Ziel: Der vorvergangenen Mittwoch auf Einladung nem Plan zu überzeugen, dass nun ein Un- Hessen-Chef will sich selbst in Pose setzen der Österreichischen Volkspartei in Wien. tersuchungsausschuss im Bundestag her und – nach der eher betulichen Stoiber- Und dann das: Ein Mitarbeiter reichte müsse, um die mutmaßlichen Lügen von Kampagne – beweisen, dass ein konserva- dem Redner eine Agenturmeldung über Rot-Grün aufzudecken und anzuprangern. -

Aker, Richard
The Association for Diplomatic Studies and Training Foreign Affairs Oral History Project RICHARD AKER Interviewed by: Charles Stuart Kennedy Initial Interview Date: February 1, 2010 Copyright 2014 ADST TABLE OF CONTENTS Background Born in Arkansas; Family background Hendrix College; University of Arkansas Early employment Arkansas State Department of Transportation Arkansas Unemployment Compensation Commission US Food and Drug Administration; Legal analyst Entered the Foreign Service 1978 Decision to join the United states Information Agency (USIA) A-100 Course USIA course in Public Affairs Persian (Farsi) language study Tehran, Iran: USIA (rotation) Trainee 1978-1979 Mullahs Environment Anti-Shah demonstrations Security Khomeini takes power Spike Dubs Subsequent Embassy takeover Anti-Americanism Public political views Munich, Germany: Deputy Public Affairs Officer/Director of 1979-1981 America House Missiles controversy Helmut Schmidt Anti-US demonstrations Public attitude towards WWII 1 German character traits University teaching Charles Z. Wick USIA/State Department relationship WORLDNET Fulbright US-Russian sports competition Radio Free Europe Radio Liberty German views on Teheran embassy invasion Franz Josef Strauss Political Parties German views on death penalty University of Munich Personal duties and operations The White Rose Hans and Sophie Scholl European Union and Commission Dachau America House operations University of Munich Green Party Baader-Meinhof German students in US Shop-closing hours Washington, DC: Chinese language -

PDF-Download
Headnotes to the Judgment of the Second Senate of 18 December 2002 – 2 BvF 1/02 – 1. The Bundesrat is a collegiate constitutional body of the Federation which consists of members of the Land governments. 2. The Länder do not participate directly through the Bundesrat in the legislation and administration of the Federation and in matters related to the European Union, but by the agency of the Members of the Bun- desrat coming from the midst of the Land governments. The Länder are in each case represented by their Bundesrat Members who are present. 3. The votes of a Land in the Bundesrat are cast by its Bundesrat Mem- bers. The Basic Law (Grundgesetz) expects a uniform casting of the votes and respects the practice of the block vote, the holders of which are designated by each Land autonomously, without in turn interfering in the constitutional sphere of the Land with instructions and determi- nations. 4. It follows from the conception of the Basic Law for the Bundesrat that the casting of the votes by a holder of the block vote at any time can be contradicted by another Bundesrat Member of the same Land, and that the preconditions of the block vote hence cease to apply altogeth- er. 5. Where ambiguities occur in the course of the ballot, the President of the Bundesrat presiding over the ballot is in principle entitled to bring about a clarification with suitable measures and to work towards an ef- fective vote by the Land. The right existing in this respect to enquire however ceases to apply if a uniform Land will recognisably does not exist and it cannot be expected in view of the overall circumstances for such a will to yet come into being during the ballot. -

Roland Koch (Hessen)
Plenarprotokoll 782 BUNDESRAT Stenografischer Bericht 782. Sitzung Berlin, Freitag, den 8. November 2002 Inhalt: Zur Tagesordnung . 483 B Staatsminister Josef Miller (Bayern) zum Beauftragten des Bundesrates 1. Ansprache des Präsidenten . 483 B gemäß § 33 GO BR . 497 A Präsident Prof. Dr. Wolfgang Böhmer 483 B 4. Vorschlag für eine Verordnung des Rates Gerhard Schröder, Bundeskanzler . 487 A über die Zuständigkeit und die Anerken- nung und Vollstreckung von Entschei- Roland Koch (Hessen) . 490 B dungen in Ehesachen und in Verfahren Kurt Beck (Rheinland-Pfalz) . 494 C betreffend die elterliche Verantwortung, zur Aufhebung der Verordnung (EG) 2. Geschäftsordnungen für den Vermitt- Nr. 1347/2000 und zur Änderung der Ver- lungsausschuss, für den Gemeinsamen ordnung (EG) Nr. 44/2001 in Bezug auf Ausschuss und für das Verfahren nach Unterhaltssachen – gemäß §§ 3 und 5 Artikel 115d des Grundgesetzes (Druck- EUZBLG – (Drucksache 642/02) . 503 A sache 792/02) . 496 D Beschluss: Stellungnahme . 503 B Beschluss: Zustimmung gemäß Art. 77 Abs. 2 Satz 2 GG, Art. 53a Abs. 1 Satz 4 5. Vorschlag für eine Verordnung des Eu- GG, Art. 115d Abs. 2 Satz 4 GG . 496 D ropäischen Parlaments und des Rates mit spezifischen Vorschriften für die amtli- 3. Entwurf eines Gesetzes zur Aufhebung che Überwachung von zum menschlichen des Gesetzes zur Modulation von Direkt- Verzehr bestimmten Erzeugnissen tieri- zahlungen im Rahmen der Gemeinsamen schen Ursprungs – gemäß §§ 3 und 5 Agrarpolitik und zur Änderung des EUZBLG – (Drucksache 660/02) . 503 B GAK-Gesetzes – Antrag der Länder Beschluss: Stellungnahme . 503 C Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Ham- 6. Vorschlag für eine Entscheidung des burg, Hessen, Saarland – (Drucksache Rates zur Annahme eines Mehrjahres- 775/02) . -

Germany Update Germany Update
The Konrad-Adenauer-Stiftung presents: Germany Update Germany Update KAS Germany Update Current Issues in German Politics No. 23 – February 2005 I. Elections 2005: CDU strongest party in Schleswig-Holstein II. Fischer Scandal: Foreign Minister about to fall over visa affair? III. NATO's Future: Chancellor presents irritating proposals in Munich I. Elections 2005: CDU strongest party in Schleswig-Holstein After 17 years, the coalition of Social Democrats and Green Party no longer holds a majority in Germany's most northern state, Schleswig-Holstein. But although the CDU with their top candidate Peter Harry Carstensen became the strongest party, the only female governor (Ministerpräsident) in the country, Heide Simonis (SPD), will stay in office—because of a unique twist in the political system of Schleswig-Holstein. These are the February 20 results: CDU 40.2% (+5.0% compared with the last election five years ago), SPD 38.7% (-4.4), FDP 6.6% (-1.0), Greens 6.2% (+/- 0), SSW 3.6% (-0.5), Others 4.7% (+1.0). The SSW—the South-Schleswig Voters Union—is the party of the Danish minority and as such, it is exempted from the 5% minimum usually required to gain seats in parliament. This privilege has been agreed upon by all parties under the condition that the SSW does not abuse its disproportional power. However, according to these results, neither CDU/FDP nor the SPD/Green Party bloc holds a majority of seats. The only viable solutions are either a Grand Coalition of CDU/SPD (under the leadership of the strongest partner, the CDU) or a minority government of SPD/Greens, tolerated by the SSW.