Geschäftsbericht 2012
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Contribution À L'étude Géomophologique Et Géophysique Des Environnements Périglaciaires Des Alpes Tessinoises Orientales
Photos de couverture A gauche, du haut vers le bas : Prospection géoélectrique sur l’éboulis de Sasso di Luzzone ; le glacier rocheux de Gana Bianca ; fenêtres de fonte du manteau neigeux sur l’éboulis de Sasso di Luzzone. A droite : La partie frontale du glacier rocheux de Sceru I. Sauf mention contraire, toutes les photos sont de l’auteur. A mes parents Ai miei genitori Table des matières -V- Table des matières Résumé_________________________________________________________________________ XI Abréviations_____________________________________________________________________XII Remerciements__________________________________________________________________ XIII 1ÈRE PARTIE : INTRODUCTION ET NOTIONS GÉNÉRALES 1. Introduction générale 05 1.1 Contexte de l’étude 05 1.2 Question générale 07 1.3 Historique et état des connaissances 07 1.3.1 Recherches sur les environnements périglaciaires au Tessin et en Mesolcina 08 1.3.2 Recherches sur les environnements périglaciaires dans les A. Centrales ital. 09 1.3.2.1 Distribution des glaciers rocheux et (paléo)climat dans les A. Centrales ital. 10 1.3.2.2 Distribution des glaciers rocheux dans le Massif de l’Adamello – Presanella 11 1.3.3 Synthèse 12 1.4 Plan de la recherche 13 2. Problématique 17 2.1 Problématique géographique 17 2.1.1 Problématique générale 17 2.1.2 Hypothèses de travail 18 2.2 Problématique méthodologique 19 2.2.1 Problématique générale 19 2.2.2 Hypothèses de travail 21 2.3 Synthèse 22 3. Les environnements périglaciaires : cadre théorique 25 3.1 Le domaine périglaciaire 25 3.1.1 -
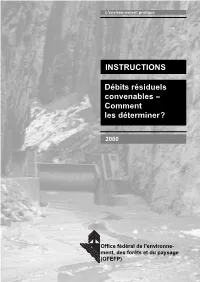
Débits Résiduels Convenables -- Comment Les Déterminer?
L'environnement pratique INSTRUCTIONS Débits résiduels convenables -- Comment les déterminer? 2000 Office fédéral de l'environne- ment, des forêts et du paysage (OFEFP) L'environnement pratique INSTRUCTIONS Débits résiduels convenables -- Comment les déterminer? 2000 Publié par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) Auteurs R. Estoppey, OFEFP, Berne Dr. B. Kiefer, Kiefer & Partners AG, Zurich M. Kummer, OFEFP, Berne S. Lagger, OFEFP, Berne H. Aschwanden, SHGN, Berne (chap. 7) Traduction B. Bressoud, Ardon Commande Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage Documentation 3003 Berne Fax + 41 (0)31 324 02 16 E-mail: [email protected] Internet: http://www.admin.ch/buwal/publikat/f/ Numéro de commande VU-2701-F © OFEFP 2000 Table des matières 3 TABLE DES MATIÈRES $9$17352326 ,1752'8&7,21 1.1 GÉNÉRALITÉS..................................................................................................................................7 1.2 OBJECTIF ET PRINCIPES DE LA FIXATION DE DÉBITS RÉSIDUELS CONVENABLES ......8 1.3 BASES LÉGALES..............................................................................................................................8 1.4 LE SYSTÈME DES DISPOSITIONS DE LA LEAUX SUR LES DÉBITS RÉSIDUELS................10 /¶$8725,6$7,21'(35e/Ê9(0(17'¶($8 2.1 PRÉLÈVEMENTS D’EAU SOUMIS À AUTORISATION ............................................................13 2.2 CONDITIONS POUR L’OCTROI DE L’AUTORISATION ...........................................................19 -

Brücken Über Vorderrhein, Hinterrhein, Alpenrhein Und Ihre Philatelistischen Spuren (Teil-1)
Brücken über Vorderrhein, Hinterrhein, Alpenrhein und ihre philatelistischen Spuren (Teil-1) Reinhard Velten, 2. Vorsitzender der Motivgruppe Ingenieurbauten e.V. Vorweg Auf den folgenden Seiten werden interessante Brücken und ihre Spuren in der Philatelie beschrie- ben. Im Laufe der Jahrhunderte wurden viele Brücken gebaut und verändert, zerstört und wieder aufge- baut. Bis in die heutige Zeit erlauben neue Materialien und technische Möglichkeiten den Bau neu- er Brückenkonstruktionen. Von den Quellen bis zum Bodensee begegnet uns die ganze Bandbreite der Brückenbautechnik, Steinbrücken, Holzbrücken, Stahlfachwerkbrücken, Schrägseil- und Stahlbetonbrücken. Viele Brü- cken hatten und haben für die Menschen eine große Bedeutung und wurden auch zu Symbol und Wahrzeichen. Nicht alle Bauwerke sind auch philatelistisch belegbar – aber immer wieder erschei- nen Briefmarken und Stempel mit Abbildungen von alten und neuen Brücken. Inhalt Vorwort und Einleitung Skizze Brücken am Vorderrhein Brücken am Hinterrhein Die Viamala-Schlucht Der Alpenrhein von Reichenau bis Bad Ragaz Die Rheinregulierung Brücken zwischen Liechtenstein und der Schweiz Die letzten Kilometer zum Bodensee Lindauer Bote / Fussacher Bote; Schlusswort Literaturliste SEITE: 1 Der Bau von Wegen und Straßen ist eine der ältesten zivilisatorischen Aufgaben. In der Gebirgs- region um Vorder- und Hinterrhein, im Kanton Graubünden, war dies schon immer mit großen An- strengungen verbunden. Die ältesten Spuren früherer Verkehrswege sind Halbgalerien, die viel- leicht von den Römern, vielleicht erst im Mittelalter in den Fels gehauen wurden. SEITE: 2 Der Vorderrhein entspringt im Gotthardmassiv in der Nähe des Oberalppasses. Als Quelle des Vorderrheins gilt heute der Tomasee, 2345 m ü. M., unterhalb des Piz Baldus. Er ist etwa 76 Kilometer lang. Größte Ortschaft auf dem Weg nach Reichenau ist Disentis. -

Water Management in Vorarlberg, in Alpine Rhine and Lake Constance Basin
Skadar/Shkodra Lake Commission 17.11.2009 Water management in Vorarlberg, in Alpine Rhine and Lake Constance basin Thomas Blank State governement of Vorarlberg Unit for water management Vorarlberg, Lake Constance, Alpine Rhine Rheinspitz Rohrspitz Rheinmündung BregenzThomas Blank, Unit for water management 1 Content 1 Water management in Vorarlberg 2 International water management in the basin of Lake Constance 3 Alpine Rhine -International water management 4 International Commission for the Protection of Lake Constance IGKB 5 EU water framework directive Thomas Blank, Unit for water management Catchment areas in Europe Thomas Blank, Unit for water management 2 Rhine basin Thomas Blank, Unit for water management River-basins of Vorarlberg Thomas Blank, Unit for water management 3 Amount of water in Vorarlberg Precepitation/year: 1900 mm „Burgenland“ „Vorarlberg“ „Burgenland“Quelle: Wasserland Bayern, Bayer. Staatsministe rium f ü r Landesentwicklung „V undorarlberg“ Umweltfragen Quelle: Wasserland Bayern, Bayer. Staatsministerium f ür Landesentwicklung und Umweltfragen Thomas Blank, Unit for water management Water-balance of Vorarlberg Water-supply: 1 % of precepitation Verbrauch 5 Werte in Mio m³/Jahr Thomas Blank, Unit for water management 4 Monitoring Surface water monitoring Legaly binding program for quality an quantity (precipitation, discharge) Thomas Blank, Unit for water management Monitoring Groundwater monitoring Legaly binding program for quality an quantity Thomas Blank, Unit for water management 5 Water-supply 70 % Groundwater -

Baselgias E Capluttas Dalla Val Medel
Themenwanderung BASELGIAS E CAPLUTTAS DALLA VAL MEDEL Ergänzende Informationen zu den Kirchen und Kapellen der Val Medel Gemeinde Medel, Tgasa Lucmagn, 7184 Curaglia www.medel.ch Kirchen und Kapellen der Val Medel Ergänzende Informationen zur Themenwanderung Einleitung In der Val Medel gibt es neben zahlreichen Naturschönheiten auch kulturelle und kunst- historische Besonderheiten zu entdecken. Die Themenwanderung «Kapellen und Kirchen der Val Medel» lädt Sie ein, mehr über die zwölf grösseren und kleineren Gotteshäuser im Tal, deren Entstehungsgeschichten und kunsthistorischen Schätze zu erfahren. Dabei wandern Sie von Dorf zu Dorf, vorbei an kleinen, beschaulichen Maiensässiedlun- gen, durch Wald und Wiese oder entlang des Rein da Medel, dem ursprünglichen Verlauf des Lukmanierpassweges folgend und erleben die landwirtschaftlich geprägte Kulturland- schaft der Val Medel. Neben der beiden Talkirchen in Platta und Curaglia sind es die zahlreichen kleinen, unter- schiedlich reich ausgestatteten Kapellen, die sich charmant in die Landschaft einbetten. Diese sind jedoch nicht bloss Kulturdenkmäler, denn auch in den kleinen Kapellen finden noch regelmässig Gottesdienste statt. Auch die handgezogenen Glocken werden wann immer möglich, täglich um 11 Uhr und am Abend, je nach Jahreszeit zwischen 18 und 20 Uhr, von Freiwilligen geläutet. Die Frühgeschichte der Gemeinde Medel/Lucmagn liegt im Dunkeln, es ist jedoch be- kannt, dass das Kloster Disentis eine grosse Rolle in der Entwicklung der Val Medel spiel- te. Dessen Gründung im 8. Jahrhundert weist auf eine existierende Passpolitik über den Lukmanier hin und die Ländereien des Klosters Disentis schlossen das gesamte Gemein- degebiet der Val Medel mit ein. Daher ist anzunehmen, dass die eigentliche Besiedlung der Val Medel durch die Kulturarbeit des Kloster Disentis eingeleitet wurde. -

Svensk Litteraturhistorisk Bibliografi 111 (1992); Med Tillägg Och Rättelser För Tidigare År Upprättad Av Åke Bertenstam
Samlaren Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning Årgång 115 1994 Svenska Litteratursällskapet Detta verk har digitaliserats. Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skapa en sökbar text som ligger osynlig bakom bilden. Den maskinellt tolkade texten kan innehålla fel. REDAKTIONSKOMMITTÉ: Göteborg: Lars Lönnroth, Stina Hansson Lund: Ulla-Britta Lagerroth, Margareta Wirmark Stockholm: Kjell Espmark, Ulf Boéthius, Ingemar Algulin Umeå: Sverker R. Ek Uppsala: Bengt Landgren, Torsten Pettersson, Johan Svedjedal Redaktör. Docent Ulf Wittrock, Litteraturvetenskapliga institutionen, Slottet, ing. AO, 752 37 UPPSALA Distribution: Svenska Litteratursällskapet, Litteraturvetenskapliga institutionen, Slottet ing. AO, 752 37 UPPSALA Utgiven med stöd av Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet Bidrag till Samlaren skall lämnas dels på diskett (företrädesvis i ordbehandlingsprogrammen Word för Windows, Word för DOS eller Word Perfekt), dels i form av utskrift på papper. ISBN 91-87666-09-X ISSN 0348-6133 Printed in Sweden by Reklam & Katalogtryck, Uppsala 1995 Svensk litteraturhistorisk bibliografi 111 (1992); med tillägg och rättelser för tidigare år Upprättad av Åke Bertenstam Bibliografin omfattar skrifter om svenska, finlands- skett genom att det införts en klassificering som följer svenska och svenskamerikanska författare samt om SAB-systemets med endast smärre avvikelser, främst litterära förhållanden och strömningar inom den för att undvika vissa annars alltför små avdelningar. svenskspråkiga litteraturen. Dessutom redovisas re- Denna har fått till följd att större delen av referenserna censioner när de avser verk i bokform inom de angivna från den förutvarande avdelningen Allmänt har över- områdena. Nya oförändrade upplagor medtages dock förts till nya avdelningar. Eftersom samtliga nedan- ej. Svenska verk om utländska författare eller för- stående avdelningar sannolikt ej kommer att förekomma hållanden medtages inte heller. -

Als PDF Herunterladen
100 VOLKSHOCHSCHULE ZÜRICH SOMMER 2021 Entlarvt! Lüge, Täuschung, Wahrheit – 21S-0220-01 Philosophieren mit Enkeln und andern Kindern – 21S-0310-66 Deep Fakes: Wie die Medien uns manipulieren (werden) – 21S-0335-23 100 Nachhilfe fürs Fest Editorial 100 Jahre Volkshochschule Zürich Neun Jahre Sie lesen mein letztes Vorwort für ein Semesterprogramm der Volkshochschule Zürich. Am 30. Juni gehe ich in Pension. Allerdings werde ich das Universum der VHS nicht ganz verlassen, sondern für den Verband der Schweizerischen Volkshochschulen weiterhin aktiv bleiben. Und hoffentlich Gutes für Zürich bewirken können. Als ich mein Büro bezog, damals noch an der Riedtlistrasse, waren der VHS Zürich eben die Subventionen gestrichen worden. Es ging also um einen Neustart – einen Neustart aus eigener Kraft, ohne fremde Hilfe, aber auch in grosser Freiheit. Meine Vorstellung war, dass es möglich sein müsste, für ein anspruchsvolles, akademisches Programm ein ausreichend grosses Publikum zu finden, um den Betrieb aus eigener Kraft zu finanzieren. Dass dabei die Fremdsprachen für das ökonomische Fundament eine Schlüsselrolle spielen würden, war rasch klar. Das Abenteuer ist geglückt. Das an Dienstjahren junge Team, das ich bei Amtsantritt vorfand, erwies sich als Powertruppe. Schon im zweiten Schuljahr lancierten wir die neue Website, gleichzeitig mit einer neuen, damals erst als Prototyp vorhandenen Kursverwal- tungssoftware. Wieder ein Jahr später tat sich die Chance auf, den Hauptsitz an die Bärengasse zu verlegen. Niemand im Team zögerte auch nur einen Moment. Gleichzeitig bezogen wir unsere Bewegungsräume im Kulturpark. Aber es sollten nicht die Mauern sein, die die VHS ausmachten. Wir erfanden neue For- mate, am prominentesten sicher die Lehrgänge. Wir erweiterten das Ressort Kreativität, 2020 konnten wir unseren 100. -

International Water Management at Lake Constance
International Water Management at Lake Constance H. G. Schröder Institut für Seenforschung Langenargen Lake Constance… …made by ice and water…15,000 years BP… Hans Strobl: Vorarlberger Naturschau • Altitude a.s.l. 395 m • Total surface area 535 km 2 • Maximum depth 254 m • Volume 49 km 3 •Length of shoreline 273 km • Overall length 63 km • Overall width 14 km • Catchment area 11 500 km 2 • Mean outflow ca. 370 m 3/s …determined by man since 10,000 years BP… from: Otto Hauser (1921) Leben und Treiben zur Urzeit • 1,500,000 people living in the catchment area of the lake • Local industry (engines, aircraft- and spacecraft equipment) and agriculture (hop, apple trees, vineyards) together with the inhabitants discharge sewage water equivalent to 3,200,000 people • Until the early 1970s the major part of sewage entered the lake without any treatment • Major tourist area in Germany • More than 2,500,000 visitors per year • 55,000 boats registered at the lake • Severe structural changes (land use for roads,parking, harbous, houses etc.) • Additional water pollution • Drinking water source for more than 4 million people (drinking water pumped at 25 sites at depth > 30m) • 170,000,000 m³ water / year = less than 2% of annual outflow • Water export from largest drinking water plant in Sipplingen via pipeline network to 500 cities and villages in Southern Germany “The boundaries between countries result from historical events, and, therefore, they do not coincide with the boundaries of the watersheds. As a consequence, several lakes and rivers mark the boundaries between countries or cross them. -

Disentis Sedrun Top Winterwanderungen Furkapass 2429 M Winterspass Am Oberalppass Schijenstock 2888 M 1 513 Andermatt – Nätschen (Ca
Pizzo Lucendro Galenstock Dammastock Gwächtenhorn Sustenhorn Fleckistock 2963 m 3586 m 3630 m 3403 m 3502 m 3412 m Wege und Touren Disentis Sedrun Top Winterwanderungen Furkapass 2429 m Winterspass am Oberalppass Schijenstock 2888 m 1 513 Andermatt – Nätschen (ca. 2 h) Gotthardpass Realp 2091 m Hospental Bristen 2 Tschamut – Milez – Dieni (ca. 2 h) Göschenen Gütsch 2344 m 3073 m Sedrun – Rueras Rundtour (ca. 2 h) Gemsstock Andermatt 1447 m Schneehüenerstock 3 2961 m Strahlgand 2772 m 4 259 Aussichtspunkt Cungieri (ca. 1.5 h) 2400 m Lago della Sella Sedrun – Segnas – Disentis (ca. 2.5 h) Nätschen 1842 m 5 2256 m Schneehüenerstock 2600 m 1 Lutersee 6 257 Munatsch – Segnas Rundtour (ca. 2 h) 2357 m Piz Tiarms Giuvstöckli Piz Giuv 2917 m 3060 m 3096 m 7 Disla Rundtour (ca. 2 h) p Obera Fellilücke l lpre 1 1 us Disentis – Cavardiras – Faltscharidas (ca. 2.5 h) a s s 2478 m 8 r s u Hälsistock e re Rossbodenstock Platte 2420 m t lp 2965 m a n r 2838 m Ob te Pazolastock e Top Schlittelwege U n ra U lp Crispalt 2740 m s Vermigelhütte e Piz Nair e 3075 m Fuorcla Piz Nair 1 Nätschen – Andermatt (ca. 0.5 h) 2042 m 3058 m 2829 m 814 Milez – Dieni (ca. 0.5 h) Badushütte Etzlihütte Oberalpstock / 2 Rheinquelle 2503 m Pass Tiarms 2052 m Péz Tgietschen Oberalppass 2044 m Witenalpstock 3328 m 3 815 Mompé Medel (Aufstieg 0.5 h / Abfahrt 15 min) Pass Maighels Schwarzberg 2148 m Amsteg Piz Nair l 3015 m 2421 m Lai da Tuma a 4 Gliarauns – Curaglia (Aufstieg 0.5 h / Abfahrt 10 min) 2763 m Tomasee V Müllersmat V l Piz Ravetsch a 2345 m l a Crispalt Pign 1996 m 3007 m Calmut V Top Langlauftouren M Lai Urlaun 2787 m a 2249 m 2310 m Chrüzlistock i g h e l s Mittelplatten 2716 m 250 Nordic Surselva (ca. -

Topografische Flussanalysen Im Quellgebiet Des Rheins Bericht
Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS armasuisse Bundesamt für Landestopografie swisstopo Bereich Topografie Topografische Flussanalysen im Quellgebiet des Rheins Bericht Berechnungen, Grafik Guillaume Condé Topografie TGMM Cédric Métraux Topografie TGMM Koordination und Text Martin Rickenbacher Topografie TGA Schlussversion vom 15. September 2011 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung............................................................................................................................................ 3 2 Zur Rolle von swisstopo im Fragenkontext ........................................................................................ 3 3 Definitionen ........................................................................................................................................ 4 3.1 Bezugspunkt.......................................................................................................................... 4 3.2 Einzugsgebiete ...................................................................................................................... 5 4 Quellen und Längen........................................................................................................................... 6 4.1 Vorderrhein............................................................................................................................ 6 4.2 Rein da Maighels................................................................................................................... 7 4.3 -

Jagd- Und Fischereiinspektorat Des Kantons Graubünden
Anhang/Appendice: Wildschutzgebiete im Kanton Graubünden Zone di protezione della selvaggina nel Cantone dei Grigioni A. SCHWEIZERISCHER NATIONALPARK / PARC NAZIUNAL SVIZZER / PARCO NAZIONA- LE SVIZZERO (SNP/PNS) Die Grenzen des Nationalparkes (SNP) sind in der Landeskarte 1:25’000 eingezeichnet. Allfällige Änderun- gen sind in den Jagdbetriebsvorschriften aufgeführt. I confini del Parco Nazionale Svizzero (PNS) sono indicati nella carta topografica 1 : 25’000. Eventuali modifiche sono elencate nelle prescrizioni per l’esercizio della caccia. B. EIDGENÖSSISCHE JAGDBANNGEBIETE / BANDITE FEDERALI Jagdbezirke I und II / Districts da catscha I e II 100. Pez Vial-Greina GR: Camona da Medel (CAS), tabla – marcau – tabla – marcau – fil – Pez Casch- leglia – fil – Denter Corns – fil – Pez Santeri – marcau – Fuorcla da Stavelatsch – tabla – marcau – Pez Stavelatsch – fil – Pez Rentiert – marcau – tablas – marcau – Cuolmet – marcau – Muota la Tieua – tablas – marcau – Rein da Vigliuts – marcau – punt da Vigliuts, tabla – marcau – tabla – marcau – punt dils Clavaus – marcau – tabla – marcau – trutg dalla Camona da Terri – marcau – Crest la Greina – tablas – marcau – fil – Pez Miezdi – Pez da Stiarls – Pez Greina – cunfin da vischnaunca Sum- vitg/Vrin – Pt. 2652 – Pt. 2265 – tabla – Muot la Greina – Pt. 2194 – tabla – marcau – Camona – trutg Pass Diesrut – marcau – Pt. 2356 – marcau – Pass Diesrut – tabla – marcau – Pez Stgir – Pez Zamuor – fil – Pez Canal – Pt. 2822 – marcau – Fuorcla da Blengias – tabla – Pt. 2862 – Pez Terri – cunfin dil cantun Grischun/Tessin – Pt. 2898 – Pez Güida – Pez Ner – Crap la Crusch – tabla – marcau – Pt. 2439 – Pez Coroi – Pt. 2735 – marcau – Pass dalla Greina (Pass Crap) – tabla – Pt. 2604 – Pez Gagli- anera – Pez Valdraus – tabla – Fuorcla Sura da Lavaz – Pez Medel – Refugi da Camutschs – marcau – Denter Auas – marcau – Rein da Plattas – marcau – trutg dalla Camona da Medel – tabla – marcau – Fuorcla da Lavaz – tabla – marcau – Pt. -

Bericht Gesunde Fliessgewässer
INTERNATIONALE REGIERUNGSKOMMISSION ALPENRHEIN Gesunde Fliessgewässer durch Revitalisierung 1997 1998 1999 Anleitung zu Revitalisierungsmassnahmen an Alpenrheinzuflüssen und Bächen im Rheintal Impressum Mitglieder der Arbeitsgruppe: Amt für Umweltschutz, Fürstentum Liechtenstein, FL; T. Kindle, St. Hassler Jagd- und Fischereiinspektorat, Kt.Graubünden, CH; G. Ackermann Amt für Jagd und Fischerei des Kt. St. Gallen, CH; C. Ruhlé, Planungsamt Kt. St. Gallen, Abt. Natur- u. Landschaftsschutz; A. Brülisauer Amt der Vorarlberger Landesregierung, A; B. Wagner Landeswasserbauhof Vorarlberg, A; M. Weiss Autoren und Layout: P. Rey, J. Ortlepp, Büro HYDRA, Konstanz, D Ergänzende Unterlagen lieferten: Universität für Bodenkultur Wien, A: J. Eberstaller, E. Schager Fotonachweis: G.Ackermann; A. Brülisauer; St. Hassler; T.Kindle; P.Pitsch; P.Rey; O.Sohm; H.Wildhaber; AfU FL; H.Jenny; Planungsamt SG. Fischzeichnungen: B. Gysin Die Fische und Krebse der Schweiz Bezugsquelle: Die Broschüre ist bei den zuständigen Ämtern (Adressen im Anhang) gegen eine Schutzgebühr von CHF 10.- (ATS 90.-) zu beziehen © Internationale Regierungskommission Alpenrhein März 2000 Titelbild: Revitalisierung des Koblacher Kanals (Vorarlberg, Österreich). 2 INTERNATIONALE REGIERUNGSKOMMISSION ALPENRHEIN Gesunde Fliessgewässer durch Revitalisierung Anleitung zu Revitalisierungsmassnahmen an Alpenrheinzuflüssen und Bächen im Rheintal Das Alpenrheintal vor 180 Jahren - romantische Erinnerung oder Referenz für zukünftige Revitalisierungsmass- nahmen? 3 Information Inhalt Impressum