Hochwasserrisikomanagementpl
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

High Level of Protection Against Water-Related Disease (Art
WHO Collaborating Centre for Health Promoting Water Management and Risk Communication Institute for Hygiene and Public Health University of Bonn WaMRi-Newsletter No. 9, February 2006 Dear Reader, The Protocol on Water and Health to the 1992 Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes finally entered into force. On 4th August 2005 it became legally binding for the 16 ratifying countries. It is the first major international legal approach for prevention, control and reduction of water-related diseases in Europe. Please read more about it in our first contribution of the WaMRi-Newsletter. This issue also deals with the project Swist III , focussed on River Swist in North Rhine- Westphalia as an example for microbial load of watercourses due to diffuse polluters. The report from the Aral Sea Basin Water and Food Conference summarizes its main findings entitled as “ Managing Water and Food Quality in Central Asia ” which took place in Almaty, Kazakhstan, on 1-2 September 2005. We would like to inform you that only the authors are responsible for the content of their articles and they do not necessary reflect the opinions or positions of the WHO CC. Content The Protocol on Water and Health p. 2 River Swist in North Rhine-Westphalia as an example for microbial load of watercourses due to diffuse polluters – an interim result p. 5 News from the Aral Sea Basin Water and Food Conference p. 9 Special events on water, environment and health p.11 Links p.12 Selected books and articles p.13 Head of WHO CC : Dr. -
Die Swist Die Bäche Und Das Grundwasser Im Swistgebiet - Zustand, Ursachen Von Belastungen Und Maßnahmen
Die Swist Die Bäche und das Grundwasser im Swistgebiet - Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen www.umwelt.nrw.de PE_ERF_1400.indd 1 14.12.2008, 15:34 PE_ERF_1400.indd 2 14.12.2008, 15:34 Inhalt 5 Vorworte 8 Wasser ist Leben 8 Die europäische Wasserrahmenrichtlinie: Fahrplan für unsere Flüsse, Seen und das Grundwasser 9 NRW ist aktiv 9 Mischen Sie sich ein! 10 Die Bewirtschaftungsplanung für das Swistgebiet 12 Das Swistgebiet 14 Die Fließgewässer und Seen 16 Zustand der Gewässer 17 Die Wasserqualität • Saprobie – die biologische Gewässergüte • Plankton, Algen, Wasserpfl anzen • Pfl anzenschutzmittel • Metalle • Sonstige Schadstoffe 22 Der ökologische Zustand der Gewässer • Die allgemeine Degradation • Die Fischfauna 24 Belastungsursachen und Maßnahmen 28 Das Grundwasser 31 Mit gutem Beispiel voran 33 Ansprechpartner 34 Impressum PE_ERF_1400.indd 3 14.12.2008, 15:34 Carpediem PE_ERF_1400.indd 4 14.12.2008, 15:34 5 Liebe Bürgerinnen und Bürger, in Nordrhein-Westfalen haben wir zwar eine gute Wasser- qualität, doch unsere Gewässer bieten oft noch nicht den ökologisch notwendigen Lebensraum, um auch Lebens- adern der Natur zu sein. Wir wollen deshalb die Gewässer- ökologie in Nordrhein-Westfalen verbessern und orientieren uns dabei an den europäisch vereinbarten Qualitätszielen. Wir möchten den Zustand der nordrhein-westfälischen Gewässer verbessern im Interesse der Artenvielfalt, des Hochwasserschutzes und der regionalen Entwicklung. Dieses ambitionierte Ziel können wir nur in Kooperation mit den Kommunen, den Wasserverbänden, der Land- und Forstwirtschaft, der Industrie, den Naturschutzverbänden und natürlich nur gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern erreichen. Wir werden jetzt überall im Land mit zahlreichen Maßnah- men beginnen und voraussichtlich bis 2027 die Ziele errei- chen. -

Brandschutzbedarfsplan Feuerwehr Der Gemeinde Kirchhundem
Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Kirchhundem (Stand: 08/2012) GEMEINDE KIRCHHUNDEM Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Kirchhundem Retten - Löschen - Bergen - Schützen Seite 1 Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Kirchhundem (Stand: 08/2012) Inhalt 1. Allgemeiner Teil 2. Vorstellung und aktuelle Betrachtung der Feuerwehr 3. Darstellung der rechtlichen Grundlagen 4. Darstellung der Aufgaben der Feuerwehr 5. Gefährdungspotential 5.1 Die Gemeinde Kirchhundem im Überblick 5.2 Standorte der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Kirchhundem 5.3 Topografische Betrachtung 6. Personalbericht 7. Risiken 7.1 Gefahrenbereiche 7.2 Szenarien 7.3 Statistik der Feuerwehr 8. Schutzzielfestlegung 8.1 Schutzzieldefinition in der Gemeinde Kirchhundem 9. Soll-/Ist-Struktur 9.1 Topografischer Erreichungsgrad 9.2 Einsatzstärke / Personal 9.3 Feuerwehrtechnische Ausstattung 10. Zusammenfassung / Maßnahmen / Fortschreibung 11. Anlagen Seite 2 Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Kirchhundem (Stand: 08/2012) 1. Allgemeiner Teil Mit Inkrafttreten des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) zum 01.03.1998 sind die Gemeinden gehalten, unter Beteiligung ihrer Feuerwehr, Brandschutzbe- darfspläne und Pläne für den Einsatz ihrer Feuerwehr aufzustellen und fortzuschreiben (§ 22 Abs. 1 FSHG). Die Gemeinde Kirchhundem hat im Jahre 2000 erstmals auf Grundlage des zum 01.03.1998 in Kraft getretenen neuen FSHG einen Brandschutzbedarfsplan aufgestellt, den der Rat in seiner Sitzung vom 07.12.2000 beschlossen hat. Das mit Ratsbeschluss vom 11.07.1995 verabschiedete Brandschutzkonzept der Gemeinde Kirchhundem wurde durch den Brandschutzbedarfsplan ersetzt. Der Brandschutzbedarfsplan legt die Qualität der Gefahrenabwehr fest, indem er die Hilfsfrist, die Funktionsstärke sowie den Erreichungsgrad im Hinblick auf ein standardisiertes Schadens- ereignis (= kritischer Wohnungsbrand) definiert. Hierdurch soll der Feuerschutz gegenüber dem Rat und den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde transparent gemacht werden. -
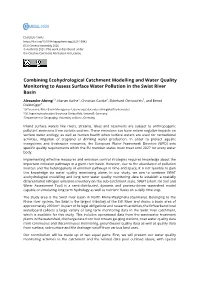
Combining Ecohydrological Catchment Modelling and Water Quality Monitoring to Assess Surface Water Pollution in the Swist River Basin
EGU2020-19842 https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-19842 EGU General Assembly 2020 © Author(s) 2021. This work is distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 License. Combining Ecohydrological Catchment Modelling and Water Quality Monitoring to Assess Surface Water Pollution in the Swist River Basin Alexander Ahring1,3, Marvin Kothe1, Christian Gattke1, Ekkehard Christoffels2, and Bernd Diekkrüger3 1Erftverband, River Basin Management, Germany ([email protected]) 2IBC Ingenieurtechnische Beratung Christoffels, Vettweiß, Germany 3Department of Geography, University of Bonn, Germany Inland surface waters like rivers, streams, lakes and reservoirs are subject to anthropogenic pollutant emissions from various sources. These emissions can have severe negative impacts on surface water ecology, as well as human health when surface waters are used for recreational activities, irrigation of cropland or drinking water production. In order to protect aquatic ecosystems and freshwater resources, the European Water Framework Directive (WFD) sets specific quality requirements which the EU member states must meet until 2027 for every water body. Implementing effective measures and emission control strategies requires knowledge about the important emission pathways in a given river basin. However, due to the abundance of pollution sources and the heterogeneity of emission pathways in time and space, it is not feasible to gain this knowledge via water quality monitoring alone. In our study, we aim to combine SWAT ecohydrological modelling and long term water quality monitoring data to establish a spatially differentiated nitrogen emission inventory on the sub-catchment scale. SWAT (short for Soil and Water Assessment Tool) is a semi-distributed, dynamic and process-driven watershed model capable of simulating long term hydrology as well as nutrient fluxes on a daily time step. -

Das Vorgebirge. Ein Beitrag Zur Rheinischen Landeskunde
Das Vorgebirge. Ein Beitrag zur rheinischen Landeskunde. Von Clotilde Ellscheid. Mit 6 Karten und Tafel IX u. X. Inhaltsbericht. Einführung: Lage, Abgrenzung und äußere Erscheinung Seite des G e b i e t e s ...............................................................................199—204 I. Teil: Die Natur der Landschaft........................................... 205—242 1 . Geologischer Bau, Oberflächenformen u. Boden 205 2. Das K lim a .......................................................... 222 8 . Die hydrologischen V e rh ä ltn isse.......... 228 4. Das Landschaftsbild im Wandel der Zeiten . 236 II. Teil: Die wirtschaftlichen V erhältnisse.......................... 242—276 1 . Die Nutzbarmachung der natürlichen Wasser vorräte .......................................................................... 242 2. Die W a ld w irtsch a ft..................................... 245 3. Die landwirtschaftlichen Verhältnisse. 248 a) Die Landwirtschaft am Osthang des Vor gebirges zwischen Bonn und Frechen . 248 b) Die Landwirtschaft auf der Hochfläche . 257 4. Die Industrie............................................................... 262 a) Der Eisenerzabbau als ausgestorbener Wirt schaftszweig. — Die Gewinnung und Ver wertung der B rau n k oh le.............. 262 b) Die Ausnutzung der Ton- und Sandlager 270 5. Der umgestaltende Einfluß der Industrie auf das Landschaftsbild.............................. 275 III. Teil: Die Verkehrswege........................................................ 276—280 IV. Teil: Zur Siedlungsgeographie -

Mittleres Ahrtal"1 Aus Naturkundlicher Sicht, Dargestellt Am Beispiel Des Naturschutzgebietes ,,Ahrschleife Bei Altenahr"
BEITRÄGE ZUR LANDESPFLEGE IN RHEINLAND-PFALZ 17 Das Naturschutzgebiet „Ahrschleife bei Altenahr" ( einschließlich angrenzender schutzwürdiger Bereiche) Fauna, Flora, Geologie und Landespflegeaspekte TeilII von WOLFGANGBÜCHS unter Mitarbeit von J. BECKER, T. BLICK, H.-J. HOFFMANN, J. C. KÜHLE, R. REMANE, V. SLEMBROUCK & W. WENDLING Herausgegeben vom Landesamt fürUmweltschutz und GewerbeaufsichtRheinland-Pfalz Oppenheim 2003 Beiträge Landespflege Rheinland-Pfalz 17 Seite 1-376 Oppenheim 2003 Verkauf nur durch das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz, Amtsgerichtsplatz 1, 55276 Oppenheim (zum Preise von 10,-Euro zzgl. Porto und Verpackungskosten) Einband: Hintergrund: Kartenaufnahme(ca. 1809) von Tranchot und von Von Müffling Abbildungen/Fotosund Bildautoren: oben links: Tunnel bei Altenahr. Lithographie von PONSART (1839). Repro aus Sammlung I. Görtz, Altenahr. oben rechts: Breite Lay,1989, Dr. Dr. Wolfgang Büchs (Braunschweig) unten links: Jugendherberge im Langfigtal,1989, Dr. Dr. Wolfgang Büchs (Braunschweig) unten Mitte: Hasenglöckchen (Hyacinthoides non-scripta), F. J.Fuchs,Mayschoß unten rechts: Raubwanzen-Art (Rhinocoris iracundus), Prof. Dr. E. Wachmann (Berlin) Einbandgestaltung: SOMMERDruck und Verlag Herausgeber: Landesamt fürUmweltschutz und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz,Am tsgerichtsplatz 1, 55276 Oppenheim Schriftleitung: Dr. Dr. Wolfgang Büchs (Braunschweig) Klaus Groh (Hackenheim) Dr. ManfredNiehuis (Albersweiler) Dr. Dieter Rühl (Oppenheim) Für die einzelnen Beiträge zeichnendie jeweiligen (Ko)autor(inn)en -

Die Ahr – Ein Echtes Kernstück Der Eifel
Die Ahr – ein echtes Kernstück der Eifel Dr. Bruno P. Kremer er Blick auf eine hydrographische Karte des tigen Hunsrück legt der nicht weniger enge DRheinlandes, in der nur das weit verzweigte und vielfach gewundene Talzug der Mosel fest. Gewässernetz dargestellt ist, überzeugt sofort Auch der Nachvollzug der Westgrenze gelingt davon, dass die naturräumliche Gliederung zumindest im Südwesten mit einem Talverlauf, in über- und untergeordnete Landschaftsteile nämlich von Our und vor allem Sauer: Deren nach den Eigenheiten des Reliefs sowie vor Tal ist hier gleichzeitig die politische Grenze allem nach Lage und Verlauf der Fließgewäs- zum Nachbarland Luxemburg. Im Nordwesten ser erfolgt. Bei der Eifel lässt sich dies gerade- ist die Abgrenzung der Eifel zu den westlich zu lehrbuchreif klar aufzeigen: Das untere und anschließenden Ardennen bzw. zu Belgien tief eingeschnittene Mittelrhein-Engtal zwi- in der Geländegestalt dagegen unscharf. Die schen Andernach und Bonn, im Rheinischen Nordgrenze ist wiederum eindeutig anzugeben: Schiefergebirge ohnehin die auffälligste Struk- Sie zeichnet sich – ausnahmsweise ganz ohne turachse, markiert klar und eindeutig die Ost- ein hilfreiches Flusstal – lediglich als markante grenze der Eifel. Ihre südliche Begrenzung zum Geländestufe zu den weiten Ebenen des nord- landschaftlich und geologisch völlig andersar- westdeutschen Tieflandes ab. Heimatjahrbuch Kreis Ahrweiler 2013 u 117 Das Gewässernetz der Eifel stellt sich gänz- lich anders dar als in den benachbarten Mittelgebirgsteilen. Ausschnitt aus: Strub J., Vonderstraß, I., Leibundgut, Ch., Kern, F.-J.: Orohydrogra- phie (Atlastafel 1.1), in: BMU (Hrsg.): Hydrologischer Atlas von Deutschland, 3. Lieferung 2003. Mit freundlicher Genehmi- gung des Bundesamtes für Gewässerkunde (Koblenz) Die hydrographische Karte zeigt ferner, dass verwendet man unter anderem die Flussord- zahlreiche Fließgewässer den nach seinem Ge- nungszahl. -

Introduction of an Experimental Terrestrial Forecasting
Preprints (www.preprints.org) | NOT PEER-REVIEWED | Posted: 26 October 2018 doi:10.20944/preprints201810.0625.v1 1 Article 2 Introduction of an experimental terrestrial 3 forecasting/monitoring system at regional to 4 continental scales based on the Terrestrial System 5 Modeling Platform (v1.1.0) 6 Stefan Kollet1,2,*, Fabian Gasper1,2,**, Slavko Brdar3,2, Klaus Goergen1,2, Harrie-Jan 7 Hendricks-Franssen1,2, Jessica Keune1,4,2,***, Wolfgang Kurtz1,2,****, Volker Küll4, Florian 8 Pappenberger5, Stefan Poll4, Silke Trömel4, Prabhakar Shrestha4, Clemens Simmer4,2, and Mauro 9 Sulis4,***** 10 1 Agrosphere Inst., IBG-3, Inst. of Bio-Geosciences, Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich, Germany 11 2 Centre for High-Performance Scientific Computing, Geoverbund ABC/J, Germany 12 3 Jülich Supercomputing Centre, Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich, Germany 13 4 Meteorological Institute, Bonn University, Germany 14 5 European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 15 * Correspondence: [email protected]; Tel.: +49-2461-61-9593 16 ** Now at CISS TDI GmbH, Sinzig, Germany 17 *** Now at the Department of Forest and Water Management, Ghent University, Belgium 18 **** Now at Environmental Computing Group, Leibnitz Supercomputing Centre, Germany 19 ***** Now at the Department of Environmental Research and Innovation, Luxembourg Institute of 20 Technology, Luxembourg 21 22 23 Abstract: Operational weather and also flood forecasting has been performed successfully for 24 decades and is of great socioeconomic importance. Up to now, forecast products focus on 25 atmospheric variables, such as precipitation, air temperature and, in hydrology, on river discharge. 26 Considering the full terrestrial system from groundwater across the land surface into the 27 atmosphere, a number of important hydrologic variables are missing especially with regard to the 28 shallow and deeper subsurface (e.g. -

Ruhrgütebericht 2018 Ruhrgütebericht 8 Talsperren Ennepe- Talsperre Verse- Einzugsgebiete Der Talsperren Talsperre
AWWR ISSN 1613-4729 WISSEN,WERTE,WASSER Aktiv für Ihr Wasser aus dem Ruhrtal AWWR-Mitglieder Einzugsgebiet des Ruhrverbands 1 2 3 4 5 6 Oberhausen Essen Bochum Möhnetalsperre Schwerte Möhne Mülheim Witten Menden Ruhr Duisburg Ruhr Röhr Hönne Arnsberg Lenne Rhein Hagen Ruhr Brilon Volme Iserlohn Velbert Sorpe- Meschede Ennepe talsperre Ennepetal Altena Neger Ruhr WenneHennetalsperre Lüden- Plettenberg scheid Ruhrgütebericht 2018 Ruhrgütebericht 8 Talsperren Ennepe- talsperre Verse- Einzugsgebiete der Talsperren talsperre Attendorn Schmallenberg 5 Stauseen Fürwigge- Ahauser 64 Kläranlagen mit insgesamt talsperre Stausee Lenne 558 Niederschlagswasserbehandlungsanlagen Bigge- 46 Gewässerpegel (RV anteilig) talsperre 17 Wasserkraftwerke 0 10 20 30 km 16 Gewässergüte-Überwachungsstationen Olpe 119 Pumpwerke 2 Kanalnetze Bigge Charakterisierung des Ruhreinzugsgebiets nach EG-WRRL Fläche: 4.478 km2 Höhenverhältnisse: 20 bis 800 m ü. NN Gewässergüte- Anzahl der Planungseinheiten: 9 Überwachungsstationen (kontinuierlich) Gesamtlänge der 1. Duisburg (Ruhr-km 2,65) Fließgewässer: ~7.000 km 2. Essen-Werden (Ruhr-km 31,18 Anzahl Gewässer 3. Hattingen (Ruhr-km 56,70) im Einzugsgebiet > 10 km2: 122 4. Wetter (Ruhr-km 81,49) Anzahl Grundwasserkörper: 30 5. Fröndenberg (Ruhr-km 113,78) 178 natürliche und 65 als erheblich verändert 6. Echthausen (Ruhr-km 128,32) ausgewiesene Wasserkörper AWWR Aktiv für Ihr Wasser aus dem Ruhrtal c/o Vereinssitz: Wasserwerke Westfalen GmbH Zum Kellerbach 52 58239 Schwerte AWWR Telefon (02304) 9575-302 Fax (02304) 9575-333 Aktiv für Ihr Wasser aus dem Ruhrtal Geschäftsstelle: GELSENWASSER AG Die Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke an der Ruhr e.V. (AWWR) ist ein frei- Willy-Brandt-Allee 26 williger Zusammenschluss von Wasserversorgungsunternehmen, die Wasser aus 45891 Gelsenkirchen Telefon (0209) 708-274 dem Ruhrtal zu Trinkwasser aufbereiten und dies an die Endverbraucher verteilen. -

Öffentliche Bekanntmachung Der Stadt Netphen
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Netphen gemäß § 76 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und § 83 (2) Landeswassergesetz (LWG) Auslegung des Entwurfes der Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Festsetzung der Überschwemmungsgebiete der Gewässer Sieg, Dreisbach, Ferndorfbach, Littfe, Netphe, Alche, Weiß, Eisernbach, Heller, Wildenbach und Asdorfer Bach in der Managementeinheit Obere Sieg (ME_SIE_1400), Az.: 54.50.85-019 im Regierungsbezirk Arnsberg Die Bezirksregierung Arnsberg als zuständige Obere Wasserbehörde beabsichtigt, gemäß § 76 Wasserhaushaltsgesetz - WHG eine Verordnung zur Festsetzung der Überschwemmungsgebiete an den oben genannten Gewässern zu erlassen. Der Entwurf der Ordnungsbehördlichen Verordnung eines Überschwemmungsgebietes wird gemäß § 83 LWG für 2 Monate bei der zuständigen Behörde sowie bei den Gemeinden, auf deren Gebiet sich das Überschwemmungsgebiet erstreckt, ausgelegt. Jeder kann in dieser Zeit die Verordnung sowie die Karten einsehen und eine Stellungnahme abgeben. Näheres ist im Erläuterungstext beschrieben. Die Überschwemmungsgebiete in der Managementeinheit Obere Sieg erstrecken sich auf Flächen in den folgenden Kommunen: Stadt Siegen (Kreis Siegen-Wittgenstein) Stadt Freudenberg (Kreis Siegen-Wittgenstein) Gemeinde Wilnsdorf (Kreis Siegen-Wittgenstein) Stadt Kreuztal (Kreis Siegen-Wittgenstein) Stadt Hilchenbach (Kreis Siegen-Wittgenstein) Gemeinde Neunkirchen (Kreis Siegen-Wittgenstein) Gemeinde Burbach (Kreis Siegen-Wittgenstein) Stadt Netphen (Kreis Siegen-Wittgenstein) Die Unterlagen für die Festsetzung der -

3 Familiengerechte Kommunen
Familiengerechte Kommunen Kommunale Praxis in Nordrhein-Westfalen Materialien zur Prävention 3 Im Jahr 2011 haben die Landesregierung Nordrhein-Westfalen und die Bertelsmann Stiftung das Modellvorhaben „Kein Kind zurücklassen! Kommunen in NRW beu- gen vor“ (KeKiz) ins Leben gerufen. Gemeinsam mit achtzehn Modellkommunen haben sie es sich zum Ziel gemacht, die Rahmenbedingungen für ein gelingendes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen zu verbessern. Das Modellvorhaben wird wissenschaftlich begleitet. Die Bertelsmann Stiftung ver- antwortet die Begleitforschung gemeinsam mit den wissenschaftlichen Partnern. In der vorliegenden Schriftenreihe werden in unregelmäßigen Abständen Einblicke und Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Begleitforschung zur kommunalen Prävention mit unterschiedlichen wissenschaftlichen Partnern veröffentlicht. Die Reihe „Materialien zur Prävention“ macht dabei auch thematisch zugehörige Er- kenntnisse und Einblicke aus der erweiterten wissenschaftlichen Betrachtung des Modellvorhabens bekannt. In 2011, the State Government of North Rhine-Westphalia and the Bertelsmann Stiftung launched “Kein Kind zurücklassen! Kommunen in NRW beugen vor” (“Leave No Child Behind! Municipalities in North Rhine-Westphalia providing equal opportunities for all children”). Together with eighteen municipalities taking part in this joint initiative, the partners aim to improve development prospects and provide equal opportunities for every child. The undertaking is being studied in a parallel running research project -

Ruhrgütebericht 2016
AWWR ISSN 1613-4729 WISSEN,WERTE,WASSER Abflussganglinie und Abkürzungs- verzeichnis auf der Innenklappe AWWR-Mitglieder 1 46532 7 8 9 Oberhausen Essen Bochum Möhnetalsperre Schwerte Möhne Mülheim Witten Menden Ruhr Duisburg Ruhr Röhr Hönne Arnsberg Lenne Rhein Hagen Ruhr Brilon Volme Iserlohn Velbert Sorpe- Meschede Ennepe talsperre Ennepetal Altena Ruhr WenneHennetalsperre regeN Lüden- Plettenberg scheid 8 Talsperren Ennepe- talsperre Verse- Einzugsgebiete der Talsperren talsperre Ruhrgütebericht 2016 Ruhrgütebericht Attendorn Schmallenberg 5 Stauseen Fürwigge- Ahauser talsperre 66 Kläranlagen mit insgesamt Stausee Lenne 558 Niederschlagswasserbehandlungsanlagen Bigge- 47 Gewässerpegel (RV anteilig) talsperre 17 Wasserkraftwerke 0 10 20 30 km 19 Gewässergüte-Überwachungsstationen Olpe 120 Pumpwerke Bigge Charakterisierung des Ruhreinzugsgebiets Gewässergüte- nach EG-WRRL Überwachungsstationen (kontinuierlich) Fläche: 4.478 km2 1. Duisburg (Ruhr-km 2,65) Höhenverhältnisse: 20 bis 800 m ü. NN 2. Mülheim (Ruhr-km 14,43) Anzahl der Planungseinheiten: 9 3. Essen-Kettwig (Ruhr-km 23,47) Gesamtlänge der 4. Essen-Werden (Ruhr-km 31,18) Fließgewässer: ~7.000 km 5. Essen-Kupferdreh (Ruhr-km 38,19) Anzahl Gewässer 6. Hattingen (Ruhr-km 56,70) im Einzugsgebiet > 10 km2: 122 7. Wetter (Ruhr-km 81,49) Anzahl Grundwasserkörper: 30 8. Fröndenberg (Ruhr-km 113,78) 178 natürliche und 65 als erheblich verändert 9. Echthausen (Ruhr-km 128,32) ausgewiesene Wasserkörper AWWR Gierskoppbach Ölbach c/o Möhne Vereinssitz: Wasserwerke Westfalen GmbH Zum Kellerbach 52 58239 Schwerte AWWR Telefon (02304) 9575-302 Fax (02304) 9575-333 Bochum-Ölbachtal Schwerte Wickede Arnsberg-Wildshausen KA KA KA KA Möhnetalsperre Geschäftsstelle: Essen-Kettwig KA Essen-Süd KA GELSENWASSER AG Die Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke an der Ruhr e.V.