Die Ahr – Ein Echtes Kernstück Der Eifel
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

High Level of Protection Against Water-Related Disease (Art
WHO Collaborating Centre for Health Promoting Water Management and Risk Communication Institute for Hygiene and Public Health University of Bonn WaMRi-Newsletter No. 9, February 2006 Dear Reader, The Protocol on Water and Health to the 1992 Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes finally entered into force. On 4th August 2005 it became legally binding for the 16 ratifying countries. It is the first major international legal approach for prevention, control and reduction of water-related diseases in Europe. Please read more about it in our first contribution of the WaMRi-Newsletter. This issue also deals with the project Swist III , focussed on River Swist in North Rhine- Westphalia as an example for microbial load of watercourses due to diffuse polluters. The report from the Aral Sea Basin Water and Food Conference summarizes its main findings entitled as “ Managing Water and Food Quality in Central Asia ” which took place in Almaty, Kazakhstan, on 1-2 September 2005. We would like to inform you that only the authors are responsible for the content of their articles and they do not necessary reflect the opinions or positions of the WHO CC. Content The Protocol on Water and Health p. 2 River Swist in North Rhine-Westphalia as an example for microbial load of watercourses due to diffuse polluters – an interim result p. 5 News from the Aral Sea Basin Water and Food Conference p. 9 Special events on water, environment and health p.11 Links p.12 Selected books and articles p.13 Head of WHO CC : Dr. -
Die Swist Die Bäche Und Das Grundwasser Im Swistgebiet - Zustand, Ursachen Von Belastungen Und Maßnahmen
Die Swist Die Bäche und das Grundwasser im Swistgebiet - Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen www.umwelt.nrw.de PE_ERF_1400.indd 1 14.12.2008, 15:34 PE_ERF_1400.indd 2 14.12.2008, 15:34 Inhalt 5 Vorworte 8 Wasser ist Leben 8 Die europäische Wasserrahmenrichtlinie: Fahrplan für unsere Flüsse, Seen und das Grundwasser 9 NRW ist aktiv 9 Mischen Sie sich ein! 10 Die Bewirtschaftungsplanung für das Swistgebiet 12 Das Swistgebiet 14 Die Fließgewässer und Seen 16 Zustand der Gewässer 17 Die Wasserqualität • Saprobie – die biologische Gewässergüte • Plankton, Algen, Wasserpfl anzen • Pfl anzenschutzmittel • Metalle • Sonstige Schadstoffe 22 Der ökologische Zustand der Gewässer • Die allgemeine Degradation • Die Fischfauna 24 Belastungsursachen und Maßnahmen 28 Das Grundwasser 31 Mit gutem Beispiel voran 33 Ansprechpartner 34 Impressum PE_ERF_1400.indd 3 14.12.2008, 15:34 Carpediem PE_ERF_1400.indd 4 14.12.2008, 15:34 5 Liebe Bürgerinnen und Bürger, in Nordrhein-Westfalen haben wir zwar eine gute Wasser- qualität, doch unsere Gewässer bieten oft noch nicht den ökologisch notwendigen Lebensraum, um auch Lebens- adern der Natur zu sein. Wir wollen deshalb die Gewässer- ökologie in Nordrhein-Westfalen verbessern und orientieren uns dabei an den europäisch vereinbarten Qualitätszielen. Wir möchten den Zustand der nordrhein-westfälischen Gewässer verbessern im Interesse der Artenvielfalt, des Hochwasserschutzes und der regionalen Entwicklung. Dieses ambitionierte Ziel können wir nur in Kooperation mit den Kommunen, den Wasserverbänden, der Land- und Forstwirtschaft, der Industrie, den Naturschutzverbänden und natürlich nur gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern erreichen. Wir werden jetzt überall im Land mit zahlreichen Maßnah- men beginnen und voraussichtlich bis 2027 die Ziele errei- chen. -
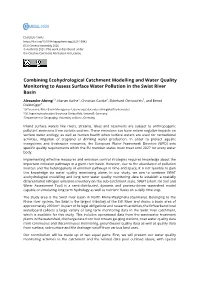
Combining Ecohydrological Catchment Modelling and Water Quality Monitoring to Assess Surface Water Pollution in the Swist River Basin
EGU2020-19842 https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-19842 EGU General Assembly 2020 © Author(s) 2021. This work is distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 License. Combining Ecohydrological Catchment Modelling and Water Quality Monitoring to Assess Surface Water Pollution in the Swist River Basin Alexander Ahring1,3, Marvin Kothe1, Christian Gattke1, Ekkehard Christoffels2, and Bernd Diekkrüger3 1Erftverband, River Basin Management, Germany ([email protected]) 2IBC Ingenieurtechnische Beratung Christoffels, Vettweiß, Germany 3Department of Geography, University of Bonn, Germany Inland surface waters like rivers, streams, lakes and reservoirs are subject to anthropogenic pollutant emissions from various sources. These emissions can have severe negative impacts on surface water ecology, as well as human health when surface waters are used for recreational activities, irrigation of cropland or drinking water production. In order to protect aquatic ecosystems and freshwater resources, the European Water Framework Directive (WFD) sets specific quality requirements which the EU member states must meet until 2027 for every water body. Implementing effective measures and emission control strategies requires knowledge about the important emission pathways in a given river basin. However, due to the abundance of pollution sources and the heterogeneity of emission pathways in time and space, it is not feasible to gain this knowledge via water quality monitoring alone. In our study, we aim to combine SWAT ecohydrological modelling and long term water quality monitoring data to establish a spatially differentiated nitrogen emission inventory on the sub-catchment scale. SWAT (short for Soil and Water Assessment Tool) is a semi-distributed, dynamic and process-driven watershed model capable of simulating long term hydrology as well as nutrient fluxes on a daily time step. -

Das Vorgebirge. Ein Beitrag Zur Rheinischen Landeskunde
Das Vorgebirge. Ein Beitrag zur rheinischen Landeskunde. Von Clotilde Ellscheid. Mit 6 Karten und Tafel IX u. X. Inhaltsbericht. Einführung: Lage, Abgrenzung und äußere Erscheinung Seite des G e b i e t e s ...............................................................................199—204 I. Teil: Die Natur der Landschaft........................................... 205—242 1 . Geologischer Bau, Oberflächenformen u. Boden 205 2. Das K lim a .......................................................... 222 8 . Die hydrologischen V e rh ä ltn isse.......... 228 4. Das Landschaftsbild im Wandel der Zeiten . 236 II. Teil: Die wirtschaftlichen V erhältnisse.......................... 242—276 1 . Die Nutzbarmachung der natürlichen Wasser vorräte .......................................................................... 242 2. Die W a ld w irtsch a ft..................................... 245 3. Die landwirtschaftlichen Verhältnisse. 248 a) Die Landwirtschaft am Osthang des Vor gebirges zwischen Bonn und Frechen . 248 b) Die Landwirtschaft auf der Hochfläche . 257 4. Die Industrie............................................................... 262 a) Der Eisenerzabbau als ausgestorbener Wirt schaftszweig. — Die Gewinnung und Ver wertung der B rau n k oh le.............. 262 b) Die Ausnutzung der Ton- und Sandlager 270 5. Der umgestaltende Einfluß der Industrie auf das Landschaftsbild.............................. 275 III. Teil: Die Verkehrswege........................................................ 276—280 IV. Teil: Zur Siedlungsgeographie -

Mittleres Ahrtal"1 Aus Naturkundlicher Sicht, Dargestellt Am Beispiel Des Naturschutzgebietes ,,Ahrschleife Bei Altenahr"
BEITRÄGE ZUR LANDESPFLEGE IN RHEINLAND-PFALZ 17 Das Naturschutzgebiet „Ahrschleife bei Altenahr" ( einschließlich angrenzender schutzwürdiger Bereiche) Fauna, Flora, Geologie und Landespflegeaspekte TeilII von WOLFGANGBÜCHS unter Mitarbeit von J. BECKER, T. BLICK, H.-J. HOFFMANN, J. C. KÜHLE, R. REMANE, V. SLEMBROUCK & W. WENDLING Herausgegeben vom Landesamt fürUmweltschutz und GewerbeaufsichtRheinland-Pfalz Oppenheim 2003 Beiträge Landespflege Rheinland-Pfalz 17 Seite 1-376 Oppenheim 2003 Verkauf nur durch das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz, Amtsgerichtsplatz 1, 55276 Oppenheim (zum Preise von 10,-Euro zzgl. Porto und Verpackungskosten) Einband: Hintergrund: Kartenaufnahme(ca. 1809) von Tranchot und von Von Müffling Abbildungen/Fotosund Bildautoren: oben links: Tunnel bei Altenahr. Lithographie von PONSART (1839). Repro aus Sammlung I. Görtz, Altenahr. oben rechts: Breite Lay,1989, Dr. Dr. Wolfgang Büchs (Braunschweig) unten links: Jugendherberge im Langfigtal,1989, Dr. Dr. Wolfgang Büchs (Braunschweig) unten Mitte: Hasenglöckchen (Hyacinthoides non-scripta), F. J.Fuchs,Mayschoß unten rechts: Raubwanzen-Art (Rhinocoris iracundus), Prof. Dr. E. Wachmann (Berlin) Einbandgestaltung: SOMMERDruck und Verlag Herausgeber: Landesamt fürUmweltschutz und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz,Am tsgerichtsplatz 1, 55276 Oppenheim Schriftleitung: Dr. Dr. Wolfgang Büchs (Braunschweig) Klaus Groh (Hackenheim) Dr. ManfredNiehuis (Albersweiler) Dr. Dieter Rühl (Oppenheim) Für die einzelnen Beiträge zeichnendie jeweiligen (Ko)autor(inn)en -

Introduction of an Experimental Terrestrial Forecasting
Preprints (www.preprints.org) | NOT PEER-REVIEWED | Posted: 26 October 2018 doi:10.20944/preprints201810.0625.v1 1 Article 2 Introduction of an experimental terrestrial 3 forecasting/monitoring system at regional to 4 continental scales based on the Terrestrial System 5 Modeling Platform (v1.1.0) 6 Stefan Kollet1,2,*, Fabian Gasper1,2,**, Slavko Brdar3,2, Klaus Goergen1,2, Harrie-Jan 7 Hendricks-Franssen1,2, Jessica Keune1,4,2,***, Wolfgang Kurtz1,2,****, Volker Küll4, Florian 8 Pappenberger5, Stefan Poll4, Silke Trömel4, Prabhakar Shrestha4, Clemens Simmer4,2, and Mauro 9 Sulis4,***** 10 1 Agrosphere Inst., IBG-3, Inst. of Bio-Geosciences, Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich, Germany 11 2 Centre for High-Performance Scientific Computing, Geoverbund ABC/J, Germany 12 3 Jülich Supercomputing Centre, Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich, Germany 13 4 Meteorological Institute, Bonn University, Germany 14 5 European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 15 * Correspondence: [email protected]; Tel.: +49-2461-61-9593 16 ** Now at CISS TDI GmbH, Sinzig, Germany 17 *** Now at the Department of Forest and Water Management, Ghent University, Belgium 18 **** Now at Environmental Computing Group, Leibnitz Supercomputing Centre, Germany 19 ***** Now at the Department of Environmental Research and Innovation, Luxembourg Institute of 20 Technology, Luxembourg 21 22 23 Abstract: Operational weather and also flood forecasting has been performed successfully for 24 decades and is of great socioeconomic importance. Up to now, forecast products focus on 25 atmospheric variables, such as precipitation, air temperature and, in hydrology, on river discharge. 26 Considering the full terrestrial system from groundwater across the land surface into the 27 atmosphere, a number of important hydrologic variables are missing especially with regard to the 28 shallow and deeper subsurface (e.g. -

4.5 PE ERF 1400: Swist
Bestandsaufnahme NRW 2013 – Steckbriefe der Planungseinheiten im Teileinzugsgebiet Erft NRW 4.5 PE_ERF_1400: Swist 4.5.1 Allgemeine Informationen zur Planungseinheit Gebietsbeschreibung Die Planungseinheit „Swist“ (PE_ERF_1400) umfasst eine Fläche von insgesamt 266 km². In dem Gebiet leben 106.000 Einwohner. Das Swistgebiet ist landwirtschaft- lich geprägt. Mehr als die Hälfte der Flächen sind Ackerflächen oder Grünland, ein Drit- tel der Fläche ist bewal- Flussgebiet Rhein det. Bearbeitungsgebiet Niederrhein Das größte Gewässer in Teileinzugsgebiet Erft NRW der Planungseinheit ist der Planungseinheit PE_ERF_1400 Swistbach, der auf 330 m Bezeichnung Swist Höhe im Ahrgebirge ent- Geschäftsstelle Erft springt und in Erftstadt- Fläche 266 km² Bliesheim in die Erft mün- Länge der berichtspflich- 123 km det. tigen Gewässer Die Swist hat eine Länge von 43,6 km und Die Gewässer im Ein- entspringt auf 330 m ü. NN am Nordrand der zugsgebiet der Swist wur- Eifel nördlich der rheinland-pfälzischen Ortsgemeinde Kalenborn in der den zugunsten verschie- Verbandsgemeinde Altenahr im Landkreis dener Nutzungen einge- Ahrweiler. Sie fließt bei einem mittleren Gefälle von 5 ‰ zunächst bis zum Grafschafter fasst, begradigt oder in Verlauf Ortsteil Vettelhoven in Richtung Nordosten den Städten zum Teil ver- und verläuft dann mit 1,3 ‰ Gefälle entlang rohrt. der Ville durch Meckenheim, den Rheinbacher Stadtteil Flerzheim und die Gemeinden Die zuvor aus zwei Was- Swisttal und Weilerswist. Zwischen Weilerswist und Erftstadt-Bliesheim mündet er serkörpern bestehenden auf 108 m ü. NN in die Erft. Gewässer Morsbach und Hauptgewässer Swist Schießbach wurden auf- Altendorfer Bach, Buschbach, Eulenbach, grund gleicher Fließge- Morsbach, Müggenhausener Fließ, Nebengewässer wässertypen zu jeweils Schießbach, Steinbach, Sürstbach/ einem Wasserkörper zu- Schiefelsbach, Wallbach sammengefasst. -

Germany E-Mail: Oea-1000 @ Wp.Gate.Bmu.De Internet: Printed By: Neusser Druckerei Und Verlag Gmbh, Neuss As Of: March 1998
Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety Federal Government Report under the Convention on Biological Diversity National Report on biological Diversity Federal Environment Ministry Imprint Published by: Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety P.O. Box 12 06 29 53048 Bonn Germany E-Mail: oea-1000 @ wp.gate.bmu.de Internet: http://www.bmu.de Printed by: Neusser Druckerei und Verlag GmbH, Neuss As of: March 1998 2 Contents Summary . 7 1. Introduction: The convention on biological diversity: a new way of looking at the conservation and use of biological diversity . 8 2. Background . 10 2.1 Legal and political framework in Germany for compiling the National Report and the national strategy . 10 2.1.1 Participation of political levels, social groups and institutions in the compilation of the National Report . 10 2.1.2 Responsibilities for implementing the national strategy . 11 2.1.3 Links with European activities . 12 2.2 Brief summary of Germany's geographical, ecological and economic situation, existing biological diversity and the institutional and legal framework . 13 2.2.1 Germany's geographical and ecological situation . 13 2.2.2 Germany's economic situation . 13 2.2.3 Existing status of biological diversity in Germany . 14 2.2.4 Institutional and legal framework and current programmes . 18 3. Objectives and Models in the approach to biological diversity . 21 3.1 Models for sustainable development . 21 3.2 Principles applied in environment and nature conservation policy . 21 3.3 Conservation and sustainable use of biological diversity . 22 3.4 Specific international goals and models . -

LANUV-Arbeitsblatt 3
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen Fortschreibung des Bewertungsverfahrens für Makrophyten in Fließgewässern in Nordrhein-Westfalen gemäß den Vorgaben der EG-Wasser-Rahmen-Richtlinie LANUV-Arbeitsblatt 3 www.lanuv.nrw.de Fortschreibung des Bewertungsverfahrens für Makrophyten in Fließgewässern in Nordrhein-Westfalen gemäß den Vorgaben der EG-Wasser-Rahmen-Richtlinie LANUV-Arbeitsblatt 3 Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen Recklinghausen 2008 IMPRESSUM Herausgeber: Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NordrheinWestfalen (LANUV NRW) Leibnitzstr. 10, 45659 Recklinghausen Telefon (0 23 61) 305 - 0 Telefax (0 23 61) 305 32 15 E-Mail: [email protected] Projektleitung: Dr. Ilona Arndt-Dietrich, LANUV NRW Bearbeitung: Dr. Klaus van de Weyer lanaplan, Lobbericher Str. 5, D-41334 Nettetal, Tel 02153-97 19 20, Fax 02153-97 19 21 E-Mail: [email protected] www.lanaplan.de Bildnachweis: Abb. 4-3: Dr. U. Koenzen, 6-36: B. Daniel, 6-37: R. Ludwig, ansonsten: K. van de Weyer bzw. Lanaplan Abb. in Tab. 3-1 und 3-2: van de Weyer & Schmidt (2007) ISSN: 1864-8916 LANUV-Arbeitsblätter Informations- Informationen und Daten aus NRW zu Natur, Umwelt und dienste: Verbraucherschutz unter • www.lanuv.nrw.de Aktuelle Luftqualitätswerte zusätzlich im • Telefonansagedienst (02 01) 1 97 00 • WDR-Videotext Tafeln 177 bis 179 Bereitschafts- Nachrichtenbereitschaftszentrale des LANUV NRW dienst: (24-Std.-Dienst): Telefon (02 01) 71 44 88 Nachdruck – auch auszugsweise – ist nur unter Quellenangaben und Überlassung von Belegexemplaren nach vorheriger Zustimmung des Herausgebers gestattet. Die Verwendung für Werbezwecke ist grundsätzlich untersagt. Fortschreibung des Bewertungsverfahrens für Makrophyten in Fließgewässern in Nordrhein-Westfalen Inhalt Inhalt ........................................................................................................................................ -

Die Entstehung Des Ahrtales
Die Entstehung des Ahrtales Prof. Dr. Wilhelm Meyer as Ahrtal hat immer wieder Geologen ange- deshalb Trockentäler oder sie führen nur zeit- Dlockt und so zur Kenntnis des Rheinischen weise Wasser. Unterhalb von Ahrhütte verlässt Schiefergebirges beigetragen. Denn der Fluss die Ahr diese Kalkmulde, fließt dann andert- hat in z. T. imposanten Felswänden Gesteine halb Kilometer durch Sandsteine und Ton- freigelegt, die in dem Zeitraum entstanden, der steine des Wiesbaumer Unterdevonsattels und 385 bis 410 Millionen Jahre zurückliegt, das ist tritt danach in die Ahrdorfer Kalkmulde ein, die in der Erdgeschichte der Abschnitt zwischen sie etwa 3 km weit durchquert. Die Ahrdorfer Untersiegen (Unterdevon) und Oberem Mit- Kalkmulde, die sich in die Hillesheimer Mulde teldevon. Einige der bei Kreuzberg, Altenahr fortsetzt, ist die einzige der Eifelkalkmulden, und Schuld an den Talhängen herauspräpa- die ein Stück in den Kreis Ahrweiler hinein- rierten Gesteinsfalten sind in Lehrbüchern weit zieht (bei Dorsel). Im Bereich der Mündung des bekannt gemacht worden. Außerdem lässt sich Ahbaches verlässt die Ahr diese Kalkmulde hier einiges über die Entstehung unserer Täler lernen. Der Untergrund des Ahrtales Die ersten Kilometer des Flusslaufes liegen im Kreis Euskirchen. Dieser Bereich gehört zur Zo- ne der Eifeler Kalkmulden, in der hauptsächlich während der Mitteldevon-Zeit in einem war- men Flachmeer entstandene Kalke breite Wan- nen bildeten, die in der Geologie als Mulden bezeichnet werden. Zwischen ihnen kommen in Sättel genannten Aufwölbungen Unterdevon- Gesteine an die Oberfläche, das sind Sandsteine und Schiefer, die ebenfalls in einem Meer und seinem Küstenbereich entstanden. In der Blankenheimer Kalkmulde entspringt die Ahr als Karstquelle; das bedeutet, dass unterir- disches Wasser, das in Hohlräumen in Kalk ge- speichert ist, an einer undurchlässigen Schicht sich zur Oberfläche emporstaut, so dass es aus- fließt. -

Online E-Water of Water Quality Onthe River Erft Proof Read Rev A
E-WAter Official Publication of the European Water Association (EWA) © EWA 2008 ISSN 1994-8549 Ekkehard Christoffels 1, Erftverband, Bergheim Online Monitoring of Water Quality on the River Erft Abstract Eighteen years ago the Erftverband, a water management association in North Rhine- Westphalia (Germany) initiated an online monitoring network for continuous recording of contents of surface water in the catchment area of the Erft river. With this system the Erftverband can collect data on the most important parameters for water quality management. The reason for establishing this online monitoring network is explained and the system, which could serve as a model for planning, building and operating any such network, is described. Some examples of data obtained using this system are presented. KEYWORDS: online monitoring; in-situ station; on-site station; water quality; water temperature; oxygen concentration; nutrients. 1. Introduction Water quality in the Erft requires considerable attention because usage demands are high relative to the rivers modest size. Some background on the river and its uses are provided to explain why the Erftverband established online substance monitoring. The source of the Erft river is situated in the general vicinity of the former German capital, Bonn, in North Rhine-Westphalia (figure 1) . Near the city of Euskirchen the river, with an average 1% slope of decline, leaves the mountainous region called the Eifel. In the middle and lower reaches the Erft descends at a very gradual slope of 0.1%. At the end of its 110 km course the Erft flows into the Rhine river near the city of Düsseldorf. Wide areas of the river basin are dominated by cultivation of field crops including wheat, rye, barley and sugar beets. -

Stellungnahme Von BUND, NABU Und LNU in NRW
Gemeinsame Stellungnahme der Naturschutzverbände in Nordrhein-Westfalen zum Entwurf des Bewirtschaftungsplans und Maßnahmenprogramms 2016-2021für die nordrhein- westfälischen Anteile von Rhein, Weser, Ems und Maas (Stand: 19.11.2014) einschließlich zu den Vorschlägen der Planungseinheitensteckbriefe Bearbeitung: Nora Guttmann & Christian Schweer Wassernetz NRW Merowinger Str. 88 40225 Düsseldorf Beiträge: Mitglieder von BUND, NABU und LNU (Alle Beiträge, insbesondere Stellungnahmen zu einzelnen Gewässern, Wasserkörpergruppen oder Planungseinheiten), BUND Landesarbeitskreis Wasser und Landesbüro der Naturschutzverbände. Hinweise: Diese Druckfassung enthält die Originaltexte der gemeinsamen Stellungnahme, die am 17.06.2015 an das MkUNLV übersandt wurde. Als verbindlich gelten auch die Texte, die in das System Beteiligung online aufgenommen wurden. Die gesamte Stellungnahme kann auch in Internet unter der Adresse www.wassernetz-nrw.de/de eingesehen werden. Stand: 16.6.2015 2 Inhaltverzeichnis Teil A - Vorbemerkung 4 Teil B - Stellungnahme zu den Texten des Bewirtschaftungsplans 6 Zu Kapitel 2 - Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer 6 Zu Kapitel 3 – Risikoanalyse der Zielerreichung 2021 33 Zu Kapitel 4 – Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete 41 Zu Kapitel 5 - Umweltziele und Ausnahmeregelungen 70 Zu Kapitel 6 - Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzung 91 Zu Kapitel 7 - Zusammenfassung des Maßnahmenprogramms 107 Zu Kapitel 8 - Verzeichnis detaillierter