„Bernd“ Vom 12. Bis 19. Juli 2021
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

High Level of Protection Against Water-Related Disease (Art
WHO Collaborating Centre for Health Promoting Water Management and Risk Communication Institute for Hygiene and Public Health University of Bonn WaMRi-Newsletter No. 9, February 2006 Dear Reader, The Protocol on Water and Health to the 1992 Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes finally entered into force. On 4th August 2005 it became legally binding for the 16 ratifying countries. It is the first major international legal approach for prevention, control and reduction of water-related diseases in Europe. Please read more about it in our first contribution of the WaMRi-Newsletter. This issue also deals with the project Swist III , focussed on River Swist in North Rhine- Westphalia as an example for microbial load of watercourses due to diffuse polluters. The report from the Aral Sea Basin Water and Food Conference summarizes its main findings entitled as “ Managing Water and Food Quality in Central Asia ” which took place in Almaty, Kazakhstan, on 1-2 September 2005. We would like to inform you that only the authors are responsible for the content of their articles and they do not necessary reflect the opinions or positions of the WHO CC. Content The Protocol on Water and Health p. 2 River Swist in North Rhine-Westphalia as an example for microbial load of watercourses due to diffuse polluters – an interim result p. 5 News from the Aral Sea Basin Water and Food Conference p. 9 Special events on water, environment and health p.11 Links p.12 Selected books and articles p.13 Head of WHO CC : Dr. -
Die Swist Die Bäche Und Das Grundwasser Im Swistgebiet - Zustand, Ursachen Von Belastungen Und Maßnahmen
Die Swist Die Bäche und das Grundwasser im Swistgebiet - Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen www.umwelt.nrw.de PE_ERF_1400.indd 1 14.12.2008, 15:34 PE_ERF_1400.indd 2 14.12.2008, 15:34 Inhalt 5 Vorworte 8 Wasser ist Leben 8 Die europäische Wasserrahmenrichtlinie: Fahrplan für unsere Flüsse, Seen und das Grundwasser 9 NRW ist aktiv 9 Mischen Sie sich ein! 10 Die Bewirtschaftungsplanung für das Swistgebiet 12 Das Swistgebiet 14 Die Fließgewässer und Seen 16 Zustand der Gewässer 17 Die Wasserqualität • Saprobie – die biologische Gewässergüte • Plankton, Algen, Wasserpfl anzen • Pfl anzenschutzmittel • Metalle • Sonstige Schadstoffe 22 Der ökologische Zustand der Gewässer • Die allgemeine Degradation • Die Fischfauna 24 Belastungsursachen und Maßnahmen 28 Das Grundwasser 31 Mit gutem Beispiel voran 33 Ansprechpartner 34 Impressum PE_ERF_1400.indd 3 14.12.2008, 15:34 Carpediem PE_ERF_1400.indd 4 14.12.2008, 15:34 5 Liebe Bürgerinnen und Bürger, in Nordrhein-Westfalen haben wir zwar eine gute Wasser- qualität, doch unsere Gewässer bieten oft noch nicht den ökologisch notwendigen Lebensraum, um auch Lebens- adern der Natur zu sein. Wir wollen deshalb die Gewässer- ökologie in Nordrhein-Westfalen verbessern und orientieren uns dabei an den europäisch vereinbarten Qualitätszielen. Wir möchten den Zustand der nordrhein-westfälischen Gewässer verbessern im Interesse der Artenvielfalt, des Hochwasserschutzes und der regionalen Entwicklung. Dieses ambitionierte Ziel können wir nur in Kooperation mit den Kommunen, den Wasserverbänden, der Land- und Forstwirtschaft, der Industrie, den Naturschutzverbänden und natürlich nur gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern erreichen. Wir werden jetzt überall im Land mit zahlreichen Maßnah- men beginnen und voraussichtlich bis 2027 die Ziele errei- chen. -

German Climate Governance Perspectives on North Rhine-Westphalia
German Climate Governance Perspectives on North Rhine-Westphalia Implemented by Imprint ‘German Climate Governance – Perspectives on North Rhine-Westphalia’ was compiled in the framework of the Sino- German Climate Partnership and Cooperation on Renewable Energies Project which is implemented by GIZ on behalf of the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB). Additional support for the publication has come from the Sino-German Climate Change Programme, which is implemented by GIZ on behalf of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ). 29 May, 2014 Contact Information Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Sunflower Tower 860 Maizidian Street 37, Chaoyang District, 100125 Beijing, PR China Ursula Becker Project Director Sino-German Climate Partnership E: [email protected] T: + 86 (0) 10 8527 5589 ext.101 Till Kötter Programme Manager Sino-German Climate Change Programme E: [email protected] T: + 86 (0) 10 8527 5589 ext.112 Andrew Park Programme Officer Sino-German Climate Change Programme E: [email protected] T: + 86 (0) 10 8527 5589 ext.121 Photo Credits Profile photos for the individual interviews have been provided by the interviewees themselves. Cover photos are copyright EnergieAgentur.NRW (under CC BY 2.0 License) Disclaimer The content of the individual interviews herein are provided for reference only, and are the views of the authors only, and are not necessarily endorsed by GIZ or other attributed entities. German Climate Governance Perspectives on North Rhine-Westphalia German Climate Governance German Climate Governance Preface Success stories from the provincial and city levels increasingly play a role in shaping the national mitigation strategies of China and Germany. -

1/98 Germany (Country Code +49) Communication of 5.V.2020: The
Germany (country code +49) Communication of 5.V.2020: The Bundesnetzagentur (BNetzA), the Federal Network Agency for Electricity, Gas, Telecommunications, Post and Railway, Mainz, announces the National Numbering Plan for Germany: Presentation of E.164 National Numbering Plan for country code +49 (Germany): a) General Survey: Minimum number length (excluding country code): 3 digits Maximum number length (excluding country code): 13 digits (Exceptions: IVPN (NDC 181): 14 digits Paging Services (NDC 168, 169): 14 digits) b) Detailed National Numbering Plan: (1) (2) (3) (4) NDC – National N(S)N Number Length Destination Code or leading digits of Maximum Minimum Usage of E.164 number Additional Information N(S)N – National Length Length Significant Number 115 3 3 Public Service Number for German administration 1160 6 6 Harmonised European Services of Social Value 1161 6 6 Harmonised European Services of Social Value 137 10 10 Mass-traffic services 15020 11 11 Mobile services (M2M only) Interactive digital media GmbH 15050 11 11 Mobile services NAKA AG 15080 11 11 Mobile services Easy World Call GmbH 1511 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1512 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1514 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1515 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1516 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1517 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1520 11 11 Mobile services Vodafone GmbH 1521 11 11 Mobile services Vodafone GmbH / MVNO Lycamobile Germany 1522 11 11 Mobile services Vodafone -

Linienbündelung
ZWECKVERBAND VERKEHRSVERBUND REGION TRIER Beschlussvorlage zum Linienbündelungskonzept des ZV VRT und des Landkreises Vulkaneifel im Rahmen der Ergänzung des regionalen und lokalen Nahverkehrsplanes Änderungen auf Basis des Beteiligungsverfahrens zur Beschlussvorlage vom 28. Januar 2016 sind grau hinterlegt bzw. durchgestrichen: Erläuterungen zur Linienbündelung Die Bündelung von Linien erfolgt insbesondere zu dem Zweck, eine dauerhafte, kostengünstige Verkehrsbedienung im Sinne eines wirtschaftlichen Ausgleichs zwischen ertragsstarken und ertragsschwachen Linien zu sichern. Hinsichtlich zukünftiger Genehmigungs- und/oder Ausschreibungswettbewerbe definieren Linienbündel zugleich sinnvolle Lose. Im Vorlauf zu Genehmigungs-/Ausschreibungswettbewerben kann die Bündelung von Linien vor "Rosinenpickerei" schützen, bei der sich Verkehrsunternehmen die Konzessionen für rentable Linien sichern, indem sie Angebote abgeben, diese kommerziell - also eigenwirtschaftlich - betreiben, während die verbleibenden, weniger rentablen Verkehre allein der Öffentlichen Hand überlassen werden. 1. Bündelbildung 1.1. Abwenden von „Rosinenpickerei“ Werden bei der Konzipierung von Linienbündeln gewinnbringende und defizitäre Relationen zusammengefügt, so wird hiermit erreicht, dass das Verkehrsunternehmen in die Verpflichtung gerät, seine Gewinne der rentablen Linien in die Finanzierung der ertragsärmeren Bereiche einzubringen. Der erweiterte Konzessionsschutz des Bündels sichert eine Abwehr konkurrierender Genehmigungsanträge auf ertragsstarke Einzellinien des -

The ELSA Tephra Stack: Volcanic Activity in the Eifel During the Last 500,000 Years
Global and Planetary Change 142 (2016) 100–107 Contents lists available at ScienceDirect Global and Planetary Change journal homepage: www.elsevier.com/locate/gloplacha The ELSA tephra stack: Volcanic activity in the Eifel during the last 500,000 years Michael W. Förster ⁎, Frank Sirocko Institute of Geosciences, Johannes Gutenberg-University, J.-J. Becher Weg 21, 55128 Mainz, Germany article info abstract Article history: Tephra layers of individual volcanic eruptions are traced in several cores from Eifel maar lakes, drilled between Received 31 January 2015 1998 and 2014 by the Eifel Laminated Sediment Archive (ELSA). All sediment cores are dated by 14Candtuned Received in revised form 29 May 2015 to the Greenland interstadial succession. Tephra layers were characterized by the petrographic composition Accepted 7 July 2015 of basement rock fragments, glass shards and characteristic volcanic minerals. 10 marker tephra, including the Available online 31 December 2015 well-established Laacher See Tephra and Dümpelmaar Tephra can be identified in the cores spanning the last gla- Keywords: cial cycle. Older cores down to the beginning of the Elsterian, show numerous tephra sourced from Strombolian 40 39 Eifel and phreatomagmatic eruptions, including the Ar/ Ar dated differentiated tephra from Glees and Hüttenberg. Tephrochronology In total, at least 91 individual tephra can be identified since the onset of the Eifel volcanic activity at about 500,000 Pleistocene b2k, which marks the end of the ELSA tephra stack with 35 Strombolian, 48 phreatomagmatic and 8 tephra layers Climate of evolved magma composition. Many eruptions cluster near timings of the global climate transitions at 140,000, Laminated lake sediments 110,000 and 60,000 b2k. -

Rheinland-Pfalz Verwaltung
Politische Bildung PULHEIM Rheinland-Pfalz - unser Land im Überblick LVermGeo Erft Verwaltung RurRheinland-Pfalz BERGISCH- Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz GEILENKIRCHEN GLADBACH für Landeszentrale Rheinland - Pfalz ÜBACH- KREUZTAL PALENBERG BERGHEIM LAND- Das Landeswappen JÜLICH FRECHEN www.lvermgeo.rlp.de GRAAF BAES- KÖLN WEILER Nordrhein-Westfalen NIEDER- Die Wappenzeichen der ehemaligen drei Kur- trägt eine „Volkskrone“, eine goldene Krone LANDE ALSDORF HÜRTH SIEGEN KERPEN fürstentümer Trier, Mainz und Pfalz - Trierer aus Weinlaub, Symbol der Volkssouveräni- KERKRADE Rur RHEIN Erftkanal Kreuz, Mainzer Rad und Pfälzer Löwe - sind tät. 1948 bestimmte der Landtag die Farben HERZOGEN- Kirchen (Sieg) im Wappen des Landes lebendig geblieben. Schwarz-Rot-Gold, Symbol für Freiheit und RATH BRÜHL ESCHWEILER Das Trierer Wappen - rotes Kreuz auf weißem Einheit, zu den Farben der Landesfahne. An TROISDORF Wahn- ALTENKIRCHEN WÜRSELEN bach- Grund - und das Mainzer Wappen - weißes das Ringen um Freiheit und Einheit unter talsperre Sieg ERFTSTADT WESSE- Wissen (WW) Kirchen Rad auf rotem Grund - sind erstmals im 13. diesen Fahnen erinnert noch heute eine alte DÜREN LING SIEGBURG (Sieg) Betzdorf Jahrhundert nachzuweisen. Der rotgekrönte und verblichene schwarz-rot-goldene Fahne AACHEN SANKT Sieg und rotbewehrte goldene Löwe auf schwar- im Plenarsaal des Landtages. Sie wurde beim STOLBERG Hamm Wissen Betzdorf Herdorf AUGUSTIN HENNEF (Sieg) zem Grund war ursprünglich Wappentier der Hambacher Fest 1832 mitgeführt und soll -

Umgestaltung Der Ruhr in Witten Und Wetter
Umgestaltung der Ruhr in Witten und Wetter Renaturierung wozu? Auf den ersten Blick wirkt die Ruhr mit ihrer Aue bei Witten und Wetter wie eine intakte Landschaft. Auch die Wasserqualität ist viel besser als früher. Doch die Ruhr weist deutliche Defizite in ihrem öko- logischen Zustand und Gesamtbild auf. Die typischen Fischarten kommen dort nicht mehr vor oder müssen durch Besatz in ihrem Bestand gestützt werden. Eisvogel und Uferschwalbe fin- den kaum noch lehmige Steilufer. Hauptursache ist die künstliche Befestigung der Ufer mit massivem Steinmaterial. Sie steht einer eigendynamischen Ent- wicklung und der Ausbildung eines strukturreichen Gewässers mit Buchten und Nebenarmen entgegen. Im Zuge der Umsetzung der europäischen Wasser- rahmenrichtlinie soll in der Ruhr nicht nur sauberes Wasser fließen, sondern sie soll sich zu einem natur- nahen, artenreichen Fluss entwickeln. Zu diesem Zweck hat die Bezirksregierung Arnsberg für das Land Nordrhein-Westfalen große Teile der Aue erworben, so dass alle Planungen auf öffentlichen Flächen stattfin- den. In Bommern wurden dazu auch erste Maßnah- men des Ennepe-Ruhr-Kreises weiterentwickelt. Blick auf die Ruhraue vom Ortsteil Wengern der Stadt Wetter aus gesehen. Unerwünschte Spuren beseitigen Künstliche Befestigungen an den Ufern der Ruhr be- hindern sie vielerorts in ihrer freien Entwicklung. Damit der Fluss zu seiner natürlichen Gestalt zurückfinden kann, muss allerdings der Mensch eingreifen und seine eigenen Spuren beseitigen. Auf den ersten Blick widersprüchlich: Damit die Natur mehr Platz hat, muss sie zuerst weichen. Für die Renaturierung sind einige Baumaßnamen und Umgestaltungen erforderlich. Der Natur wieder Raum geben Die viele Arbeit lohnt sich: Seltene Arten, wie der Eisvogel oder die Uferschwalbe, finden an der "neuen" Ruhr wieder Lebensraum und Brutmöglichkeiten. -
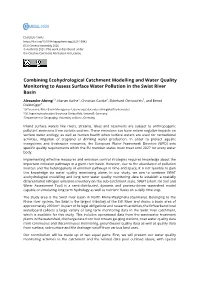
Combining Ecohydrological Catchment Modelling and Water Quality Monitoring to Assess Surface Water Pollution in the Swist River Basin
EGU2020-19842 https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-19842 EGU General Assembly 2020 © Author(s) 2021. This work is distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 License. Combining Ecohydrological Catchment Modelling and Water Quality Monitoring to Assess Surface Water Pollution in the Swist River Basin Alexander Ahring1,3, Marvin Kothe1, Christian Gattke1, Ekkehard Christoffels2, and Bernd Diekkrüger3 1Erftverband, River Basin Management, Germany ([email protected]) 2IBC Ingenieurtechnische Beratung Christoffels, Vettweiß, Germany 3Department of Geography, University of Bonn, Germany Inland surface waters like rivers, streams, lakes and reservoirs are subject to anthropogenic pollutant emissions from various sources. These emissions can have severe negative impacts on surface water ecology, as well as human health when surface waters are used for recreational activities, irrigation of cropland or drinking water production. In order to protect aquatic ecosystems and freshwater resources, the European Water Framework Directive (WFD) sets specific quality requirements which the EU member states must meet until 2027 for every water body. Implementing effective measures and emission control strategies requires knowledge about the important emission pathways in a given river basin. However, due to the abundance of pollution sources and the heterogeneity of emission pathways in time and space, it is not feasible to gain this knowledge via water quality monitoring alone. In our study, we aim to combine SWAT ecohydrological modelling and long term water quality monitoring data to establish a spatially differentiated nitrogen emission inventory on the sub-catchment scale. SWAT (short for Soil and Water Assessment Tool) is a semi-distributed, dynamic and process-driven watershed model capable of simulating long term hydrology as well as nutrient fluxes on a daily time step. -

Das Vorgebirge. Ein Beitrag Zur Rheinischen Landeskunde
Das Vorgebirge. Ein Beitrag zur rheinischen Landeskunde. Von Clotilde Ellscheid. Mit 6 Karten und Tafel IX u. X. Inhaltsbericht. Einführung: Lage, Abgrenzung und äußere Erscheinung Seite des G e b i e t e s ...............................................................................199—204 I. Teil: Die Natur der Landschaft........................................... 205—242 1 . Geologischer Bau, Oberflächenformen u. Boden 205 2. Das K lim a .......................................................... 222 8 . Die hydrologischen V e rh ä ltn isse.......... 228 4. Das Landschaftsbild im Wandel der Zeiten . 236 II. Teil: Die wirtschaftlichen V erhältnisse.......................... 242—276 1 . Die Nutzbarmachung der natürlichen Wasser vorräte .......................................................................... 242 2. Die W a ld w irtsch a ft..................................... 245 3. Die landwirtschaftlichen Verhältnisse. 248 a) Die Landwirtschaft am Osthang des Vor gebirges zwischen Bonn und Frechen . 248 b) Die Landwirtschaft auf der Hochfläche . 257 4. Die Industrie............................................................... 262 a) Der Eisenerzabbau als ausgestorbener Wirt schaftszweig. — Die Gewinnung und Ver wertung der B rau n k oh le.............. 262 b) Die Ausnutzung der Ton- und Sandlager 270 5. Der umgestaltende Einfluß der Industrie auf das Landschaftsbild.............................. 275 III. Teil: Die Verkehrswege........................................................ 276—280 IV. Teil: Zur Siedlungsgeographie -

Mittleres Ahrtal"1 Aus Naturkundlicher Sicht, Dargestellt Am Beispiel Des Naturschutzgebietes ,,Ahrschleife Bei Altenahr"
BEITRÄGE ZUR LANDESPFLEGE IN RHEINLAND-PFALZ 17 Das Naturschutzgebiet „Ahrschleife bei Altenahr" ( einschließlich angrenzender schutzwürdiger Bereiche) Fauna, Flora, Geologie und Landespflegeaspekte TeilII von WOLFGANGBÜCHS unter Mitarbeit von J. BECKER, T. BLICK, H.-J. HOFFMANN, J. C. KÜHLE, R. REMANE, V. SLEMBROUCK & W. WENDLING Herausgegeben vom Landesamt fürUmweltschutz und GewerbeaufsichtRheinland-Pfalz Oppenheim 2003 Beiträge Landespflege Rheinland-Pfalz 17 Seite 1-376 Oppenheim 2003 Verkauf nur durch das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz, Amtsgerichtsplatz 1, 55276 Oppenheim (zum Preise von 10,-Euro zzgl. Porto und Verpackungskosten) Einband: Hintergrund: Kartenaufnahme(ca. 1809) von Tranchot und von Von Müffling Abbildungen/Fotosund Bildautoren: oben links: Tunnel bei Altenahr. Lithographie von PONSART (1839). Repro aus Sammlung I. Görtz, Altenahr. oben rechts: Breite Lay,1989, Dr. Dr. Wolfgang Büchs (Braunschweig) unten links: Jugendherberge im Langfigtal,1989, Dr. Dr. Wolfgang Büchs (Braunschweig) unten Mitte: Hasenglöckchen (Hyacinthoides non-scripta), F. J.Fuchs,Mayschoß unten rechts: Raubwanzen-Art (Rhinocoris iracundus), Prof. Dr. E. Wachmann (Berlin) Einbandgestaltung: SOMMERDruck und Verlag Herausgeber: Landesamt fürUmweltschutz und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz,Am tsgerichtsplatz 1, 55276 Oppenheim Schriftleitung: Dr. Dr. Wolfgang Büchs (Braunschweig) Klaus Groh (Hackenheim) Dr. ManfredNiehuis (Albersweiler) Dr. Dieter Rühl (Oppenheim) Für die einzelnen Beiträge zeichnendie jeweiligen (Ko)autor(inn)en -

Satzung Für Die Sparkasse Gevelsberg-Wetter (Ruhr) – Zweckverbandssparkasse Der Städte Gevelsberg Und Wetter (Ruhr) Vom 01.06.2017
1.12 Satzung für die Sparkasse Gevelsberg-Wetter (Ruhr) – Zweckverbandssparkasse der Städte Gevelsberg und Wetter (Ruhr) vom 01.06.2017 Aufgrund des § 6 des Sparkassengesetzes Nordrhein-Westfalen (Sparkassen- gesetz – SpkG) vom 18. November 2008 in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Gevelsberg am 26. Januar 2017 - geändert durch Beschluss des Rates der Stadt Gevelsberg am 30. März 2017 - mit der Mehrheit der gesetzli- chen Anzahl der Ratsmitglieder folgende Neufassung der Satzung für die Stadtsparkasse Gevelsberg-Wetter (Ruhr) einstimmig beschlossen: § 1 Name und Sitz (1) Die Sparkasse Gevelsberg-Wetter (Ruhr) - Zweckverbandssparkasse der Städte Gevelsberg und Wetter (Ruhr) mit dem Sitz in Gevelsberg ist eine mündelsichere, dem gemeinen Nutzen dienende rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie führt ihre Geschäfte nach kaufmännischen Grundsätzen. Die Erzielung von Gewinn ist nicht Hauptzweck des Geschäftsbetriebes. (2) Im Geschäftsverkehr kann die Sparkasse die Kurzbezeichnung Sparkasse Ge- velsberg-Wetter führen. (3) Die Sparkasse ist Mitglied des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe, Münster. (4) Die Sparkasse führt das dieser Satzung beigedruckte Dienstsiegel. § 2 Träger Träger der Sparkasse ist der Sparkassenzweckverband der Städte Gevelsberg und Wetter (Ruhr). § 3 Organe Organe der Sparkasse sind der Verwaltungsrat und der Vorstand. § 4 Verwaltungsrat (1) Der Verwaltungsrat besteht aus a) dem vorsitzenden Mitglied, b) 10 weiteren sachkundigen Mitgliedern und Neufassung 2018 1 1.12 c) 2 Dienstkräften der Sparkasse. Für die Dauer der laufenden Kommunalwahlperiode bis 2020 erhöht sich die Zahl der weiteren Mitglieder nach Buchstabe b) auf 16 Mitglieder und nach Buchstabe c) auf 3 Dienstkräfte. (2) Die Ausgabe von Genussrechten, die Eingehung nachrangiger Verbindlichkeiten sowie die Aufnahme von Vermögenseinlagen stiller Gesellschafter und sonstiger haf- tender Eigenmittel bedürfen der Zustimmung des Verwaltungsrates.