Shoah: Intervention. Methods. Documentation. S:I.M.O.N
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Landeszentrale Für Politische Bildung Baden-Württemberg, Director: Lothar Frick 6Th Fully Revised Edition, Stuttgart 2008
BADEN-WÜRTTEMBERG A Portrait of the German Southwest 6th fully revised edition 2008 Publishing details Reinhold Weber and Iris Häuser (editors): Baden-Württemberg – A Portrait of the German Southwest, published by the Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, Director: Lothar Frick 6th fully revised edition, Stuttgart 2008. Stafflenbergstraße 38 Co-authors: 70184 Stuttgart Hans-Georg Wehling www.lpb-bw.de Dorothea Urban Please send orders to: Konrad Pflug Fax: +49 (0)711 / 164099-77 Oliver Turecek [email protected] Editorial deadline: 1 July, 2008 Design: Studio für Mediendesign, Rottenburg am Neckar, Many thanks to: www.8421medien.de Printed by: PFITZER Druck und Medien e. K., Renningen, www.pfitzer.de Landesvermessungsamt Title photo: Manfred Grohe, Kirchentellinsfurt Baden-Württemberg Translation: proverb oHG, Stuttgart, www.proverb.de EDITORIAL Baden-Württemberg is an international state – The publication is intended for a broad pub- in many respects: it has mutual political, lic: schoolchildren, trainees and students, em- economic and cultural ties to various regions ployed persons, people involved in society and around the world. Millions of guests visit our politics, visitors and guests to our state – in state every year – schoolchildren, students, short, for anyone interested in Baden-Würt- businessmen, scientists, journalists and numer- temberg looking for concise, reliable informa- ous tourists. A key job of the State Agency for tion on the southwest of Germany. Civic Education (Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, LpB) is to inform Our thanks go out to everyone who has made people about the history of as well as the poli- a special contribution to ensuring that this tics and society in Baden-Württemberg. -

Diplomarbeit
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Die Figuren des Helmut Qualtinger in der Tradition des Wiener Volksstücks“ Verfasser Elias Natmessnig angestrebter akademischer Grad Magister der Philosophie (Mag. phil) Wien, 2009 Studienkennzahl lt. A 317 Studienblatt: Studienrichtung lt. Theater- Film- und Medienwissenschaften Studienblatt: Betreuerin / Betreuer: Univ. Prof. Dr. Christian Schulte 1 2 Inhalt Inhalt........................................................................................................................................... 3 1) Einleitung............................................................................................................................... 7 2) Inspirationen der Jugend...................................................................................................... 10 3) Das Volksstück .................................................................................................................... 15 3.1) Das Wiener Volksstück................................................................................................. 18 3.1.1) Johann Nepomuk Nestroy...................................................................................... 19 3.1.2) Zwischen Nestroy und Kraus................................................................................. 22 3.1.3) Karl Kraus.............................................................................................................. 24 3.2) Die Erneuerer ............................................................................................................... -
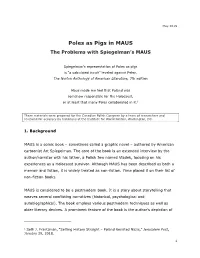
Poles As Pigs in MAUS the Problems with Spiegelman’S MAUS
May 2019 Poles as Pigs in MAUS The Problems with Spiegelman’s MAUS Spiegelman’s representation of Poles as pigs is “a calculated insult” leveled against Poles. The Norton Anthology of American Literature, 7th edition Maus made me feel that Poland was somehow responsible for the Holocaust, or at least that many Poles collaborated in it.1 These materials were prepared for the Canadian Polish Congress by a team of researchers and reviewed for accuracy by historians at the Institute for World Politics, Washington, DC. 1. Background MAUS is a comic book – sometimes called a graphic novel – authored by American cartoonist Art Spiegelman. The core of the book is an extended interview by the author/narrator with his father, a Polish Jew named Vladek, focusing on his experiences as a Holocaust survivor. Although MAUS has been described as both a memoir and fiction, it is widely treated as non-fiction. Time placed it on their list of non-fiction books. MAUS is considered to be a postmodern book. It is a story about storytelling that weaves several conflicting narratives (historical, psychological and autobiographical). The book employs various postmodern techniques as well as older literary devices. A prominent feature of the book is the author’s depiction of 1 Seth J. Frantzman, “Setting History Straight – Poland Resisted Nazis,” Jerusalem Post, January 29, 2018. 1 national groups in the form of different kinds of animals: Jews are drawn as mice, Germans as cats, and (Christian) Poles as pigs. MAUS has been taught widely in U.S. high schools, and even elementary schools, as part of the literature curriculum for many years. -

How They Lived to Tell 1939-1945 Edith Ruina
How They Lived to Tell 1939-1945 Together members of a Jewish youth group fled from Poland to Slovakia, Austria, Hungary, Romania and Palestine Edith Ruina Including selections from the written Recollection of Rut Judenherc, interviews and testimonies of other survivors. © Edith Ruina May 24, 2005 all rights reserved Printed in the United States of America Published 2005 Mixed Media Memoirs LLC Book design by Jason Davis [email protected] Green Bay,Wisconsin CONTENTS Acknowledgment ..............................................................................v Chapter 1 Introduction ......................................................................1 Chapter 2 1939-1942 ......................................................................9 1. The People in this Story 2. The Situation of Jews in Poland Chapter 3 1939-1942 Poland..........................................................55 Before and After the German Occupation Chapter 4 1943 Poland ..................................................................87 Many Perished—Few Escaped Chapter 5 1943-44 Austria............................................................123 Chapter 6 1944 Hungary..............................................................155 Surviving in Hungary Chapter 7 1944-1945 ..................................................................205 Romania en route to Palestine Chapter 8 Palestine ......................................................................219 They Lived to Tell v Chapter 9 ....................................................................................235 -

Whole Dissertation Hajkova 3
Abstract This dissertation explores the prisoner society in Terezín (Theresienstadt) ghetto, a transit ghetto in the Protectorate Bohemia and Moravia. Nazis deported here over 140, 000 Czech, German, Austrian, Dutch, Danish, Slovak, and Hungarian Jews. It was the only ghetto to last until the end of Second World War. A microhistorical approach reveals the dynamics of the inmate community, shedding light on broader issues of ethnicity, stratification, gender, and the political dimension of the “little people” shortly before they were killed. Rather than relegating Terezín to a footnote in narratives of the Holocaust or the Second World War, my work connects it to Central European, gender, and modern Jewish histories. A history of victims but also a study of an enforced Central European society in extremis, instead of defining them by the view of the perpetrators, this dissertation studies Terezín as an autarkic society. This approach is possible because the SS largely kept out of the ghetto. Terezín represents the largest sustained transnational encounter in the history of Central Europe, albeit an enforced one. Although the Nazis deported all the inmates on the basis of their alleged Jewishness, Terezín did not produce a common sense of Jewishness: the inmates were shaped by the countries they had considered home. Ethnicity defined culturally was a particularly salient means of differentiation. The dynamics connected to ethnic categorization and class formation allow a deeper understanding of cultural and national processes in Central and Western Europe in the twentieth century. The society in Terezín was simultaneously interconnected and stratified. There were no stark contradictions between the wealthy and majority of extremely poor prisoners. -

Zum Selbstverständnis Von Frauen Im Konzentrationslager. Das Lager Ravensbrück
Zum Selbstverständnis von Frauen im Konzentrationslager. Das Lager Ravensbrück. von der Fakultät I Geisteswissenschaften der Technischen Universität Berlin genehmigte Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktorin der Philosophie vorgelegt von Silke Schäfer aus Berlin D 83 Berichter: Prof. Dr. Wolfgang Benz Berichterin: Prof. Dr. Johanna Bleker (FUB) Tag der Wissenschaftlichen Aussprache 06. Februar 2002 1 Inhaltsverzeichnis Einleitung 4 1 Problemfelder und Nachkriegsprozesse 11 1.1 Begriffsklärung 11 1.1.1 Sprache 13 1.1.2 Das nationalsozialistische "Frauenbild" 14 1.1.3 Täterinnen 18 1.1.4 Kategorien für Frauen im Konzentrationslager 19 1.1.5 Auswahlkriterien 26 1.2 Strafverfolgung 28 1.2.1 Militärgerichtsverfahren 29 1.2.2 Die Hamburger Ravensbrück-Prozesse 32 1.2.3 Strafverfahren vor deutschen Gerichten 38 1.2.4 Strafverfahren vor anderen Gerichten 40 2 Topographie 42 2.1 Vorgeschichte 42 2.1.1 Moringen 42 2.1.2 Lichtenburg 45 2.2 Das Frauen-KZ Ravensbrück 47 2.2.1 "Alltagsleben" 52 2.2.2 Solidarität 59 2.3 Arbeit 62 2.3.1 Arbeitskommandos 63 2.3.2 Wirtschaftliche Ausbeutung 64 2.3.3 Lagerbordelle und SS-Bordelle 69 2.4 Aufseherinnen 75 2.4.1 Strafen 77 2.5 Lager bei Ravensbrück 80 2.5.1 Männerlager 81 2.5.2 Jugendschutzlager Uckermark 81 3 Die Medizin 86 3.1 Der Blick auf die Mediziner 86 3.1.1 Das Revier 87 3.2 Medizinische Experimente 89 3.2.1 Sulfonamidversuche / Knochen-, 91 Muskel- und Nervenoperation Sulfonamidversuche 93 Knochen-, Muskel- und Nervenoperation 104 Versuche 108 3.3 Sterilisation 110 3.3.1 Geburten und Kinder 115 3.4 Das medizinische Personal 123 3.4.1 NS-Ärztinnen - Lebensskizzen 125 Jantzen geb. -

Broschüre Lina Haag 2007
für Zivilcourage Lina Haag 2007 2. Dachau-Preis für Zivilcourage Preisträgerin 2005 Am 10. Dezember 2005, dem Tag der Menschenrechte, Maria Seidenberger hat die Stadt Dachau erstmals den Dachau-Preis für Zivilcourage verliehen, der in zweijährigem Turnus ausgelobt wird. Die erste Preisträgerin war die Zeitzeugin Maria Seidenberger. Mit dem Dachau-Preis Preisträgerin 2007 soll das Vermächtnis der Opfer der Konzentrationslager Lina Haag und des vielfältigen Widerstandes gegen das NS-Regime lebendig erhalten werden. Er orientiert sich an der Charta der Menschenrechte der Vereinten Nationen und an den Grundsätzen von Amnesty International. Mit diesem Preis sollen einzelne Personen oder Gruppen ausgezeichnet werden, die sich mit Mut, Phantasie und Medaille Engagement für die Rechte von Verfolgten und von „Dachau-Preis für diskriminierten Minderheiten einsetzen. Der Dachau- Zivilcourage“, gestaltet Preis soll Zivilcourage und Mitmenschlichkeit im für Zivilcourage von Heinz Eder Alltag auszeichnen. Die Trägerinnen und Träger des Dachau-Preises für Zivilcourage sollen durch ihr Handeln Aufforderung und Ansporn sein, couragiert gegen Ausgrenzung und Unterdrückung einzugreifen. Im Wissen um die Schreckensgeschichte, die mit dem Namen der Stadt Dachau verbunden wird, soll dieser Preis ein Zeichen setzen gegen das Wegsehen, das Schweigen, die Gleichgültigkeit. Die Jury des Dachau-Preises, die aus Dr. Sybille Krafft, Professor Hubertus von Pilgrim und Professor Dr. Wolfgang Benz besteht, hat gemeinsam mit dem Stadtrat der Stadt Dachau als Preisträgerin des Dachau- Preises 2007 die Zeitzeugin Lina Haag aus München benannt. 3 Laudatio auf Lina Haag Lina Haag, die im Januar ihren 102. Geburtstag feierte, gehalten Ich freue mich ungemein, hier das Wort ergreifen ist eine der letzten noch lebenden Widerstands- am 5. -

Vienna Bifold.Indd
Festivals February 21–March 16, 2014 Featuring the Vienna Philharmonic Orchestra and Vienna State Opera Music, Film, Art, Panel Discussions, and More Terry Linke Vienna Philharmonic Orchestra A glittering cultural jewel at the heart of Europe, Vienna has for centuries drawn artists, dreamers, and innovators from all corners of the continent to its dazzling intellectual and artistic life. With its famed art salons and co ee houses, Vienna supported a unique culture in which artists and scientists, fi rebrands and aesthetes, met and freely exchanged ideas. From this hothouse atmosphere emerged revolutionary breakthroughs in psychology, literature, art, and music, reverberating around Europe and indeed the world. Carnegie Hall salutes Vienna’s extraordinary artistic legacy with Vienna: City of Dreams, a three-week citywide festival that features symphonic and operatic masterpieces, chamber music, and lieder, as well as new sounds that are emerging from this historic cultural capital. The festival is bookended by seven concerts in Stern Auditorium / Perelman Stage by the renowned Vienna Philharmonic Orchestra and Vienna State Opera, led by esteemed conductors Franz Welser-Möst, Daniele Gatti, Andris Nelsons, and Zubin Mehta. The residency includes concert performances of both Alban Berg’s Wozzeck and Richard Strauss’s Salome, marking only the second time in their history that the Viennese musicians have performed opera in concert at Carnegie Hall. Other festival highlights include a Beethoven violin sonata cycle with Leonidas Kavakos and pianist Enrico Pace, Schubert’s great Die schöne Müllerin with baritone Matthias Goerne and pianist Christoph Eschenbach, a Discovery Day that focuses on Schubert’s fi nal years, and a Carnegie Hall–commissioned new work by Austrian composer Georg Friedrich Haas to be premiered by Ensemble ACJW. -

Patterns of Cooperation, Collaboration and Betrayal: Jews, Germans and Poles in Occupied Poland During World War II1
July 2008 Patterns of Cooperation, Collaboration and Betrayal: Jews, Germans and Poles in Occupied Poland during World War II1 Mark Paul Collaboration with the Germans in occupied Poland is a topic that has not been adequately explored by historians.2 Holocaust literature has dwelled almost exclusively on the conduct of Poles toward Jews and has often arrived at sweeping and unjustified conclusions. At the same time, with a few notable exceptions such as Isaiah Trunk3 and Raul Hilberg,4 whose findings confirmed what Hannah Arendt had written about 1 This is a much expanded work in progress which builds on a brief overview that appeared in the collective work The Story of Two Shtetls, Brańsk and Ejszyszki: An Overview of Polish-Jewish Relations in Northeastern Poland during World War II (Toronto and Chicago: The Polish Educational Foundation in North America, 1998), Part Two, 231–40. The examples cited are far from exhaustive and represent only a selection of documentary sources in the author’s possession. 2 Tadeusz Piotrowski has done some pioneering work in this area in his Poland’s Holocaust: Ethnic Strife, Collaboration with Occupying Forces, and Genocide in the Second Republic, 1918–1947 (Jefferson, North Carolina: McFarland, 1998). Chapters 3 and 4 of this important study deal with Jewish and Polish collaboration respectively. Piotrowski’s methodology, which looks at the behaviour of the various nationalities inhabiting interwar Poland, rather than focusing on just one of them of the isolation, provides context that is sorely lacking in other works. For an earlier treatment see Richard C. Lukas, The Forgotten Holocaust: The Poles under German Occupation, 1939–1944 (Lexington: The University Press of Kentucky, 1986), chapter 4. -

The Liquidation of the Sosnowiec Ghetto
The Liquidation of the Sosnowiec Ghetto The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 1 The Liquidation of the Sosnowiec Ghetto The Liquidation of the Sosnowiec Ghetto Slave Labour and Deportations In October 1939 Sosnowiec along with the Zaglebie region were incorporated into the German Third Reich with the plan of deporting the local Jews to the east and proclaiming the city “Judenrein” (Nazi © U. S.© U. Holocaust Memorial Museum term meaning “free of Jews”). The depor- tation however proved impossible as no other German administrator wanted to take responsibility for the 100 000 or so Jews of Zaglebie. Eventually in early 1940 ghettos were estab- lished in Sosnowiec, Bedzin and Dąbrowa. In late 1939, Sosnowiec had 23 000 Jewish inhabitants and was growing in numbers, Young women pose together in a vegetable garden in Sosnowiec. Lea Gleitman the second from the right hand side. becoming the central ghetto for Jews from Silesia and Zaglebie. To enable the workers of various factories and workshops to get to their work places, the ghetto was at first not sealed off. Those who could not find employment in the city were held in spe- cial camps known as “Dulags” to be used as slave labour in road construction or stone quarries. People started to disappear from the streets of Sosnowiec. This created a sense of fear and panic. -

Buch Von Der Kunst Der Nestbeschmutzung, 2009
Von der Kunst der Nestbeschmutzung Brigitte Lehmann, Doron Rabinovici, Sibylle Summer (Hg.) Von der Kunst der Nestbeschmutzung Dokumente gegen Ressentiment und Rassismus seit 1986 Gedruckt mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung (BMWF) sowie der Kulturabteilung der Stadt Wien (MA7), Wissenschafts- und Forschungsförderung. © Erhard Löcker GesmbH, Wien 2009 Herstellung: General Druckerei GmbH, Szeged ISBN 978-3-85409-496-8 Inhalt 9 Einleitung 12 Doron Rabinovici Aktion und Artikulation. Das Bestehen des Republikanischen Clubs 28 Kuno Knöbl Die Geschichte des Waldheim-Holzpferdes 32 Hagen Fleischer Erinnerungen an die »Causa W.« 41 Sibylle Summer und Kuno Knöbel Gespräch über einen Namen 45 Alexander Emanuely Die gedichtete Revolution des Franz Hebenstreit 54 Sibylle Summer und Mary Steinhauser Gespräch überWaldheim und die Folgen 59 Heidemarie Uhl Abschied von der Opferthese 63 Brigitte Bailer-Galanda Die Thematisierung des Widerstandes gegen das NS-Regime in Zeitgeschichte und Publizistik seit der Waldheimdebatte 70 Robert Knight »Waldheim revisited«: Historisierung, Hysterie und Schulterschluss 85 Andreas Wabl Das Unfassbare fassbar machen 88 Sophie Lillie Rückblick auf zwanzig Jahre Kunstrestitution 95 Peter Kreisky »Neues Österreich« – Ein Einblick 137 Kurt Rothschild Geht’s den (Super-)Reichen gut, geht’s den Armen schlecht 144 Heide Schmidt Verachtet mir die Politik nicht 150 Udo Jesionek Justizpolitik im politischen Kontext 161 Isolde Charim Hellers Mantel 165 Di-Tutu Bukasa Antirassismus -

Masterarbeit / Master's Thesis
MASTERARBEIT / MASTER’S THESIS Titel der Masterarbeit / Title of the Master’s Thesis „Sprachbasierte Indexikalität und ihre Funktion in Wiener Kabarett-Texten der 1950er und 1960er Jahre. Eine soziolin- guistische Analyse.“ verfasst von / submitted by Johanna Prokopp, BA angestrebter akademischer Grad / in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts (MA) Wien, 2017 / Vienna 2017 Studienkennzahl lt. Studienblatt / degree pro- A 066 818 gramme code as it appears on the student record sheet: Studienrichtung lt. Studienblatt / degree pro- Austrian Studies gramme as it appears on the student record sheet: Betreut von / Supervisor: Mag. Dr. Manfred Glauninger, Privatdoz. Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 1.1 Gegenstand, Problemstellung, Zielsetzung 1 1.2 Aufbau, Methode 1 1.3 Forschungsstand 6 2 Kabarett 7 2.1 Definition 7 2.2 Entstehung des Kabaretts 8 2.3 Entwicklung des Kabaretts 10 2.4 Literarische Anfänge in Wien 10 2.4.1 (Anfänge und) Erste Erfolge in Wien 11 2.4.2 „Simpl“ 12 2.5 Politisch-literarisches Kabarett in Wien in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts 13 2.5.1 „Lieber Augustin“ 13 2.5.2 „Die Stachelbeere“ 14 2.5.3 „Literatur am Naschmarkt“ 14 2.5.4 „ABC“ 15 2.5.5 „Wiener Werkel“ 15 2.6 Politisch-satirisches Kabarett in Wien nach 1945 17 2.7 Das „Kabarett ohne Namen“/„Namenlose Ensemble“ 18 2.7.1 Geschichtliche Einordnung 18 2.7.2 Die Autoren 19 2.7.2.1 Gerhard Bronner 19 2.7.2.2 Michael Kehlmann 20 2.7.2.3 Georg Kreisler 20 2.7.2.4 Carl Merz 21 2.7.2.5 Helmut Qualtinger 21 2.7.2.6 Peter Wehle 22 2.7.3 Entstehung des „Kabaretts ohne Namen“/„Namenlosen Ensembles“ 22 2.7.4 Kabarettprogramme (1952–1961) 23 2.7.5 Zeitungskolumne „Blattl vorm Mund“ 25 2.7.6 Kabaretttexte (1952–1961) 26 2.7.6.1 „Brettl vor dem Kopf“ 26 2.7.6.2 „Blattl vorm Mund“ 28 2.7.6.3 „Glasl vorm Aug“ 29 2.7.6.4 „Spiegel vorm Gesicht“ 30 2.7.6.5 „Dachl überm Kopf“ 31 2.7.6.6 „Hackl vorm Kreuz“ 32 3 Theoretischer Rahmen 34 3.1 Definitionen 34 3.1.1 Standarddeutsch/Nonstandarddeutsch/Literatursprache 34 3.1.2 Geschriebene vs.