Diplomarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Vienna Bifold.Indd
Festivals February 21–March 16, 2014 Featuring the Vienna Philharmonic Orchestra and Vienna State Opera Music, Film, Art, Panel Discussions, and More Terry Linke Vienna Philharmonic Orchestra A glittering cultural jewel at the heart of Europe, Vienna has for centuries drawn artists, dreamers, and innovators from all corners of the continent to its dazzling intellectual and artistic life. With its famed art salons and co ee houses, Vienna supported a unique culture in which artists and scientists, fi rebrands and aesthetes, met and freely exchanged ideas. From this hothouse atmosphere emerged revolutionary breakthroughs in psychology, literature, art, and music, reverberating around Europe and indeed the world. Carnegie Hall salutes Vienna’s extraordinary artistic legacy with Vienna: City of Dreams, a three-week citywide festival that features symphonic and operatic masterpieces, chamber music, and lieder, as well as new sounds that are emerging from this historic cultural capital. The festival is bookended by seven concerts in Stern Auditorium / Perelman Stage by the renowned Vienna Philharmonic Orchestra and Vienna State Opera, led by esteemed conductors Franz Welser-Möst, Daniele Gatti, Andris Nelsons, and Zubin Mehta. The residency includes concert performances of both Alban Berg’s Wozzeck and Richard Strauss’s Salome, marking only the second time in their history that the Viennese musicians have performed opera in concert at Carnegie Hall. Other festival highlights include a Beethoven violin sonata cycle with Leonidas Kavakos and pianist Enrico Pace, Schubert’s great Die schöne Müllerin with baritone Matthias Goerne and pianist Christoph Eschenbach, a Discovery Day that focuses on Schubert’s fi nal years, and a Carnegie Hall–commissioned new work by Austrian composer Georg Friedrich Haas to be premiered by Ensemble ACJW. -

The Waldheim Phenomenon in Austria
Demokratiezentrum Wien Onlinequelle: www.demokratiezentrum.org Printquelle: Mitten, Richard: The Politics of the Antisemitic Prejudice. The Waldheim Phenomenon in Austria. Westview Press, Boulder, Colorado 1992 (Chapter 1 and 8) Richard Mitten THE POLITICS OF ANTISEMITIC PREJUDICE : THE WALDHEIM PHENOMENON IN AUSTRIA Table of Contents: Acknowledgments Chapter One: Introduction: “Homo austriacus” agonistes Chapter Two: Austria Past and Present Chapter Three: From Election Catatonia to the “Waldheim Affair” Chapter Four: “What did you do in the war, Kurt?” Chapter Five: Dis“kurt”esies: Waldheim and the Language of Guilt Chapter Six: The Role of the World Jewish Congress Chapter Seven: The Waldheim Affair in the United States Chapter Eight: The “Campaign” against Waldheim and the Emergence of the Feindbild Chapter Nine: When “The Past” Catches Up 1 Autor/Autorin: Richard Mitten • The Campaign against Waldheim and the Emergence of the Feindbild Printquelle: Mitten, Richard: The Politics of the Antisemitic Prejudice. The Waldheim Phenomenon in Austria. Westview Press, Boulder, Colorado 1992 (Chapter 1 and 8) • Onlinequelle: www.demokratiezentrum.org Demokratiezentrum Wien Onlinequelle: www.demokratiezentrum.org Printquelle: Mitten, Richard: The Politics of the Antisemitic Prejudice. The Waldheim Phenomenon in Austria. Westview Press, Boulder, Colorado 1992 (Chapter 1 and 8) Introduction: “Homo austriacus” agonistes Gaiety, a clear conscience, the happy deed, the confidence in the future---all these depend, for the individual as well as for a people, on there being a line that separates the forseeable, the light, from the unilluminable and the darkness; on one’s knowing just when to forget, when to remember; on one’s instinctively feeling when necessary to perceive historically, when unhistorically. -

Buch Von Der Kunst Der Nestbeschmutzung, 2009
Von der Kunst der Nestbeschmutzung Brigitte Lehmann, Doron Rabinovici, Sibylle Summer (Hg.) Von der Kunst der Nestbeschmutzung Dokumente gegen Ressentiment und Rassismus seit 1986 Gedruckt mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung (BMWF) sowie der Kulturabteilung der Stadt Wien (MA7), Wissenschafts- und Forschungsförderung. © Erhard Löcker GesmbH, Wien 2009 Herstellung: General Druckerei GmbH, Szeged ISBN 978-3-85409-496-8 Inhalt 9 Einleitung 12 Doron Rabinovici Aktion und Artikulation. Das Bestehen des Republikanischen Clubs 28 Kuno Knöbl Die Geschichte des Waldheim-Holzpferdes 32 Hagen Fleischer Erinnerungen an die »Causa W.« 41 Sibylle Summer und Kuno Knöbel Gespräch über einen Namen 45 Alexander Emanuely Die gedichtete Revolution des Franz Hebenstreit 54 Sibylle Summer und Mary Steinhauser Gespräch überWaldheim und die Folgen 59 Heidemarie Uhl Abschied von der Opferthese 63 Brigitte Bailer-Galanda Die Thematisierung des Widerstandes gegen das NS-Regime in Zeitgeschichte und Publizistik seit der Waldheimdebatte 70 Robert Knight »Waldheim revisited«: Historisierung, Hysterie und Schulterschluss 85 Andreas Wabl Das Unfassbare fassbar machen 88 Sophie Lillie Rückblick auf zwanzig Jahre Kunstrestitution 95 Peter Kreisky »Neues Österreich« – Ein Einblick 137 Kurt Rothschild Geht’s den (Super-)Reichen gut, geht’s den Armen schlecht 144 Heide Schmidt Verachtet mir die Politik nicht 150 Udo Jesionek Justizpolitik im politischen Kontext 161 Isolde Charim Hellers Mantel 165 Di-Tutu Bukasa Antirassismus -

Masterarbeit / Master's Thesis
MASTERARBEIT / MASTER’S THESIS Titel der Masterarbeit / Title of the Master’s Thesis „Sprachbasierte Indexikalität und ihre Funktion in Wiener Kabarett-Texten der 1950er und 1960er Jahre. Eine soziolin- guistische Analyse.“ verfasst von / submitted by Johanna Prokopp, BA angestrebter akademischer Grad / in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts (MA) Wien, 2017 / Vienna 2017 Studienkennzahl lt. Studienblatt / degree pro- A 066 818 gramme code as it appears on the student record sheet: Studienrichtung lt. Studienblatt / degree pro- Austrian Studies gramme as it appears on the student record sheet: Betreut von / Supervisor: Mag. Dr. Manfred Glauninger, Privatdoz. Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 1.1 Gegenstand, Problemstellung, Zielsetzung 1 1.2 Aufbau, Methode 1 1.3 Forschungsstand 6 2 Kabarett 7 2.1 Definition 7 2.2 Entstehung des Kabaretts 8 2.3 Entwicklung des Kabaretts 10 2.4 Literarische Anfänge in Wien 10 2.4.1 (Anfänge und) Erste Erfolge in Wien 11 2.4.2 „Simpl“ 12 2.5 Politisch-literarisches Kabarett in Wien in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts 13 2.5.1 „Lieber Augustin“ 13 2.5.2 „Die Stachelbeere“ 14 2.5.3 „Literatur am Naschmarkt“ 14 2.5.4 „ABC“ 15 2.5.5 „Wiener Werkel“ 15 2.6 Politisch-satirisches Kabarett in Wien nach 1945 17 2.7 Das „Kabarett ohne Namen“/„Namenlose Ensemble“ 18 2.7.1 Geschichtliche Einordnung 18 2.7.2 Die Autoren 19 2.7.2.1 Gerhard Bronner 19 2.7.2.2 Michael Kehlmann 20 2.7.2.3 Georg Kreisler 20 2.7.2.4 Carl Merz 21 2.7.2.5 Helmut Qualtinger 21 2.7.2.6 Peter Wehle 22 2.7.3 Entstehung des „Kabaretts ohne Namen“/„Namenlosen Ensembles“ 22 2.7.4 Kabarettprogramme (1952–1961) 23 2.7.5 Zeitungskolumne „Blattl vorm Mund“ 25 2.7.6 Kabaretttexte (1952–1961) 26 2.7.6.1 „Brettl vor dem Kopf“ 26 2.7.6.2 „Blattl vorm Mund“ 28 2.7.6.3 „Glasl vorm Aug“ 29 2.7.6.4 „Spiegel vorm Gesicht“ 30 2.7.6.5 „Dachl überm Kopf“ 31 2.7.6.6 „Hackl vorm Kreuz“ 32 3 Theoretischer Rahmen 34 3.1 Definitionen 34 3.1.1 Standarddeutsch/Nonstandarddeutsch/Literatursprache 34 3.1.2 Geschriebene vs. -
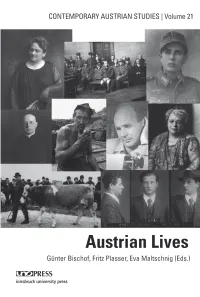
CAS21 for Birgit-No Marks
Austrian Lives Günter Bischof, Fritz Plasser, Eva Maltschnig (Eds.) CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | Volume 21 innsbruck university press Copyright ©2012 by University of New Orleans Press, New Orleans, Louisiana, USA. All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All inquiries should be addressed to UNO Press, University of New Orleans, LA 138, 2000 Lakeshore Drive, New Orleans, LA, 70119, USA. www.unopress.org. Printed in the United States of America. Book and cover design: Lauren Capone Cover photo credits given on the following pages: 33, 72, 119, 148, 191, 311, 336, 370, 397 Published in the United States by Published and distributed in Europe University of New Orleans Press: by Innsbruck University Press: ISBN: 9781608010929 ISBN: 9783902811615 Contemporary Austrian Studies Sponsored by the University of New Orleans and Universität Innsbruck Editors Günter Bischof, CenterAustria, University of New Orleans Fritz Plasser, Universität Innsbruck Production Editor Copy Editor Bill Lavender Lauren Capone University of New Orleans University of New Orleans Executive Editors Klaus Frantz, Universität Innsbruck Susan Krantz, University of New Orleans Advisory Board Siegfried Beer Sándor Kurtán Universität Graz Corvinus University Budapest Peter Berger Günther Pallaver -

The Research Project ‘Cold War Discourses
ILCEA Revue de l’Institut des langues et cultures d'Europe, Amérique, Afrique, Asie et Australie 16 | 2012 La culture progressiste à l’époque de la guerre froide The Research Project ‘Cold War Discourses. Political Configurations and their Contexts in Austrian Literature between 1945 and 1966’ Das Forschungsprojekt ‚Diskurse des Kalten Krieges. Politische Konfigurationen und deren Kontexte in österrreichischer Literatur zwischen 1945 und 1966’ Stefan Maurer and Doris Neumann-Rieser Electronic version URL: http://journals.openedition.org/ilcea/1451 DOI: 10.4000/ilcea.1451 ISSN: 2101-0609 Publisher UGA Éditions/Université Grenoble Alpes Printed version ISBN: 978-2-84310-232-5 ISSN: 1639-6073 Electronic reference Stefan Maurer and Doris Neumann-Rieser, “The Research Project ‘Cold War Discourses. Political Configurations and their Contexts in Austrian Literature between 1945 and 1966’”, ILCEA [Online], 16 | 2012, Online since 04 July 2012, connection on 22 March 2021. URL: http://journals.openedition.org/ ilcea/1451 ; DOI: https://doi.org/10.4000/ilcea.1451 This text was automatically generated on 22 March 2021. © ILCEA The Research Project ‘Cold War Discourses. Political Configurations and their... 1 The Research Project ‘Cold War Discourses. Political Configurations and their Contexts in Austrian Literature between 1945 and 1966’ Das Forschungsprojekt ‚Diskurse des Kalten Krieges. Politische Konfigurationen und deren Kontexte in österrreichischer Literatur zwischen 1945 und 1966’ Stefan Maurer and Doris Neumann-Rieser 1 The Research Project -

Austrian Lives
Austrian Lives Günter Bischof, Fritz Plasser, Eva Maltschnig (Eds.) CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | Volume 21 innsbruck university press Copyright ©2012 by University of New Orleans Press, New Orleans, Louisiana, USA. All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All inquiries should be addressed to UNO Press, University of New Orleans, LA 138, 2000 Lakeshore Drive, New Orleans, LA, 70119, USA. www.unopress.org. Printed in the United States of America. Book and cover design: Lauren Capone Cover photo credits given on the following pages: 33, 72, 119, 148, 191, 311, 336, 370, 397 Published in the United States by Published and distributed in Europe University of New Orleans Press: by Innsbruck University Press: ISBN: 9781608010929 ISBN: 9783902811615 Contemporary Austrian Studies Sponsored by the University of New Orleans and Universität Innsbruck Editors Günter Bischof, CenterAustria, University of New Orleans Fritz Plasser, Universität Innsbruck Production Editor Copy Editor Bill Lavender Lauren Capone University of New Orleans University of New Orleans Executive Editors Klaus Frantz, Universität Innsbruck Susan Krantz, University of New Orleans Advisory Board Siegfried Beer Sándor Kurtán Universität Graz Corvinus University Budapest Peter Berger Günther Pallaver -

The Jewish Cemeteries in Vienna
‘The Place of my Fathers’ Sepulchres’: The Jewish Cemeteries in Vienna Image removed from electronic version for copyright reasons – TC Tim Corbett ‘The Place of my Fathers’ Sepulchres’: The Jewish Cemeteries in Vienna A dissertation submitted in partial fulfilment of the degree of PhD by Tim Corbett, B.A. (Hons), M.A. (University of Lancaster) University of Lancaster, June 2015 Declaration I certify that this thesis is my own work, and has not been submitted in substantially the same form for the award of a higher degree elsewhere. Frontispiece: (from left to right and top to bottom) untitled, former exhibition of the Jewish Museum in Vienna (before 1938), JMW, 2628; matzevah of Francisca Edle von Hönigsberg (1769-1795), Währing, 4-385; Grabsteine beim Hofburgbau, CAHJP, AU-196; Detail from Wiener Zentralfriedhof, 1953, ÖNB Kartensammlung, KI 104092; matzevah of Joachim Stiasny (1826-1908), Tor I, 52A-12-20; Fotosammlung ’the city, the place of my fathers) הָעִ יר בֵּ ית-קִ בְ רוֹת אֲ בֹתַ י ;Seegasse, JMW, 3217 sepulchres), Nehemiah 2:3; matzevah of Rabbi Shimshon (Samson) Wertheim(er) (1658-1724), Seegasse; matzevah of Karl Kohn (1889-1914), Tor I, 76B-1-1; matzevot at Tor I, Section 5B; matzevah of Chief Rabbi Adolf Jellinek (1820-1893), Tor I, 5B-1-2; matzevah of Marcus Engel (1825-1909) and family, Tor I, 7-1-11; matzevah of Emanuel Weber (1851-1906), Tor I, 51-17-69; Wien 11, Zentralfriedhof 4. Tor, ÖNB Bildarchiv, HW 58, 8. ii Acknowledgements This thesis is the culmination of five years of postgraduate work, and five years of my life that have taken me literally around the world. -

Holocaust Memory for the Millennium
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Royal Holloway - Pure HHoollooccaauusstt MMeemmoorryy ffoorr tthhee MMiilllleennnniiuumm LLaarriissssaa FFaayyee AAllllwwoorrkk Royal Holloway, University of London Submission for the Examination of PhD History 1 I Larissa Allwork, hereby declare that this thesis and the work presented in it is entirely my own. Where I have consulted the work of others, this is always clearly stated. Signed: L.F. Allwork Date: 15/09/2011 2 Abstract Holocaust Memory for the Millennium fills a significant gap in existing Anglophone case studies on the political, institutional and social construction of the collective memory of the Holocaust since 1945 by critically analyzing the causes, consequences and ‘cosmopolitan’ intellectual and institutional context for understanding the Stockholm International Forum on Holocaust Education, Remembrance and Research (26 th January-28 th January 2000). This conference was a global event, with ambassadors from 46 nations present and attempted to mark a defining moment in the inter-cultural construction of the political and institutional memory of the Holocaust in the United States of America, Western Europe, Eastern Europe and Israel. This analysis is based on primary documentation from the London (1997) and Washington (1998) restitution conferences; Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research primary sources; speeches and presentations made at the Stockholm International Forum 2000; oral history interviews with a cross-section of British delegates to the conference; contemporary press reports, as well as pre-existing scholarly literature on the history, social remembrance and political and philosophical implications of the perpetration of the Holocaust and genocides. -
Vol. Xxiv/Xxv (2018/2019) No 31–32
THE INTERNATIONAL NEWSLETTER OF COMMUNIST STUDIES Der Internationale Newsletter der Kommunismusforschung La newsletter internationale des recherches sur le communisme Международный бюллетень исторических исследований коммунизма La Newsletter Internacional de Estudios sobre el Comunismo A Newsletter Internacional de Estudos sobre o Comunismo Edited by Bernhard H. Bayerlein and Gleb J. Albert VOL. XXIV/XXV (2018/2019) NO 31–32 Published by The European Workshop of Communist Studies With Support of the Institute of Social Movements and the Library of the Ruhr University Bochum ISSN 1862-698X http://incs.ub.rub.de The International Newsletter of Communist Studies XXIV/XXV (2018/19), nos. 31-32 2 Editors Bernhard H. Bayerlein Institute of Social Movements (ISB), University of Bochum, Germany [email protected] / [email protected] Gleb J. Albert Department of History, University of Zurich [email protected] Board of Correspondents Lars Björlin (Stockholm) Ottokar Luban (Berlin) Kasper Braskén (Åbo) Kevin McDermott (Sheffield) Hernán Camarero (Buenos Aires) Brendan McGeever (London) Cosroe Chaqueri † (Paris) Kevin Morgan (Manchester) Sonia Combe (Paris) Timur Mukhamatulin (New Brunswick) Mathieu Denis (Paris/Montréal) Manfred Mugrauer (Wien) Jean-François Fayet (Fribourg) Maria Luisa Nabinger (Rio de Janeiro) Jan Foitzik (Berlin) José Pacheco Pereira (Lisbon) Daniel Gaido (Córdoba, Argentina) Fredrik Petersson (Åbo/Stockholm) José Gotovitch (Bruxelles) Adriana Petra (Buenos Aires) Sobhanlal Datta Gupta (Calcutta) Kimmo Rentola -

Dissertation
DISSERTATION Titel der Dissertation HAROLD PINTER IN GERMAN: WHAT'S LOST IN TRANSLATION? Verfasserin RENÉE VON PASCHEN, M.A. angestrebter akademischer Grad Doktorin der Philosophie (Dr. phil.) Wien, 2012 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 092 317 Dissertationsgebiet lt. Studienblatt: Theater-, Film- und Medienwissenschaft Betreuerin: Univ.-Prof. Dr. Brigitte Marschall 2 2 3 ABSTRACT 7 ZUSAMMENFASSUNG 9 FOREWORD 11 INTRODUCTION 12 1 HAROLD PINTER'S BACKGROUND AS A WRITER 16 1.1 HAROLD PINTER'S BIOGRAPHY 16 1.1.1 PINTER'S CHILDHOOD YEARS 17 1.1.2 PINTER'S ACTING AND DIRECTING CAREER 19 1.1.2.1 Pinter's Acting Career in the Theater ..............................................................................26 1.1.2.2 Pinter's Acting Career and Roles in Cinema...................................................................26 1.1.2.3 Television Films and Roles in Which Pinter Acted........................................................27 1.1.2.4 Radio Broadcasts in Which Pinter Played a Role ...........................................................28 1.1.2.5 Plays Pinter Directed on Stage........................................................................................28 1.1.2.6 Movies and Television Films Directed by Pinter............................................................29 1.1.3 PINTER'S POLITICAL ENGAGEMENT 30 1.1.4 PINTER'S OEUVRE AS A WRITER 35 1.1.4.1 Plays by Pinter.................................................................................................................35 1.1.4.2 Prose and Poetry by -

QUASI JEDERMANN Helmut Qualtinger, Der Menschenimitator Mit Texten Von Carl Merz Und Helmut Qualtinger Musik Von Wiener Blond
MATERIALMAPPE QUASI JEDERMANN Helmut Qualtinger, der Menschenimitator Mit Texten von Carl Merz und Helmut Qualtinger Musik von Wiener Blond Ansprechperson für weitere Informationen Mag.ᵃ Julia Perschon | Theatervermittlung T +43 2742 90 80 60 694 | M +43 664 604 99 694 [email protected] | www.landestheater.net INHALTSVERZEICHNIS VORWORT 1. ZUR PRODUKTION ……………………………………………………….... 4 2. EINE HOMMAGE AN HELMUTQUALTINGER……………………………… 5 3. HELMUT QUALTINGER – BIOGRAFIE ……………………………………. 6 4. PROGRAMM QUASI JEDERMANN ………………………………………... 7 5. TEXTAUSZUG „DER HERR KARL“…………………….……………………. 8 6. ENTSTEHUNG UND INHALT VON „DER HERR KARL“ …………………. 9 7. HISTORISCHE EREIGNISSE UND PERSONEN BEI „DER HERR KARL“ 12 8. SONG AUS QUASI JEDERMANN ………………………………………… 15 9. IMPULSTEXT 1 – INTERVIEW MIT PETER TURRINI ………………… 16 10. IMPULSTEXT 2 – ÖSTERREICHS GESICHT ……………………….... 18 11. NACH DEM THEATERBESUCH ………………………………………... 19 2 VORWORT Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, liebe Besucherinnen und Besucher, bis heute gilt Helmut Qualtinger als die Verkörperung der österreichischen Seele. Sein Wiener Schmäh, dessen sprachliche Wurzeln bis zu Ödön von Horváth, Karl Kraus und Johann Nepomuk Nestroy reichen, sorgte für Begeisterungsstürme bei seinem Publikum. Helmut Qualtinger, den das ganze Land liebevoll den „Quasi“ nannte, war ein Stachel im Fleisch der spießbürgerlichen Nachkriegszeit. Witz und bitterböser Tiefsinn, treffsichere Pointe und Verzweiflung an den herrschenden Zuständen lagen bei ihm nah beieinander. Mit dem Monolog „Der Herr Karl“ von 1961 setzten Qualtinger und Carl Merz dem typischen Mitläufer und gesinnungslosen Opportunisten ein literarisches Denkmal. „Der Herr Karl“ löste eine nationale Kontroverse aus und wurde, weit über die österreichischen Grenzen hinaus, zur Kultfigur. „Quasi Jedermann“ ist eine musikalische Hommage an den Schriftsteller, Schauspieler, Kabarettisten und unvergleichlichen „Menschenimitator“, wie Helmut Qualtinger sich selbst bezeichnete.