2. Herkunft Und Ausbildung
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Friedrich Schauta (1849-1919) Lehrer Und Konkurrent Von Ernst Wertheim
1844 2019 Friedrich Schauta (1849-1919) Lehrer und Konkurrent von Ernst Wertheim Erinnerung anlässlich seines 100. Todestages Andreas D. Ebert Praxis für Frauengesundheit, Gynäkologie und Geburtshilfe Nürnberger Str. 67, 10787 Berlin | www.prof-ebert.de Sitzung der Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe zu Berlin vom 16. Januar 2019 Friedrich Schauta Friedrich Schauta Die Lehrer Ernst Wilhelm von Brücke (1819-1892) Johann Heinrich Freiherr Dumreicher von Österreicher (1815-1880) Josef Späth (1823-1896) Friedrich Schauta Leopold Franzens Universität Innsbruck • 1881 wurde er habilitiert und kurze Zeit später als „supplierender Professor“ für Geburtshilfe und Gynäkologie nach Innsbruck berufen. • 1884 erfolgte die Ernennung zum ordentlichen Professor an der dortigen Franzens-Universität. • Aus seiner Innsbrucker Zeit bleibt in erster Linie sein „Grundriss der operativen Geburtshilfe“ in Erinnerung, der 1885 in 1. Auflage erschienen. Friedrich Schauta Deutsche Karls- Universität Prag • 1887 wurde Friedrich Schauta als Nachfolger August Breiskys (1832- 1889) an die deutsche Karls- Universität Prag berufen. • Hier erschien 1891 u. a. die Darstellung der Extrauteringravidität, in der Schauta zum ersten Mal die Bedeutung der operativen Behandlung der Eileiterschwangerschaft betonte Friedrich Schauta Universität Wien • 1891 erfolgte die Berufung nach Wien an die I. geburtshilflich-gynäkologische Universitätsklinik, wo er Nachfolger Karl Ritter Braun von Fernwalds (1822-1891) wurde. • Diese Klinik leitet er über 20 Jahre lang. „Immer gleich -

MEDICINAL PLANTS OPIUM POPPY: BOTANY, TEA: CULTIVATION to of NORTH AFRICA Opidjd CHEMISTRY and CONSUMPTION by Loutfy Boulos
hv'IERIGAN BCXtlNICAL COJNCIL -----New Act(uisition~---------l ETHNOBOTANY FLORA OF LOUISIANA Jllll!llll GUIDE TO FLOWERING FLORA Ed. by Richard E. Schultes and Siri of by Margaret Stones. 1991. Over PLANT FAMILIES von Reis. 1995. Evolution of o LOUISIANA 200 beautiful full color watercolors by Wendy Zomlefer. 1994. 130 discipline. Thirty-six chapters from and b/w illustrations. Each pointing temperate to tropical families contributors who present o tru~ accompanied by description, habitat, common to the U.S. with 158 globol perspective on the theory and and growing conditions. Hardcover, plates depicting intricate practice of todoy's ethnobotony. 220 pp. $45. #8127 of 312 species. Extensive Hardcover, 416 pp. $49.95. #8126 glossary. Hardcover, 430 pp. $55. #8128 FOLK MEDICINE MUSHROOMS: TAXOL 4t SCIENCE Ed. by Richard Steiner. 1986. POISONS AND PANACEAS AND APPLICATIONS Examines medicinal practices of by Denis Benjamin. 1995. Discusses Ed. by Matthew Suffness. 1995. TAXQL® Aztecs and Zunis. Folk medicine Folk Medicine signs, symptoms, and treatment of Covers the discovery and from Indio, Fup, Papua New Guinea, poisoning. Full color photographic development of Toxol, supp~. Science and Australia, and Africa. Active identification. Health and nutritional biology (including biosynthesis and ingredients of garlic and ginseng. aspects of different species. biopharmoceutics), chemistry From American Chemical Society Softcover, 422 pp. $34.95 . #8130 (including structure, detection and Symposium. Softcover, isolation), and clinical studies. 223 pp. $16.95. #8129 Hardcover, 426 pp. $129.95 #8142 MEDICINAL PLANTS OPIUM POPPY: BOTANY, TEA: CULTIVATION TO OF NORTH AFRICA OpiDJD CHEMISTRY AND CONSUMPTION by Loutfy Boulos. 1983. Authoritative, Poppy PHARMACOLOGY TEA Ed. -

Albrecht Von Graefe – Ein Portrait Berliner Armenaugenarzt Und Begründer Der Modernen Augenheilkunde Von Wolfgang Hanuschik
Aktuell Albrecht von Graefe – ein Portrait Berliner Armenaugenarzt und Begründer der modernen Augenheilkunde von Wolfgang Hanuschik Albrecht von Graefe wurde am 22. Mai Die Villa Finkenherd war ein gesellschaft- Bereits mit 15 Jahren besuchte A. von 1828 im sogenannten „Finkenherd“, licher Treffpunkt der Stadt. Künstler wie Graefe die Berliner Universität, an der er dem Sommersitz der Familie von Graefe A. von Camisso, die Portraitmalerin Ca- Mathematik, Naturwissenschaften, Philo- im Berliner Tiergarten und heutigen Han- roline Bardua und der Bildhauer Christian sophie und schließlich vor allem Medizin saviertel, geboren und starb am 20. Juli D. Rauch trafen sich mit Freunden von A. studierte. Dabei wurde er von Koryphäen 1870 in Berlin an Tuberkulose. Sein Vater von Graefe und seinen Schwestern Wan- wie Johannes Müller (Physiologie), Jo- war Karl Friedrich Ferdinand von Graefe, da und Ottilie. Von Graefe gründete dort hannes Dieffenbach (Innere Medizin) und der angesehene erste Direktor der chirur- die „Kamelia“, eine Art nicht schlagen- Rudolf Virchow (Pathologie) unterrichtet. gischen Klinik der Charité, seine Mutter de Studentenvereinigung. Drei Freunde Nach seinem Staatsexamen mit 19 Jah- war Auguste von Alten. A. von Graefe von Graefes studierten ebenfalls Medi- ren fuhr er zur Vertiefung seiner Kennt- besuchte das französische Gymnasium zin und wurden später Assistenzärzte in nisse nach Prag, Paris, Wien und London in Berlin, wo er eine besondere Begabung seiner Augenklinik: Adolf Waldau, Eduard – auch um sich darüber klar zu werden, für Mathematik, Physik und Philosophie Michaelis und Julius Ahrend. Mit ihnen welches Fach der Medizin er beruflich zeigte und fließend französisch sprechen verband ihn eine lebenslange Freund- ausüben wollte. In Prag war es Ferdinand lernte. -

IN HISTORY a Compilation of Articles on Instruments, Books and Individuals That Shaped the Course of Ophthalmology
THE EYE IN HISTORY A compilation of articles on Instruments, Books and Individuals that shaped the course of Ophthalmology Mr. Richard KEELER FRCOphth (Honorary) Professor Harminder S DUA Chair and Professor of Ophthalmology, University of Nottingham MBBS, DO, DO (London), MS, MNAMS, FRCS (Edinburgh), FEBO, FRCOphth, FRCP (Honorary, Edinburgh), FCOptom. (Honorary), FRCOphth. (Honorary), MD, PhD. 4 EDITION Edited by: Laboratoires Théa 12 Rue Louis Blériot - ZI du Brézet 63017 Clermont-Ferrand cedex 2 - France Tel. +33 (0)4 73 98 14 36 - Fax +33 (0)4 73 98 14 38 www.laboratoires-thea.com The content of the book presents the viewpoint of the authors and does not necessarily reflect the opinions of Laboratoires Théa. Mr. Richard KEELER and Prof. Harminder S DUA have no financial interest in this book. All rights of translation, adaptation and reproduction by any means are reserved for all countries. Any reproduction, in whole or part, by any means whatsoever, of the pages published in this book, is prohibited and unlawful and constitutes forgery without the prior written consent of the publisher. The only reproductions allowed are, on the one hand, those strictly reserved for private use and not intended for collective use and, on the other hand, short analyses and quotations justified by the scientific or informational nature of the work into which they are incorporated. (Law of 11 March 1957, art. 40 and 41, and Penal Code art. 425) 5 6 PREFACE For seven years (2007-2014) Dr. Arun D Singh and I served as editors-in-chief of the British Journal of Ophthalmology (BJO), published by the BMJ publishing group. -

The German National Attack on the Czech Minority in Vienna, 1897
THE GERMAN NATIONAL ATTACK ON THE CZECH MINORITY IN VIENNA, 1897-1914, AS REFLECTED IN THE SATIRICAL JOURNAL Kikeriki, AND ITS ROLE AS A CENTRIFUGAL FORCE IN THE DISSOLUTION OF AUSTRIA-HUNGARY. Jeffery W. Beglaw B.A. Simon Fraser University 1996 Thesis Submitted in Partial Fulfillment of The Requirements for the Degree of Master of Arts In the Department of History O Jeffery Beglaw Simon Fraser University March 2004 All rights reserved. This work may not be reproduced in whole or in part, by photocopy or other means, without the permission of the author. APPROVAL NAME: Jeffery Beglaw DEGREE: Master of Arts, History TITLE: 'The German National Attack on the Czech Minority in Vienna, 1897-1914, as Reflected in the Satirical Journal Kikeriki, and its Role as a Centrifugal Force in the Dissolution of Austria-Hungary.' EXAMINING COMMITTEE: Martin Kitchen Senior Supervisor Nadine Roth Supervisor Jerry Zaslove External Examiner Date Approved: . 11 Partial Copyright Licence The author, whose copyright is declared on the title page of this work, has granted to Simon Fraser University the right to lend this thesis, project or extended essay to users of the Simon Fraser University Library, and to make partial or single copies only for such users or in response to a request from the library of any other university, or other educational institution, on its own behalf or for one of its users. The author has further agreed that permission for multiple copying of this work for scholarly purposes may be granted by either the author or the Dean of Graduate Studies. It is understood that copying or publication of this work for financial gain shall not be allowed without the author's written permission. -

Official Publication of the Optometric Historical Society
Official Publication of the Optometric Historical Society Hindsight: Journal of Optometry History publishes material on the history of optometry and related topics. As the official publication of the Optometric Historical Society, Hindsight: Journal of Optometry History supports the purposes and functions of the Optometric Historical Society. The purposes of the Optometric Historical Society, according to its by-laws, are: ● to encourage the collection and preservation of materials relating to the history of optometry, ● to assist in securing and documenting the recollections of those who participated in the development of optometry, ● to encourage and assist in the care of archives of optometric interest, ● to identify and mark sites, landmarks, monuments, and structures of significance in optometric development, and ● to shed honor and recognition on persons, groups, and agencies making notable contributions toward the goals of the society. Officers and Board of Trustees of the Optometric Historical Society (with years of expiration of their terms on the Board in parentheses): President: John F. Amos (2015), email address: [email protected] Vice-President: Alden Norm Haffner (2014), email address: [email protected] Secretary-Treasurer: Chuck Haine (2016), email address: [email protected] Trustees: Irving Bennett (2016), email address: [email protected] Jay M. Enoch (2014), email address: [email protected] Ronald Ferrucci (2017), email address: [email protected] Morton Greenspoon (2015), email address: [email protected] Alfred Rosenbloom (2015), email address: [email protected] Bill Sharpton (2017), email address: [email protected] The official publication of the Optometric Historical Society, published quarterly since its beginning, was previously titled: Newsletter of the Optometric Historical Society, 1970-1991 (volumes 1-22), and Hindsight: Newsletter of the Optometric Historical Society, 1992-2006 (volumes 23-37). -

Visus Und Vision 150 Jahre DOG
DOG Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft Die wissenschaftliche Gesellschaft der Augenärzte Visus und Vision 150 Jahre DOG Visus und Vision Festschrift zum 150-jährigen Bestehen der 150 Jahre DOG Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft Impressum Herausgeber: DOG Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft Geschäftsstelle Platenstr. 1 80336 München 2007 im Biermann Verlag GmbH, 50997 Köln. Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder andere Verfahren) reproduziert oder unter Verwen- dung von mechanischen bzw. elektronischen Datenverarbeitungsmaschinen gespeichert, systematisch ausgewertet oder verbreitet werden. Grafische Umsetzung: Ursula Klein Lektorat: Britta Achenbach Druck: MediaCologne, Hürth Layoutkonzept: design alliance Büro Roman Lorenz München Inhaltsverzeichnis S. 11 Vorwort Prof. Duncker S. 17 Die Geschichte der DOG bis 1933 S. 35 Die DOG im „Dritten Reich“ (1933-1945) S. 67 Die Entwicklung der Augenheilkunde in der ehemaligen DDR und die Beziehungen der Gesellschaft der Augenärzte der DDR zur DOG (1945-1990) S. 89 Die Geschichte der DOG in Westdeutschland von 1945 bis 1990 S. 245 Die Entwicklung der DOG in den Neuen Bundesländern von 1990 bis 1995 S. 257 Wachstum und Wandel – Zu den strukturellen Veränderungen der DOG von 1989 bis heute S. 265 Zur Zukunft der DOG S. 275 Der internationale Charakter der DOG aus historischer Sicht S. 293 Gedenken an Albrecht von Graefe – Die Graefe- Sammlung der DOG am Berliner Medizinhisto- rischen Museum S. 311 Die Nachfahren der von Graefe- und Graefe-Familien Anhänge: S. 355 Liste der Präsidenten und Tagungsthemen S. 359 Liste der Ehrenmitglieder S. 365 Supplement 2013: S. 367 Vollständiges Namensverzeichnis S. 379 Umfangreiches Sachverzeichnis Gernot I. -
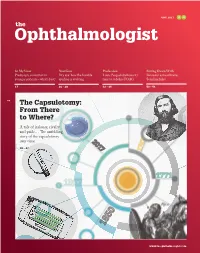
The Capsulotomy: from There to Where?
JUNE 2017 # 42 In My View NextGen Profession Sitting Down With Presbyopia correction in Dry eye: how the humble Louis Pasquale believes it’s Innovator extraordinaire, younger patients – what’s best? eyedrop is evolving time to redefine POAG Sean Ianchulev 17 36 – 38 42 – 45 50 – 51 The Capsulotomy: From There to Where? A tale of jealousy, rivalry and pride… The unfolding story of the capsulotomy over time 18 – 27 www.theophthalmologist.com It’s all in CHOOSE A SYSTEM THAT EMPOWERS YOUR EVERY MOVE. Technique is more than just the motions. Purposefully engineered for exceptional versatility and high-quality performance, the WHITESTAR SIGNATURE PRO Phacoemulsification System gives you the clinical flexibility, confidence and control to free your focus for what matters most in each procedure. How do you phaco? Join the conversation. Contact your Phaco Specialist today. Rx Only INDICATIONS: The WHITESTAR SIGNATURE PRO System is a modular ophthalmic microsurgical system that facilitates anterior segment (cataract) surgery. The modular design allows the users to configure the system to meet their surgical requirements. IMPORTANT SAFETY INFORMATION: Risks and complications of cataract surgery may include broken ocular capsule or corneal burn. This device is only to be used by a trained, licensed physician. ATTENTION: Reference the labeling for a complete listing of Indications and Important Safety Information. WHITESTAR SIGNATURE is a trademark owned by or licensed to Abbott Laboratories, its subsidiaries or affiliates. © 2017 Abbott Medical Optics Inc. | PP2017CT0929 Image of the Month In a Micropig’s Eye This Wellcome Image Award winner depicts a 3D model of a healthy mini-pig eye. -

Founder of Scientific Ophthalmology
Singapore Med J 2007; 48 (9) : 797 Medicine in Stamps Albrecht von Graefe (1828-1870): founder of scientific ophthalmology Tan S Y, MD, JD and Zia J K, BA* Professor of Medicine and Adjunct Professor of Law, University of Hawaii *Research done during senior medical clerkship, John A Burns School of Medicine, University of Hawaii Ancient Greece counted on some 30 different many famous students, including Argyll Robertson, gods to protect her health, but none was Friedrich Homer and Theodore Billroth. designated guardian of sight. The Pharaohs of Egypt trusted special court physicians THE ACADEMICIAN Von Graefe became an asso- to treat trachoma, the dreaded chlamydial eye disease ciate professor, then a full professor of ophthalmology that plagued its citizens, but they were helpless against at the University of Berlin, and was the first German its blinding outcome. Through the centuries, physicians professor of eye diseases. Enthusiastic with high mostly fumbled when it came to eye ailments, leaving expectations, he captured the eager minds of many, them to the machinations of quacks. Little was known through outstanding lectures at the university, writings of the physiology of the human eye, and treatment in his journal, or discussions at meetings. One of his modalities were rudimentary and ineffective. However, protegés, Karl Weber, noted: "One was spell -bound in in the mid -nineteen century, a quartet of gifted European his clinic, as if in a magic place. The multitude of new doctors pooled their insight and experience to form a facts and viewpoints ever heard before, the fascinating discipline that offered new diagnostic presentation and glowing enthusiasm and therapeutic interventions for the z acted like a revelation." Another admirer, â Mà[ilvdu first time. -

Medicina ^Historia
MEDICINA ^HISTORIA REVISTA DE ESTUDIOS HISTÓRICO INFORMATIVOS DE LA MEDICINA Secretaría de Redacción Centro de Documentación de Historia de la Medicina de J. URIACH & Cía. S. A. Barcelona, abril de 1973 Dr. LORENZO BALAGUERO LLADO LA HISTERECTOMÍA VAGINAL A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS 23 M&H II LA HISTERECTOMÍA VAGINAL A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS I. DE LAS FUMIGACIONES AL «SPECULUM MATRI- teneciente a la escuela de Alejandría, asegura- cis» DE AMBROSIO PARÉ : PRÓLOGO DE LA GRAN ba que el útero podía ser extirpado sin causar AVENTURA la muerte, y Areteo, que vivió en el siglo II de nuestra era en la provincia romana de Capa- La vía vaginal, por su fácil acceso, supuso docia, nos ha legado una descripción del ór- siempre un tentador campo de operaciones gano, harto fantasiosa, que explica el porqué para los cirujanos. Sin embargo, los primeros de las antiguas prácticas de fumigación: «En escritos sobre temas ginecológicos de que se medio de los flancos de la mujer se halla la tiene noticia raramente postulan soluciones matriz, viscera muy parecida a un animal, quirúrgicas, por elementales que fueren, limi- pues se mueve por sí misma hacia uno y otro tándose a transcribir algunos sofisticados tra- lado y también hacia arriba en línea recta tamientos locales de tipo conservador. hasta debajo del cartílago del tórax, así como El Papiro de Ebers (1200-1000 a. de J.C.), com- oblicuamente hacia la derecha o a la izquier- pilado durante el reinado de Amer-Hotep I, da, hacia el hígado o hacia el bazo; igualmente contiene algunos pasajes relativos al prolapso es propensa a deslizarse hacia abajo y en una uterino y forma de remediarlo : pastas y fumi- palabra es completamente errática. -

100 Jahre Bayerische Gesellschaft Für Geburtshilfe Und Frauenheilkunde
© Copyright 2012 Georg Thieme Verlag Stuttgart New York © Copyright 2012 Georg Thieme Verlag Stuttgart New York Herausforderungen 100 Jahre Bayerische Gesellschaft für Geburtshilfe und Frauenheilkunde Herausgegeben von C. Anthuber M.W. Beckmann J. Dietl F. Dross W. Frobenius 44 Abbildungen 2 Tabellen Georg Thieme Verlag Stuttgart · New York © Copyright 2012 Georg Thieme Verlag Stuttgart New York IV Prof. Dr. Christoph Anthuber Wichtiger Hinweis: Wie jede Wissenschaft ist die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe Medizin ständigen Entwicklungen unterworfen. For- Oßwaldstraße 1, 82319 Starnberg schung und klinische Erfahrung erweitern unsere Er- Prof. Dr. med. Matthias W. Beckmann kenntnisse, insbesondere, was Behandlung und me- Universitätsklinikum Erlangen, Frauenklinik dikamentöse Therapie anbelangt. Soweit in diesem Universitätsstraße 21–23, 91054 Erlangen Werk eine Dosierung oder eine Applikation erwähnt wird, darf der Leser zwar darauf vertrauen, dass Au- Prof. Dr. med. Johannes Dietl toren, Herausgeber und Verlag große Sorgfalt darauf Frauenklinik und Hebammenschule, verwandt haben, dass diese Angabe dem Wissens- Universitätsklinikum Würzburg stand bei Fertigstellung des Werkes entspricht. Josef-Schneider-Straße 4, 97080 Würzburg Für Angaben über Dosierungsanweisungen und PD Dr. phil. Fritz Dross Applikationsformen kann vom Verlag jedoch keine Institut für Geschichte und Ethik der Medizin Gewähr übernommen werden. Jeder Benutzer ist an- Glückstraße 10, 91054 Erlangen gehalten, durch sorgfältige Prüfung der Beipackzettel PD Dr. -

Scientific Ophthalmology Owes Its Beginnings to Short Life of Albrecht Von Graefe
Eye on History Scientific ophthalmology owes its beginnings to short life of Albrecht von Graefe by Colin Kerr Feature Feature Despite his relatively short life, Graefe’s approach to ophthalmology and Albrecht von Graefe (1828-1870) laid gives an indication of his determination to the foundation for scientific become a brilliant teacher in the years ophthalmology through a brilliant ahead. It also indicates that this was a man with a waspish pen who did not suffer fools career. gladly. orn in Berlin “Ophthalmology is on May 28, most important,” wrote 1828, Graefe.“I visit regularly B the clinics of Sichel and Graefe died in the Desmarres.The first is same city on July 20 held three times weekly 1870, aged 42 (each time for four years. Graefe’s hours) and the latter five influence on times (each time for ophthalmology and three hours). Sichel’s German medicine is clinic treats a large all the more number of patients. Each time about 40 to 50 new remarkable as he and 200 to 300 old achieved so much patients are seen.This in a tragically short abundance of material career. His alone gives his clinic its discovery that value. His lectures, on glaucoma could be the other hand, are cured by boring, verbose, lack substance and resemble iridectomy, an idea more the chatter of old women than Albrecht von Graefe memorial situated in the Charité Berlin which was first published in 1857, scientific presentations....He is a firm confirmed his reputation as the most diagnostician, has a good routine but belongs He was appointed Extraordinary The journal was later renamed Albrecht brilliant ophthalmologist of his generation.