1. Hugo Reichenberger, Ein Münchner (Hof-)Kapellmeister
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Der Rosenkavalier by Richard Strauss
Florida State University Libraries Electronic Theses, Treatises and Dissertations The Graduate School 2010 Octavian and the Composer: Principal Male Roles in Opera Composed for the Female Voice by Richard Strauss Melissa Lynn Garvey Follow this and additional works at the FSU Digital Library. For more information, please contact [email protected] THE FLORIDA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF MUSIC OCTAVIAN AND THE COMPOSER: PRINCIPAL MALE ROLES IN OPERA COMPOSED FOR THE FEMALE VOICE BY RICHARD STRAUSS By MELISSA LYNN GARVEY A Treatise submitted to the Department of Music in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Music Degree Awarded: Spring Semester, 2010 The members of the committee approve the treatise of Melissa Lynn Garvey defended on April 5, 2010. __________________________________ Douglas Fisher Professor Directing Treatise __________________________________ Seth Beckman University Representative __________________________________ Matthew Lata Committee Member The Graduate School has verified and approved the above-named committee members. ii I’d like to dedicate this treatise to my parents, grandparents, aunt, and siblings, whose unconditional love and support has made me the person I am today. Through every attended recital and performance, and affording me every conceivable opportunity, they have encouraged and motivated me to achieve great things. It is because of them that I have reached this level of educational achievement. Thank you. I am honored to thank my phenomenal husband for always believing in me. You gave me the strength and courage to believe in myself. You are everything I could ever ask for and more. Thank you for helping to make this a reality. -

Die Münchner Philharmoniker
Die Münchner Philharmoniker Die Münchner Philharmoniker wurden 1893 auf Privatinitiative von Franz Kaim, Sohn eines Klavierfabrikanten, gegründet und prägen seither das musikalische Leben Münchens. Bereits in den Anfangsjahren des Orchesters – zunächst unter dem Namen »Kaim-Orchester« – garantierten Dirigenten wie Hans Winderstein, Hermann Zumpe und der Bruckner-Schüler Ferdinand Löwe hohes spieltechnisches Niveau und setzten sich intensiv auch für das zeitgenössische Schaffen ein. Von Anbeginn an gehörte zum künstlerischen Konzept auch das Bestreben, durch Programm- und Preisgestaltung allen Bevölkerungs-schichten Zugang zu den Konzerten zu ermöglichen. Mit Felix Weingartner, der das Orchester von 1898 bis 1905 leitete, mehrte sich durch zahlreiche Auslandsreisen auch das internationale Ansehen. Gustav Mahler dirigierte das Orchester in den Jahren 1901 und 1910 bei den Uraufführungen seiner 4. und 8. Symphonie. Im November 1911 gelangte mit dem inzwischen in »Konzertvereins-Orchester« umbenannten Ensemble unter Bruno Walters Leitung Mahlers »Das Lied von der Erde« zur Uraufführung. Von 1908 bis 1914 übernahm Ferdinand Löwe das Orchester erneut. In Anknüpfung an das triumphale Wiener Gastspiel am 1. März 1898 mit Anton Bruckners 5. Symphonie leitete er die ersten großen Bruckner- Konzerte und begründete so die bis heute andauernde Bruckner-Tradition des Orchesters. In die Amtszeit von Siegmund von Hausegger, der dem Orchester von 1920 bis 1938 als Generalmusikdirektor vorstand, fielen u.a. die Uraufführungen zweier Symphonien Bruckners in ihren Originalfassungen sowie die Umbenennung in »Münchner Philharmoniker«. Von 1938 bis zum Sommer 1944 stand der österreichische Dirigent Oswald Kabasta an der Spitze des Orchesters. Eugen Jochum dirigierte das erste Konzert nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit Hans Rosbaud gewannen die Philharmoniker im Herbst 1945 einen herausragenden Orchesterleiter, der sich zudem leidenschaftlich für neue Musik einsetzte. -

MOZART Così FAN TUTTE Wolfgang Sawallisch
MOZART COSì FAN TUTTE Price · Fassbaender ∙ Grist Schreier · Brendel · Adam Wolfgang Sawallisch Bayerische Live Staatsoper ORFEO D' OR Live Recording 25. Februar 1978 BAYERISCHE STAATSOPER LIVE Unser Opernerbe ist nirgendwo in einer to theatrical spirit. Here are live perfor- so herausragenden Bühnentradition auf- mances captured in the heat of the pro- geführt worden wie an der Bayerischen methean forge – warts and all! Staatsoper München. Die Edition BAYE- Every Opera production is a prototype – RISCHE STAATSOPER LIVE liefert uns nicht an individual bespoke act of creative in- nur wertvolle historische Dokumente, son- terpretation resulting in that live experien- dern auch ein Gegenargument zu der ce we share. Here are some of those mo- Behauptung, Aufnahmen stellten für den ments preserved in aspic and re-ignit-ed Geist des Theaters eine Bedrohung dar. into life by the flame of technology. Let us Hier haben wir Aufführungen live, direkt aus treasure them and look forward to more der Glut der prometheischen Schmiede, riches that are promised from the past of mitsamt ihren kleinen Unebenheiten und our distinguished company! Schwächen! Jede Operninszenierung ist eine Art Pro- Jamais les opéras de notre patrimoine totyp: ein individueller Akt kreativer Inter- n’ont trouvé une aussi éminente tradition pretation, dessen Ergebnis wir gemein- théâtrale qu’à Munich, à la « Bayerische sam live erleben. Einige solcher Augen- Staatsoper ». Cette série d’enregistrement blicke finden wir hier wie in Bernstein ein- en direct – BAYERISCHE STAATSOPER LIVE geschlossen und durch die Technik wie- – ne constitue pas seulement un docu- der zu neuem Leben entfacht. Hüten wir ment historique de valeur, mais s’oppose diesen Schatz, und freuen wir uns auf das, à l’affirmation selon laquelle les enregis- was aus der reichen Vergangenheit un- trements menaceraient l’esprit théâtral. -

380 XXXIX. Tonkünstler-Versammlung Basel
380 XXXIX. Tonkünstler-Versammlung Basel, [Karlsruhe], [11.] 12. – 15. Juni 1903 Festdirigenten: Hans Huber, Hermann Suter Festchor: Basler Gesangverein, Basler Liedertafel, Reveillechor der Basler Liedertafel Ens.: Orchester der Allgemeinen Musikgesellschaft Basel, verstärkt durch Mitglieder der Meininger Hofkapelle und des Orchestre symphonique de Lausanne sowie hiesige und auswärtige Künstler (110 Musiker) 1. Aufführung: Festvorstellung Karlsruhe, Großhzgl. Hoftheater, Donnerstag, 11. Juni Friedrich Klose: Das Märlein vom Fischer und seiner Frau, Oper 2. Aufführung: I. Konzert [auch: für Soli, Männerchor und Orchester ] Basel, Musiksaal, Freitag, 12. Juni, 19:00 Uhr 1. Émile Jaques-Dalcroze: Sancho, Comédie lyrique Vorspiel für Orchester 2. Friedrich Hegar: Männerchöre a cappella Ch.: Basler Liedertafel a) Das Märchen vom Mummelsee (Ms.) Text: C.A. Schnezler (≡) b) Walpurga op. 31 Text: Carl Spitteler ( ≡) 3. Ernest Bloch: Symphonie cis-Moll (Ms.) 1. 2. Largo 2. 3. Vivace 4. Max von Schillings: Das Hexenlied, mit begleitender Sol.: Ernst von Possart (Rez.) Musik für Orchester op. 15 Text: Ernst von Wildenbruch 5. Waldemar Pahnke: Concert für Violine und Orchester c- Sol.: Henri Marteau (V.) Moll (Ms.) 1. Moderato con moto 2. Allegro vivace ---- 6. Hans Huber: Caenis (die Verwandlung), für Männerchor, Sol.: Maria Cäcilia Philippi (A) Altsolo und Orchester op. 101 Ch.: Basler Liedertafel Text: Joseph Victor Widmann, nach einer antiken Sage (≡) 7. Gesänge für Bariton mit Orchester Sol.: Richard Koennecke (Bar.) a) Klaus Pringsheim: Venedig Text: Friedrich Nietzsche (≡) Oskar C. Posa: b) Tod in Aehren Text: Detlev von Liliencron (≡) c) „Mit Trommeln und Pfeifen“ (Ms.) Text: Detlev von Liliencron (≡) 8. Ernst Boehe: Aus Odysseus Fahrten, 4 Episoden für grosses Orchester gesetzt op. -

Chronology 1916-1937 (Vienna Years)
Chronology 1916-1937 (Vienna Years) 8 Aug 1916 Der Freischütz; LL, Agathe; first regular (not guest) performance with Vienna Opera Wiedemann, Ottokar; Stehmann, Kuno; Kiurina, Aennchen; Moest, Caspar; Miller, Max; Gallos, Kilian; Reichmann (or Hugo Reichenberger??), cond., Vienna Opera 18 Aug 1916 Der Freischütz; LL, Agathe Wiedemann, Ottokar; Stehmann, Kuno; Kiurina, Aennchen; Moest, Caspar; Gallos, Kilian; Betetto, Hermit; Marian, Samiel; Reichwein, cond., Vienna Opera 25 Aug 1916 Die Meistersinger; LL, Eva Weidemann, Sachs; Moest, Pogner; Handtner, Beckmesser; Duhan, Kothner; Miller, Walther; Maikl, David; Kittel, Magdalena; Schalk, cond., Vienna Opera 28 Aug 1916 Der Evangelimann; LL, Martha Stehmann, Friedrich; Paalen, Magdalena; Hofbauer, Johannes; Erik Schmedes, Mathias; Reichenberger, cond., Vienna Opera 30 Aug 1916?? Tannhäuser: LL Elisabeth Schmedes, Tannhäuser; Hans Duhan, Wolfram; ??? cond. Vienna Opera 11 Sep 1916 Tales of Hoffmann; LL, Antonia/Giulietta Hessl, Olympia; Kittel, Niklaus; Hochheim, Hoffmann; Breuer, Cochenille et al; Fischer, Coppelius et al; Reichenberger, cond., Vienna Opera 16 Sep 1916 Carmen; LL, Micaëla Gutheil-Schoder, Carmen; Miller, Don José; Duhan, Escamillo; Tittel, cond., Vienna Opera 23 Sep 1916 Die Jüdin; LL, Recha Lindner, Sigismund; Maikl, Leopold; Elizza, Eudora; Zec, Cardinal Brogni; Miller, Eleazar; Reichenberger, cond., Vienna Opera 26 Sep 1916 Carmen; LL, Micaëla ???, Carmen; Piccaver, Don José; Fischer, Escamillo; Tittel, cond., Vienna Opera 4 Oct 1916 Strauss: Ariadne auf Naxos; Premiere -
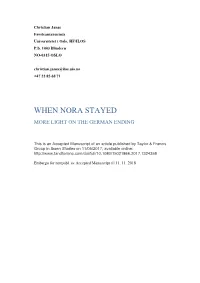
Ibsenstudies Norastayed Accepted Manuscript-Kopi
Christian Janss Førsteamanuensis Universitetet i Oslo, HF/ILOS P.b. 1003 Blindern NO-0315 OSLO [email protected] +47 22 85 68 71 WHEN NORA STAYED MORE LIGHT ON THE GERMAN ENDING This is an Accepted Manuscript of an article published by Taylor & Francis Group in Ibsen Studies on 11/05/2017, available online: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15021866.2017.1324359 Embargo for nettpubl. av Accepted Manuscript til 11. 11. 2018 INTRODUCTION Henrik Ibsen’s A Doll’s House (Et dukkehjem. Skuespil i tre akter, 1879) owes its world wide reputation to the last scene, where Nora leaves her husband and chil- dren. A little less known is the German, alternative ending of Nora – the title commonly used in the German speaking world – where she stays. In the field of theatre studies, this ending is commonly recognized. The fact that Ibsen himself wrote it in 1879 – and tolerated its performance for a while – also belongs to es- tablished knowledge. The circumstances of the genesis and distribution of this very special piece of text have, however, not yet been presented in a manner giv- ing attention to all aspects. My main arguments are: a) The one to ‘blame’ for the alternative ending of Nora is not the actress Hedwig Niemann-Raabe, but rather the translator Wilhelm Lange and the theatre director Heinrich Laube. b) The conciliatory ending was necessary in order to accommodate the ex- pectations of German theatre audiences around 1880. c) The alternative ending had a wider circulation than previously known. It has been repeatedly claimed that the unwillingness on the part of a certain ac- tress and a theatre director to let Nora go was the triggering reason for Ibsen to write this alternative, conciliatory ending (cf. -

110308-10 Bk Lohengrineu 13/01/2005 03:29Pm Page 12
110308-10 bk LohengrinEU 13/01/2005 03:29pm Page 12 her in his arms, reproaching her for bringing their @ Ortrud comes forward, declaring the swan to be happiness to an end. She begs him to stay, to witness her Elsa’s brother, the heir to Brabant, whom she had repentance, but he is adamant. The men urge him to bewitched with the help of her own pagan gods. WAGNER stay, to lead them into battle, but in vain. He promises, Lohengrin kneels in prayer, and when the white dove of however, that Germany will be victorious, never to be the Holy Grail appears, he unties the swan. As it sinks defeated by the hordes from the East. Shouts announce down, Gottfried emerges. Ortrud sinks down, with a the appearance of the swan. cry, while Gottfried bows to the king and greets Elsa. Lohengrin Lohengrin leaps quickly into the boat, which is drawn ! Lohengrin greets the swan. Sorrowfully he turns away by the white dove. Elsa sees him, as he makes his towards it, telling Elsa that her brother is still alive, and sad departure. She faints into her brother’s arms, as the G WIN would have returned to her a year later. He leaves his knight disappears, sailing away into the distance. AN DG horn, sword, and ring for Gottfried, kisses Elsa, and G A F SS moves towards the boat. L E Keith Anderson O N W Mark Obert-Thorn Mark Obert-Thorn is one of the world’s most respected transfer artist/engineers. He has worked for a number of specialist labels, including Pearl, Biddulph, Romophone and Music & Arts. -

Elektra GRAN TEATRE DEL LICEU
Elektra GRAN TEATRE DEL LICEU Temporada 89-90 CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU Generalitat de Catalunya Ajuntament de Barcelona Ministerio de Cultura Diputació de Barcelona Societat del Gran Teatre del Liceu • ® Elektra Tragèdia en un acte Text d'Hugo von Hofmannsthal Música de Richard Strauss Amb el patrocini de Grupo Tabacalera • Funció de Gala "ASSEIG UE liliÀCIA. 41 TEL £. F a N 216 OI 73 27 de a les 21 funció núm. torn C U8007 I:!AII:(ELUNA Dissabte, gener, h., 46, • e A II: R E II SANT PAU. 6 a A TEL e: F o N 317 a a 46 Dilluns, 29 de gener, les 21 h., funció núm. 47, torn o 8 o o I BARCELONA • Dimecres, 31 de gener, a les 21 h., funció núm. 48, torn D EL REGULADOR BAGuEs RAM8LA DE LES FLORS. 105 Divendres, 2 de febrer, a les 21 funció núm. 49, torn B TELEFON 317 " 74 h., 08002 BARCELONA Diumenge, 4 de febrer, a les 17 h., funció núm. 50, torn T •••••••••••••••• Elektra Klytaemnestra Mignon Dunn Elektra Eva Marton (dies 27, 31 i 4) Ute Vinzing (dies 29 i 2) Chrysothernis Sue Patchell Aegisth Hermann Winkler Orest John Bròcheter El mentor d'Orest Joan Tomàs La confident Rosa Vilar Un patge M.:' Antonia Martín-Regueiro Un servidor jove Antoni Comas Un servidor vell Cristóbal Viñas La zeladora María Uriz 1" donzella Rosa Maria Ysàs 2" donzella Francesca Roig 3� donzella Mabel Perelstein 4� donzella Carme Hernández 5'- donzella Hiroko Shiraishi Director d' orquestra Uwe Mund Directora d'escena Núria Espert Directors del cor Romano Gandolfi Vittorio Sicuri Escenografia Ezio Frigerio Vestuari Franca Squarciapino Producció Théàtre Royal -

Bruno Walter (Ca
[To view this image, refer to the print version of this title.] Erik Ryding and Rebecca Pechefsky Yale University Press New Haven and London Frontispiece: Bruno Walter (ca. ). Courtesy of Österreichisches Theatermuseum. Copyright © by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced, in whole or in part, including illustrations, in any form (beyond that copying permitted by Sections and of the U.S. Copyright Law and except by reviewers for the public press), without written permission from the publishers. Designed by Sonia L. Shannon Set in Bulmer type by The Composing Room of Michigan, Grand Rapids, Mich. Printed in the United States of America by R. R. Donnelley,Harrisonburg, Va. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Ryding, Erik S., – Bruno Walter : a world elsewhere / by Erik Ryding and Rebecca Pechefsky. p. cm. Includes bibliographical references, filmography,and indexes. ISBN --- (cloth : alk. paper) . Walter, Bruno, ‒. Conductors (Music)— Biography. I. Pechefsky,Rebecca. II. Title. ML.W R .Ј—dc [B] - A catalogue record for this book is available from the British Library. The paper in this book meets the guidelines for permanence and durability of the Committee on Production Guidelines for Book Longevity of the Council on Library Resources. For Emily, Mary, and William In memoriam Rachel Kemper and Howard Pechefsky Contents Illustrations follow pages and Preface xi Acknowledgments xv Bruno Schlesinger Berlin, Cologne, Hamburg,– Kapellmeister Walter Breslau, Pressburg, Riga, Berlin,‒ -

¦Jmi/Oical »
4 THE SUNDAY STAR. WASHINGTON. D. 0.. SEPTEMBER 12. 1926-PART 3. Will Present Concerts "Sounding Brass" WINS FINE ENGAGEMENT In Continental Hall. N interesting musical announce- ¦ - | MUSIGRAPHS ment was made yesterday bv /"ANE of the outstanding features In the Jazz orchestra world Is the i Mrs. Wilson-Greene, local concert year 13 seems to be the chosen number of local musicians for I . Memorial MUSIC I effect that ! coming of Vincent Lope/, to Wash- i manager, to the the leading music schools, and many of the private studios an- (ngton today. Mr. Lopez brings with Continental Hall, headquarters of their opening for the season for tomorrow—-September 13. By him his celebrated Casa Lopez Club Daughters of the American Rev- nounce * Helen Fetter. Orchestra, which will play here dur- ‘ the THIS discussed number will lucky for them or prove olution, and C- streets Whether this much ]L ing the current week. at Seventeenth unfolds its everlengthening list of This popular conductor says: “By ! northwest, used for four of not remains to be seen as the season i. MUNICH, Germany, August 13. will be combining the proper music with its threshold into history. Never previously has there ; Saturday evening concerts in recitals and crosses the popular logical please Jj3 SprDH the six realm of grand opera has but one example o{ what fic- colors we are to | the Wilson-Greene series. be quite so much energy, and, in good old American, “pep," in the sensibilities of our audiences ; Ifek Europe seemed to tion magazines Tall "serial stories." The serial opera is ' Der Ring Since her return front up for the new work as this year. -

Die Bühnenbildentwürfe Im Werk Von Max Slevogt
Die Bühnenbildentwürfe im Werk von Max Slevogt Inauguraldissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie an der Ludwig‐Maximilians‐Universität München vorgelegt von Carola Schenk aus München 2015 Erstgutachter: Prof. Dr. Frank Büttner Zweitgutachter: Prof. Dr. Burcu Dogramaci Datum der mündlichen Prüfung: 29. Juni 2015 1 Inhalt Dank ......................................................................................................................................... 5 1. Einführung ........................................................................................................................ 8 1.1 Einleitung ................................................................................................................. 8 1.2 Literaturbericht ....................................................................................................... 12 2. Theater- und Künstlerszene im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts in Berlin ................ 20 2.1 Die Künstlermetropole Berlin ................................................................................ 20 2.2 Die Theatermetropole Berlin .................................................................................. 28 3. Bildende Kunst und Theater – Wechselwirkungen zwischen bildender Kunst und Theater .................................................................................................................................... 35 3.1 Bildende Künstler und das Theater – Maler als Bühnenbildner zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Deutschland ............................................................................................. -

Internationaler Richard Wagner Kongress 2021 Willkommen in München Welcome to Munich Bienvenu À Munich 14.10.2021
Internationaler Richard Wagner Kongress 2021 Willkommen in München Welcome to Munich Bienvenu à Munich 14.10.2021 - 17.10.2021 Richard Wagner Verband International e.V. Richard Wagner Verband München e.V. Unsere Sponsoren Stadt München Münchner Verkehrsgesellschaft Blomhert-Watjen Fonds Amsterdam (Niederlande) Dres. Gerda & Stefan Frauendorfer Hannes F. Hofer Dr. Viktoria Moench Rainer & Burghilde Neumann Gisela Roer Dres. Angela & Hermann Sommer Zahlreiche Mitglieder des Richard Wagner Verband München e.V. Grußwort S.K.H. Herzog Franz von Bayern Der Richard Wagner Verband München kann im Jahr 2021 auf sein 150jähriges Bestehen zurückblicken. Als Schirmherr des Internationalen Richard Wagner Kongresses im Oktober 2021 möchte ich dem Verein zu seinem runden Jubiläum herzlich gratulieren. Über die Verbindung zwischen Richard Wagner und König Ludwig II. von Bayern ist bereits viel veröffentlicht worden. Zwischen beiden Persönlichkeiten bestand eine enge persönliche, aber auch von einer gemeinsamen schöpferischen Leidenschaft für die Kunst geprägte Be- ziehung. Richard Wagner war 1864 auf Einladung Ludwigs II. nach München gekommen. Nur sieben Jahre später wurde der Deutsche Allgemeine Richard-Wagner-Verein von Emil Heckei im pfälzischen Mannheim gegründet. Dieser Verein, der ein Vorläufer des heutigen Verbandes ist, hatte sich für die Verwirklichung des Bayreuther Festspielhauses eingesetzt, ebenso wie das Ludwig II. als Mäzen Richard Wagners tat. Ludwig II. ordnete in München Uraufführungen und Privataufführungen von Werken des Komponisten an. Dazu gehören die Uraufführung von „Tristan und lsolde“ im Jahr 1865 und der „Meistersinger von Nürnberg“ drei Jahre später. In diesem Sinne ist München eine Wagner-Stadt und so findet der Internationale Richard Wagner Kongress im Jahr 2021 hier statt.