Simmerner Energie Infomappe
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

19-1129 Raderlebniskarte Romrhein 2019.Indd
Gerressen Müllekoven Meindorf Mülldorf Niederhalberg Hombach Roth Weldergoven Bourauel Saal Eitorf Windeck Opsen Locksiefen RE · RB Lauthausen Oberauel Obernau ¢« § RE Halft Herchen Richtung Köln Hersel Richtung Köln Niederpleis Richtung Köln Kelters RE Fähre RE Dersdorf · RB ICE-Strecke Imhausen Hennef (Sieg) Au (Sieg) Buschdorf St. Augustin Herchen Leuscheid RE Greuelsiefen Untenroth Eitorf Geilhausen Bornheim Graurheindorf Geislar Huckenbröl Dahlhausen Roisdorf Niederberg Hennef (Sieg) Stein Radkarte Romantischer Rhein aldorf Botzdorf Geisbach Hohegrete Tannenbusch Pracht Aascheid Blankenberg Bitze Stromberg Alsen Hamm Der Romantische Rhein – Tourist-Informationen Brenig Vilich Hangelar Birlinghoven Per Fahrrad durch MitEhrenhausen Aufstiegshilfen vom Mittelscheid Käsberg RB Unterwegs mit Rad, Bus und Bahn zwischen Rheindorf Dambroich Kocherscheid §¦ Holzlar Lascheid Breitscheidt Söven Lanzenbach Süchterscheidt Roder Kratzhausen Bonn, Koblenz und Mainz/Wiesbaden Kuchhausen für Entdecker und Genießer! am Romantischen Rhein! Alfter Beuel Pützchen Rott Bierth das Mittelrheintal Mittelrheintal Breitscheidtauf die Höhen Obenroth Niederirsen Weißenbrüchen Olsdorf Bonn-Beuel Hoholz Fernegierscheid Rauschendorf Hofen Hove Lichtenberg Schaden Marienthal Kloster Wein, Kultur und eine atemberaubende Landschaft: Der Rhein Dieses Faltblatt enthält vor allem Informationen rund um das Bonn Hbf Küdinghoven Roleber Jährlich „erfahren“ es zahlreiche Radler: Nur das Rad ermöglicht RechtsOlsen undBirkenbeul links des Rheins in seinem tiefen Canyon -

Verbandsordnung Des Kindertagesstätten-Zweckverbandes Simmern-Rheinböllen Vom 04.11.2019 Zuletzt Geändert Durch Die 1
Verbandsordnung des Kindertagesstätten-Zweckverbandes Simmern-Rheinböllen vom 04.11.2019 zuletzt geändert durch die 1. Änderung der Verbandsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.01.2021 (durchgeschriebene Fassung) Präambel Die Trägerschaft der Kindertagesstätten ist in den Verbandsgemeinden Rheinböllen und Simmern unterschiedlich geregelt. So stehen die kommunalen Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde Rheinböllen in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Rheinböllen. Die kommunalen Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde Simmern dagegen stehen in der originären Trägerschaft der Ortsgemeinden, der Stadt Simmern bzw. bei dem Zweckverband Kindergarten Biebertal. Im Zuge der Fusion der beiden Verbandsgemeinden zur neuen Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen wurde die Zusammenführung der unterschiedlichen Modelle vereinbart. Mit der Gründung des Kindertagesstätten- Zweckverbandes soll diesem Umstand nun Rechnung getragen werden. Mit dieser Verbandsordnung wird in einem ersten Schritt der gemeinsame Betrieb und die Trägerschaft geregelt. Um langfristig zu einer gemeinsamen Finanzierung des Zweckverbandes zu gelangen, sollen zunächst die ungedeckten Personalkosten nach § 12 des Kindertagesstättengesetzes sowie die den Kindertagesstätten zur Verfügung gestellten Budgets nach einem einheitlichen Abrechnungsschlüssel auf alle Mitglieder umgelegt werden. Hinsichtlich der Kosten für Betrieb und Unterhaltung der Gebäude sowie der Investitionskosten sollen die bisherigen Abrechnungsmodelle zunächst beibehalten werden um nach einem -

Pfarrbrief Pfarreiengemeinschaft Rheinböllen Nr
Pfarrbrief Pfarreiengemeinschaft Rheinböllen Nr. 8/2021 vom 05.09.2021 -10.10.2021 Einzelpreis: 0,50 € Am Tag der heiligen Hildegard (17. September) sind Bruder Johannes und ich mit einer Pilgergruppe in Burgund. Und deshalb schreibe ich einige Zeilen über diese Heilige in unserem Pfarrbrief. Hildegard war eine bemerkenswerte Frau. Sie ist allein deshalb bemerkens- wert, weil sie sich in der damaligen Zeit Gehör verschafft hat und auch ihre Zeit entscheidend mitgeprägt hat. Es war eine Zeit, in der Kaiser und Papst um Macht und Einfluss stritten. Es war eine Zeit, in der viele Menschen in Kreuzzüge zogen. Es war eine Zeit, in der es auch innerhalb der damaligen abendländischen Kirche viele Streitereien gab. Es war eine Zeit, in der die heilige Hildegard vielen Menschen Weisung und Orientierung gab. Es war eine Zeit, in der Hildegard große Teile des Wissens der damaligen Zeit in sich vereinen konnte und ihre Neugier und Urteilsgabe neue Erkenntnisse hervorbrachte. © Foto des Hildegard Forums der Kreuzschwestern – Rochusberg Bingen Und damit bin ich bereits bei ei- nem wichtigen Punkt, den die hei- lige Hildegard derzeit so beliebt macht. Denn Hildegard war je- mand, der es verstand ganzheit- lich zu leben. Wir kennen viele Spezialisten, die in ihrem Fachge- biet Großes leisten. Aber ihre Fachgebiete beschreiben oft nur einen kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit. Und unser eigenes Leben kennt inzwischen so viele Teilbereiche, dass wir oft das wirklich Wichtige, das Ganze, gar nicht mehr im Blick haben können und uns in unwichtigen Dingen verlie- ren. Hildegard jedoch hatte Alles irgendwie im Blick. Und sie hatte einen Ausgangspunkt, von dem aus sie das Leben deutete: von Gott her. -

Kehrbezirke-Übersicht Stand 02 2021.Xlsx
Liste der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger (Stand Februar 2021) Gemeinde Vorname Name PLZ Wohnort Straße Telefon Fax E-Mail Kehrbezirk Alterkülz Jens Untermair 56154 Boppard ST Buchholz Casinostraße 15 06742 82361 06742 896549 [email protected] Rhein-Hunsrück-Kreis III Altlay Andreas Rosenbach 55469 Simmern Schönburgstr. 7 06761 2929 06761 908990 [email protected] Rhein-Hunsrück-Kreis VII Altweidelbach Bernd Rosenbach 55471 Kümbdchen In der Au 6 06761 6985 06761 961139 [email protected] Rhein-Hunsrück-Kreis IV Argenthal Frank Rühl 55469 Niederkumbd Auf der Poßwies 11 06761 9128157 06761 9128158 buero.schornsteinfeger-frankruehl.de Rhein-Hunsrück-Kreis IX Badenhard Oliver Kammermayer 55494 Rheinböllen Simmerner Straße 15 06764 7491342 06764 74922219 [email protected] Rhein-Hunsrück-Kreis II Bärenbach Andreas Rosenbach 55469 Simmern Schönburgstr. 7 06761 2929 06761 908990 [email protected] Rhein-Hunsrück-Kreis VII Belg Andreas Rosenbach 55469 Simmern Schönburgstr. 7 06761 2929 06761 908990 [email protected] Rhein-Hunsrück-Kreis VII Belgweiler Jens Untermair 56154 Boppard ST Buchholz Casinostraße 15 06742 82361 06742 896549 [email protected] Rhein-Hunsrück-Kreis III Bell Stefan Rosenbach 55469 Simmern Am Stadtgarten 9 06761 7830 06761 9672611 stefan-rosenbach@t-online Rhein-Hunsrück-Kreis I Bell OT Hundheim Stefan Rosenbach 55469 Simmern Am Stadtgarten 9 06761 7830 06761 9672611 stefan-rosenbach@t-online Rhein-Hunsrück-Kreis I Bell OT Krastel Stefan Rosenbach 55469 Simmern Am Stadtgarten -

Schinderhannespfad
Sonstige Rund- und Fernwanderwege Schinderhannespfad Gütesiegel STANDARD Länge 37,7 km Schwierigkeit mittel Bewertungen (0) Höhenmeter 395 m Kondition Erlebnis 606 m Technik Landschaft Dauer 11:24 h Empfohlene Jahreszeiten J F M A M J J A S O N D Kartengrundlagen: outdooractive Kartografie; Deutschland: ©GeoBasis-DE / BKG 2014, GEObasis.nrw Österreich: ©1996-2015 here. All rights reserved., ©BEV 2012, ©Land Vorarlberg, Italien: ©1994-2015 here. All rights reserved., ©Autonome Provinz Bozen – Südtirol Abteilung Natur, Landschaft und Raumetwicklung, Schweiz: Geodata ©swisstopo 1 Sonstige Rund- und Fernwanderwege Schinderhannespfad Wegeart Länge 37.7 km Beschreibung zum Aussichtsplatz an der „Hohen Buch“. Dort schließt der „Schinderhannespfad“ an den Saar- Kurzbeschreibung Hunsrück-Steig an. Anschließend quert der Weg die Der knapp 40 km lange Schinderhannespfad ist als L 108 und die K 27 zur Traumschleife Burgstadtpfad Zweitagestour konzipiert. Er schließt die Lücke und folgt diesem bis zum Wanderparkplatz zwischen den Fernwanderwegen Saar-Hunsrück Gammelshausen. Ab Querung der K 28 über einen Steig und Soonwaldsteig. Von der „Hohen Buch“ in Waldweg zur Grillhütte mit Rastplatz in Laubach. Kastellaun wandert man über die Traumschleife Von dort aus gehen wir an der Ortslage und der Burgstadtpfad Richtung Laubach. Vorbei an der Gesellschaftsmühle vorbei entlang einer Teilstrecke „Gesellschaftsmühle“ (Einkehrmöglichkeit) geht es der Traumschleife „Klingelfloß“ über den über einen Teilbereich der Traumschleife Bienenberg zur Binnenberger Mühle. Weiter Klingelfloß Richtung Neuerkirch (Historischer wandern wir am Wald entlang des Osterkülzer Ortskern). Über Külz, im Bogen um Kümbdchen und Baches an der Osterkülzmühle im Külzbachtal Keidelheim erreichen wir das Tagesziel Simmern. vorbei bis zur Gemeinde Neuerkirch (Historischer Ortskern mit Kulturhistorischem Museum und Hofladen). -

Theaterabende in Kümbdchen Vom 10
Mitteilungsblatt Nr. 2 Freitag, 10. Januar 2020 Jahrgang 01 Tanzgruppe „Saphir“ vom TuS Rheinböllen Jahresrückblick 2019 mit Stadtbürgermeisterin Bernadette Jourdant Verbandsbürgermeister Michael Boos über Ziele und Aufgaben der Verbandsgemeinde Simmern - Rheinböllen Tanzgruppe „Youngstars“ der AWO Rheinböllen Jugendleiter Serdar Öz und Stadteilkoordinatorin Nadja Hoffmann über Jung und Alt Ehrung ehemaliger Ratsmitglieder Verabschiedung Verbandsgemeinde Bürgermeister Arno Imig und Verleihung des Ehrenamtspreises der Stadt Rheinböllen Tanzgruppe „Blackout“ vom TuS Rheinböllen Gemälde-Ausstellung der Künstlerin Teresa Dura aus Kisselbach Für Ihr leibliches Wohl ist mit Kaffee, Kuchen und Herzhaftem bestens vorgesorgt Theaterabende in Kümbdchen Vom 10. – 12. Januar 2020 Aufführungen: Freitag:10.01.2020 - 19.00 Uhr Samstag: 11.01.2020 - 19.30 Uhr – Anschließend Musik Sonntag: 12.01.2020 - 18.30 Uhr Karten für die Samstag-Aufführung sind auch im Vorverkauf erhältlich. Der Förderverein des TV Kümbdchen-Keidelheim freut sich auf Ihren Besuch. Aktuelle Informationen auch unter www.sim-rhb.de 2 2I2020 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen Freitag, 10. Januar 2020 Bereich ehemalige Verbandsgemeinde Simmern Notdienst Wasserversorgung ........................................ 01713348371 NOTRUFE Notdienst Abwasserbeseitigung..................................... 01712114354 Notdienst Nahwärmeversorgung.................................. 01751805045 UND BEREITSCHAFTSDIENSTE RHEINHUNSRÜCK WASSER; ZWECKVERBAND; DÖRTH Die Wasserversorgung der Stadt Rheinböllen -

Mitteilungen Der
Mitteilungen der Jahrgang 50 DONNERSTAG, 24. September 2020 Nummer 39 Sohren Mitteilungen für den Bereich der Verbandsgemeinde Kirchberg/Hunsrück und ihre Gemeinden Bärenbach, Belg, Büchenbeuren, Dickenschied, Dill, Dillendorf, Gehlweiler, Gemünden, Hahn, Hecken, Heinzenbach, Henau, Hirschfeld, Kappel, Kirchberg, Kludenbach, Laufersweiler, Lautzenhausen, Lindenschied, Maitzborn, Metzenhausen, Nieder Kostenz, Niedersohren, Niederweiler, Ober Kostenz, Raversbeuren, Reckershausen, Rödelhausen, Rödern, Rohrbach, Schlierschied, Schwarzen, Sohren, Sohrschied, Todenroth, Unzenberg, Wahlenau, Womrath, Woppenroth, Würrich. Sprechzeiten der Verwaltung: montags, dienstags, mittwochs und freitags 8.30-12.00 Uhr, donnerstags (durchgehend) 8.00-18.00 Uhr; Einwohnermeldeamt jeden 1. Samstag im Monat 9.00-12.00 Uhr; Telefon 0 67 63 / 910-0, Fax 0 67 63 / 910 699, Internet: www.kirchberg-hunsrueck.de, E-Mail: [email protected] Kirchberg/Hunsrück 2 Nr. 39/2020 Notrufe / Bereitschaftsdienste ■ Polizei, Verkehrsunfall, Überfall Informationen Heike Wilhelm, Pflegedienstleitung Erreichbarkeiten der Polizei Simmern Tel........................................................................................ 06763-30110 In dringenden Fällen: Notruf ............................................................... 110 E-mail [email protected] In allen anderen Fällen: Pflegestützpunkt Festnetz Schutz- und Kriminalpolizei ............................ 06761 / 921-0 Konrad-Adenauer-Str. 32, 55481 Kirchberg Telefon: ............................................................................. -

Aus Der Redaktion
Einwohnerstatistik Neues von den KiJuBies Bieberner Gesichter Alfred Wagner Seite 2 Seite 4 Seite 12 Ausgabe Januar 2017 Informationen für die Gemeinde Biebern Aus der Redaktion findet weltweite und überregionale Beachtung. Über die Homepage www.biebern.de ist sie überall verfügbar. Zuschriften aus Südamerika (Brasilien) und Nordamerika (USA, Kanada) zeigen, dass die Nachkommen der Hunsrücker Auswanderer an Informationen und Nachrichten aus der alten Heimat sehr interessiert sind. Auch ehemalige Bieberner der näheren und weiteren Umgebung lesen die Nachrichten. Beachtung findet die Zeitung bei der Kreis- und der Verbandsgemeindeverwaltung. Gunther Lämmermann mit seinen Vorstand gebührt ein besonderes Lob für dieses Projekt. Finanziert werden die „Bieberner Nachrichten“ vom Förderverein. Zukünftig ist Werner Rockenbach als Redakteur für die „Bieberner Nachrichten“ verant- erschienen und nun liegt die 10. wortlich. Ausgabe vor Ihnen. Der Förderverein Wünschenswert sind viele Beiträge aus Zum neuen Jahr 2017 wünscht der der Freiwilligen Feuerwehr mit dem 1. dem Dorfgeschehen und den Vereinen Förderverein allen Bürgerinnen und Vorsitzenden Gunther Lämmermann aus Biebern und dem Biebertal. Bürgern ein glückliches und und seinen Vorstandskollegen waren Mitarbeiter und Redakteure mit Text- gesundes neues Jahr. Diese neue die Initiatoren dieser Zeitung. Seither und Bildbeiträgen sind immer herzlich Ausgabe der „Bieberner Nachrichten“ wurden viele interessante Beiträge willkommen. WRo ist eine Jubiläumsausgabe. Die erste einer breiten Öffentlichkeit zugänglich Ausgabe ist im Oktober 2014 gemacht. Man kann sagen, die Zeitung 1 Einwohnerstatistik Biebern Von Werner Rockenbach In regelmäßigen Abständen Einwohnerstatistik Biebern, 31. Dezember 2016 publiziert das statistische Landesamt in Bad Ems aktuelle Daten zur Alter männlich Prozent weiblich Prozent Summe Prozent statistischen Infrastruktur in bis 9 Jahre 16 4,98% 15 4,67% 31 9,66% Rheinland-Pfalz. -

Gebäude Und Wohnungen Am 9. Mai 2011, Nieder Kostenz
Gebäude und Wohnungen sowie Wohnverhältnisse der Haushalte Gemeinde Nieder Kostenz am 9. Mai 2011 Ergebnisse des Zensus 2011 Zensus 9. Mai 2011 Nieder Kostenz (Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis) Regionalschlüssel: 071405004105 Seite 2 von 32 Zensus 9. Mai 2011 Nieder Kostenz (Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis) Regionalschlüssel: 071405004105 Inhaltsverzeichnis Einführung ................................................................................................................................................ 4 Rechtliche Grundlagen ............................................................................................................................. 4 Methode ................................................................................................................................................... 4 Systematik von Gebäuden und Wohnungen ............................................................................................. 5 Tabellen 1.1 Gebäude mit Wohnraum und Wohnungen in Gebäuden mit Wohnraum nach Baujahr, Gebäudetyp, Zahl der Wohnungen, Eigentumsform und Heizungsart .............. 6 1.2 Gebäude mit Wohnraum nach Baujahr und Gebäudeart, Gebäudetyp, Zahl der Wohnungen, Eigentumsform und Heizungsart ........................................................... 8 1.3.1 Gebäude mit Wohnraum nach regionaler Einheit und Baujahr, Gebäudeart, Gebäudetyp, Zahl der Wohnungen, Eigentumsform und Heizungsart ..................................... 10 1.3.2 Gebäude mit Wohnraum nach regionaler Einheit und Baujahr, Gebäudeart, Gebäudetyp, -

16. April 2019 Zeit: 19:40 Uhr Ort: Gemeindehaus Biebern Sitzungsbeginn: 19:40 Uhr Sitzungsende: 21.20 Uhr
Gemeinderat Biebern ______________________________________________________________________________________________ Termin: Dienstag, 16. April 2019 Zeit: 19:40 Uhr Ort: Gemeindehaus Biebern Sitzungsbeginn: 19:40 Uhr Sitzungsende: 21.20 Uhr Protokoll: Werner Rockenbach Anwesenheit: Klaus Adamus Michael Bach Helmut Jakobi Gunther Lämmermann Bruno Lauer Werner Rockenbach Wolfgang Wendling Mario Kasper (entschuldigt) Andreas Wust (entschuldigt) Tagesordnung (öffentliche Sitzung) 1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit des Gemeinderates 2. Genehmigung der letzten Sitzungsniederschrift – öffentlicher Teil – 3. Bildung eigener Forstreviere von Bergenhausen, Budenbach, Pleizenhausen 4. Gründung Kindergarten Zweckverband Simmern-Rheinböllen 5. Wahlen 2019 - Zusammensetzung des Wahlvorstandes - Diensteinteilung am Wahltag - Informationen interessierter Bürgerinnen und Bürger über die Arbeit im Gemeinderat 6. Biebertaler Wandertag am 28. April 2019 (Vorbereitung) 7. Verschiedenes Tagesordnung (nichtöffentliche Sitzung) 1. Genehmigung der letzten Sitzungsniederschrift – nichtöffentlicher Teil – 2. Verschiedenes 1 Öffentliche Sitzung 1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit des Gemeinderates Ortsbürgermeister Gunther Lämmermann stellt die ordnungsgemäße Einladung und Beschlussfähigkeit fest. 2. Genehmigung der letzten Sitzungsniederschrift Die Sitzungsniederschrift (öffentlicher Teil) vom 19. März 2019 wird einstimmig genehmigt. 3. Bildung eigener Forstreviere von Bergenhausen, Budenbach, -

Vollständige Ausgabe
»/ Nachdem der im Jahre 1901 gegründete Hunsrücker Geschichtsverein seit 1958 wieder ins Leben gerufen ist, hat sich eine beträchtliche Schar vereinigt, um nicht nur tätig, sondern auch finanziell mitzuhelfen, unsere Hunsrücker Heimat auf allen Gebieten zu erforschen, sei es auf dem Gebiete der Ge= schichte, der Volkskunde, der Kunstgeschichte und auch der Naturkunde. Die bei der Wiederbegründung gestellte Aufgabe, die Liebe zur Hunsrücker Heimat zu wecken und zu vertiefen, die Geschichtskenntnisse auszubauen, die Heimatforschung anzuregen, zu unterstützen und zu fördern, die Samm= lung von Archivalien, Funden, Quellen und Urkunden fortzusetzen und die Herausgabe von Schrifttum zu ermöglichen, wurde bis jetzt voll und ganz erfüllt. Es würde zu weit führen, alle bisher meist in der Stille geleistete Arbeit ganz zu registrieren, doch sollten einige Tatsachen hier festgehalten werden. Neben einer Reihe von Aufsätzen über die obengenannten The= men in Tageszeitungen, Zeitschriften und Heimatkalendern, haben eine Reihe von Mitarbeitern im Rahmen des Kreisvolksbildungswerkes die Er= gebnisse ihrer Forschungen dargelegt. Unter anderem wurden folgende The= men behandelt: Hunsrücker Kirchenbarock, Hunsrücker Burgen und Schlös= ser, die Pflanzenwelt des Hunsrücks, Geheimnisse eines Bachtales, Liselotte von der Pfalz, das Kloster Ravengiersburg, die Einnahme des Hunsrücks durch die Amerikaner 1945, die Französische Revolution und ihre Bedeutung für den Hunsrück, unsere Flurnamen als Quellen für die Geschichte des Hunsrücker Bodens, Tiere und Pflanzen der Urzeit aus Fundorten des Huns= rücks, kreuz und quer durch den Soonwald, der schöne Hunsrück. Für die Schulen des Kreises Simmern wurde eine kleine Heimatkunde geschrieben, ein größeres Werk gleicher Art ist in Arbeit. Zusammengetragen wird die Geschichte der Schulen des Kreises Simmern und eine zusammenfassende Arbeit über das Zisterzienserinnen=Nonnenkloster Kumbd ist abgeschlossen. -
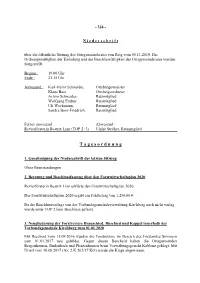
T a G E S O R D N U N G
- 324 - N i e d e r s c h r i f t über die öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates von Belg vom 05.11.2019. Die Ordnungsmäßigkeit der Einladung und die Beschlussfähigkeit des Ortsgemeinderates wurden festgestellt. Beginn : 19.00 Uhr Ende : 21.15 Uhr Anwesend : Karl-Heinz Schneider, Ortsbürgermeister Klaus Bast, Ortsbeigeordneter Achim Schneider, Ratsmitglied Wolfgang Endres, Ratsmitglied Uli Weckmann, Ratsmitglied Sandra Boor-Friedrich, Ratsmitglied Ferner anwesend : Abwesend : Revierförsterin Beatrix Linn (TOP 2+3) Ulrike Ströher, Ratsmitglied T a g e s o r d n u n g 1. Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung Ohne Beanstandungen 2. Beratung und Beschlussfassung über den Forstwirtschaftsplan 2020 Revierförsterin Beatrix Linn erklärte den Forstwirtschaftsplan 2020. Der Forstwirtschaftsplan 2020 ergibt ein Fehlbetrag von 1.250,00 €. Da die Beschlussvorlage von der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchberg noch nicht vorlag wurde unter TOP 2 kein Beschluss gefasst. 3. Neugliederung der Forstreviere Brauschied, Buschied und Kappel innerhalb der Verbandsgemeinde Kirchberg zum 01.01.2020 Mit Bescheid vom 15.09.2016 wurden die Forstreviere im Bereich des Forstamtes Simmern zum 01.01.2017 neu gebildet. Gegen diesen Bescheid haben die Ortsgemeinden Bergenhausen, Budenbach und Pleizenhausen beim Verwaltungsgericht Koblenz geklagt. Mit Urteil vom 30.08.2017 (Az: 2 K 262/17.KO) wurde die Klage abgewiesen. - 325 - Auch die Berufung beim OVG Koblenz (Az: 8 A 10826/18) wurde abgewiesen. Eine Revision wurde nicht zugelassen, so dass die Revierneugliederung, die mit Bescheid vom 15.09.2016 zum 01.01.2017 festgesetzt wurde, rechtskräftig ist. Zwischenzeitlich haben die drei zuvor genannten Ortsgemeinden nach § 9 Landeswaldgesetz (LWaldG) ein Revierabgrenzungsverfahren eingeleitet und mit Zustimmung aller Waldbesitzenden des gleichen Forstrevieres die Abgrenzung eines eigenen Forstrevieres mit Schreiben vom 24.03.2019 beantragt.