Band 4 Karlsruhe 2007 Berichte Der Botanischen Arbeitsgemeinschaft
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Und LSG Burgau
SACH ZIM Natura 2000 und LIFE-Natur Projektbeteiligte des LIFE-Projekts Die alte Flussaue landseits der Dämme war nun weitgehend serempfindliche Baumarten: Hainbuche, Buche, Wald-Kiefer, frei von Hochwasser und konnte intensiv bewirtschaftet wer- Robinie, Birke, Berg-Ahorn, Spitz-Ahorn, Winter-Linde. Vieler- Natura 2000 ist das Naturschutzkonzept der Projektleitung: Regierungspräsidium Karlsruhe (RPK), Referat Naturschutz den. Aus der urwüchsigen Auenlandschaft entstand das heutige orts wurden sie zudem angepflanzt. Im Gewann Ackerheck ist Europäischen Union (EU) zur Erhaltung der und Landschaftspflege Kulturland mit Wäldern, Äckern, Wiesen und Obstbäumen– noch ein ehemaliger Mittelwald erhalten11 . Früher wurden biologischen Vielfalt in Europa. Grundlage Projektmanage- und dem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ausgebag- hier nur Einzelstämme und Brennholz entnommen: So ent- ist ein grenzüberschreitendes Netz aus natür- ment: River Consult, Karlsruhe gerten Knielinger See. stand dieser strukturreiche und vielschichtige Waldtyp. Einige lichen und naturnahen Lebensräumen von europaweit seltenen alte Eichen und Hainbuchen haben bis heute überdauert, und bedeutenden Pflanzen- und Tierarten der Fauna-Flora- Projektpartner: Karlsruhe, Philippsburg Rheinstetten, manche schon so morsch, dass Mittel- und Buntspechte ihre Habitat- und der Vogelschutz-Richtlinie: die FFH- und Vogel- Dettenheim, Eggenstein-Leopoldshafen, Linkenheim- Der Rheinpegel Maxau Bruthöhlen darin zimmern können. Schutzgebiete, gemeinsam auch Natura 2000-Gebiete genannt. -

Faltblatt Altrhein Maxau Burgau
ZIM Natura 2000 und LIFE-Natur Projektbeteiligte Die alte Flussaue landseits der Dämme war nun weitgehend Standorte angepasste Baumarten: Buche, Wald-Kiefer, Birke, frei von Hochwasser und konnte intensiv bewirtschaftet wer- Berg-Ahorn, Winter-Linde. Vielerorts wurden sie auch ange- Natura 2000 ist das Naturschutzkonzept der Projektleitung: Regierungspräsidium Karlsruhe (RPK), Referat Naturschutz den. Aus der urwüchsigen Auenlandschaft entstand das heutige pflanzt. Im Gewann Ackerheck ist noch ein ehemaliger Mittel- Europäischen Union (EU) zur Erhaltung der und Landschaftspflege Kulturland mit Wäldern, Äckern, Wiesen und Obstbäumen– wald erhalten11 . Früher ließ man hier Einzelbäume zu Bau- und biologischen Vielfalt in Europa. Grundlage Projektmanage- und dem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ausgebag- Möbelholz heranwachsen. Die restlichen Bäume wurden alle 10 ist ein grenzüberschreitendes Netz aus natür- ment: River Consult, Karlsruhe gerten Knielinger See. bis 30 Jahre für Brennholz auf den Stock gesetzt und trieben lichen und naturnahen Lebensräumen von europaweit seltenen mehrschäftig wieder aus. So entstand dieser strukturreiche Wald- und bedeutenden Pflanzen- und Tierarten der Fauna-Flora- Projektpartner: Karlsruhe, Philippsburg Rheinstetten typ. Einige alte Eichen und Hainbuchen haben bis heute Habitat- und der Vogelschutz-Richtlinie: die FFH- und Vogel- Dettenheim, Eggenstein-Leopoldshafen, Linkenheim- Der Rheinpegel Maxau überdauert: Manche sind schon so morsch, dass Mittel- und Schutzgebiete, gemeinsam auch Natura -

Zur Kenntnis Einiger Röhrichtgesellschaften Des Oberrheingebietes
Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl. Band 32 S. 53-95 Karlsruhe, 15. 8. 1973 Zur Kenntnis einiger Röhrichtgesellschaften des Oberrheingebietes von G eorg Philippi Mit 1 Abbildung (Aus den Landessammlungen für Naturkunde, Karlsruhe) Inhaltsverzeichnis Summary 53 A. Einleitung 53 B. Zur Systematik der Röhrichtgesellschaften 54 C. Ordnung Phragmitetalia (Großröhrichte) 56 D. Ordnung Nasturtio-Glycerietalia (Kleinröhrichte) 77 E. Ordnung Magnocaricetalia (Großseggenrieder) 91 F. Übersicht der dargestellten Röhrichtgesellschaften 92 G. Literatur 93 Summary Some reedswamp communities (Class Phragmitetea) of the upper Rhine area are described on the basis of Braun-Blanquet's principles. A survey is given on p. 92. A. Einleitung Über Röhrichtgesellschaften des Oberrheingebietes war bisher recht wenig bekannt. Einzelne Aufnahmen und kleine Tabellen finden sich bei O berdörfer (1936), K napp (1946), v. Rochow (1951), Oberdörfer (1957), K app u. Schaefer (1962), K orneck (1963), L üpnitz (1967), Philippi (1969 a, b) und K rause (1971). Diese Aufnahmen und Tabellen vermitteln jedoch ein sehr lückenhaftes, vielfach sogar falsches Bild dieser Gesellschaften. In den letzten Jahren wurde aufgrund neuerer Beobachtungen die Gliederung der Röhrichte, gerade der Groß röhrichte verfeinert. Das ältere Aufnahmematerial erscheint so nur noch bedingt verwend bar. In der vorliegenden Arbeit sollen Beobachtungen, Aufnahmen und Tabellen einiger Röhricht- gesellschaften des Gebietes mitgeteilt werden. Von zahlreichen Gesellschaften fehlt jedoch noch Material aus größeren Gebieten. Gesellschaften wie das Phragmitetum oder das Oenantho- Rorippetum amphibiae, die flächenmäßig in den Altrheinlandschaften große Bedeutung haben, werden hier nicht behandelt, andere wie das Phalaridetum oder die Typha angustifolia- Bestände nur kurz erwähnt. Über Röhrichtbestände mit Schoenoplectus tabernaemontani, Sch. triqueter und Bolboscboenus maritimus wurde schon an anderer Stelle berichtet (Philippi 1969 a). -

Grenzen & Grenzsteine
Grenzsteine lesen Verbindliche Grenzen schaffen Frieden Findest du die Grenzsteine? Grenzen & Grenzsteine, die als rechtlich verbindlich galten, standen Spannende Grenzsteinrallye rund um den Sportplatz des 6 unter besonderem Schutz. So konnten viele Streitigkeiten SSC Neuburgweier – Dauer ca.30 min. – ab 8 Jahren Grenzstein Nr. 6 vermieden werden. Doch so alt auch das Markieren der Grenzsteine Grenzen ist, so alt ist auch das C N „Verrücken“ der Grenzsteine. 1. Start: Ecke Auer Str. / Waldweg Sogenannte Grenzzeugen inzeugen Geh von der Straßenkreuzung 15 Schritte in den Waldweg Civitas Neuburgweier– enzste Gr elchen) Civitas ist der lateinische sollten den korrekten Grenz- (Tontäf hinein und dann 7 Schritte nach links. Welche Nummer Ausdruck für Gemeinde verlauf im Zweifelsfall wieder steht auf der Vorderseite, der Weirer Seite des Grenz- herstellen können. Grenz- steins? N o zeugen konnten kleine Ton- A 10 W 13 K 9 W tafeln, Figuren oder Scherben Die Bedeutung des sein, die man unter oder ganz 2. Beim Hühnerstall Neuburgweirer in der Nähe von Grenzsteinen Grenzsymbols ist unklar Geh weiter in den Waldweg hinein. Kurz vor der nächsten vergrub. Civitas Esslingen Biegung findest du linkerhand einen Hühnerhof. Zwischen In einigen Gegenden war es üblich, die Verantwortung für den Hühnerställen befindet sich ein weiterer Grenzstein. Schön von vorn und hinten die Grenzsteine gewählten, alteingesessenen Bürgern, Was befindet sich vor dem Grenzstein? Grenzsteine sind beidseitig beschriftet. Die Beschriftung sogenannten Feldgeschworenen anzuvertrauen. Nur sie U Hundehüe E Brunnen C Zwerg besteht aus den Anfangsbuchstaben der Gemeinde, einer wussten, wo sich die Grenzzeugen befanden und hatten fortlaufenden Nummer und einem gemeindetypischen neue Steine korrekt zu setzen. -

EPPLESEE: Stadtranderholung: TAG DES GLÜCKS
Nummer 13 Donnerstag, 28. März 2019 18. Jahrgang Stadtranderholung 2019 - jetzt geht‘s los Anmeldebeginn: 01.04.2019 Anmeldeschluss: 31.05.2019 Die Stadtranderholung ist in Rheinstetten zu einer traditionellen Einrichtung der Kindererholung im Nahgebiet geworden und findet auf dem Gelände der Keltenhalle statt. Eltern haben die Möglichkeit, eine, zwei oder drei Wochen nach freier Wahl zu belegen. Das Angebot richtet sich an alle Kinder aus Rheinstetten. Aber auch auswärtige Kinder mit dem Karlsruher Kinderpass können sich zur Stadtranderholung anmelden. Alter: Und so funktioniert die Anmeldung: 5 - 12 Jahre Ab dem 01.04.2019 entweder mit dem ausgefüllten An- Termine: meldebogen und Abgabe per Fax, Mail oder Post im Kinder 29. Juli bis 06. September 2019 Jugend & Familien Büro in der Hauptstraße 2 oder online Werktags von 7.45 Uhr - 16.45 Uhr unter www.unser-ferienprogramm.de/rheinstetten. Bitte beachten: Die Anmeldungen müssen bis zum Kosten: 31.05.2019 bei uns eingegangen sein. Später einge- 65 € pro Woche, hende Anmeldungen werden nicht berücksichtigt. Geschwisterkinder in der gleichen Woche 32,50 € Weitere Informationen erhalten Sie beim Leistungen: Kinder Jugend & Familien Büro der Stadt Rheinstetten, Betreuung, Essen, Getränke und Ausflüge. Telefon 07242/ 9514-461. Stadtranderholung: TAG DES GLÜCKS: EPPLESEE: Infoveranstaltung Beliebtes Freizeitziel wird am 03.04.2019 für Jugend brachte zum ersten Winterbadesee interessierte Betreuer/innen am 20.03.2019 Glück in Deutschland AUF SEITE 8 AUF SEITE 9 AUF SEITE 11 Seite 2 Nr. 13/2019 Let´s putz - Aktion am Samstag 30. März Start um 9 Uhr / Gemeinsam für eine saubere Umwelt! Der Aufruf der Stadtverwaltung, am kommenden Samstag ge- in welchen die Müllstandorte meinsam unsere Landschaft von Müll und Unrat zu befreien, ist markiert werden können - die auf eine tolle Resonanz gestoßen - rund 200 Kinder, Jugendliche Pläne bitte am Ende in der Kel- und Erwachsene haben sich angemeldet. -

Unser Team Für Malsch, Sulzbach, Völkersbach Und Waldprechtsweier
26. Mai KOMMUNALWAHL 2019 Unsere Spitzen- kandidatin Unser Team für Malsch, für Europa Sulzbach, Völkersbach 26. Mai 2019 Peter Haas Patrick Gleißle Ercan Badur Michael Gerber Hans-Jürgen Fatih Kühlmeier Dr.-Eugen-Essig-Str. 30, Kirschenweg 18, Am Federbach 8, Am Kaufmannsbrunnen Borchert Franz-Belzer-Str. 22, und Waldprechtsweier Lieferantenmanager Verwaltungsfachwirt , Selbstständig m. 19, Angestellter, 56, Hauptstr. 12a, Auszubildender zum Katharina Barley Qualität, 57, verh., stellv. Hauptamtsleiter, BaSe Taxi GmbH, verh., 2 Ki., Mitgl. in Küchenleiter, 53, staatl. anerkannten 2 Ki., SPD-Vorstand, 31, led., GroKaGe, B.B. Reifenservice, 45, verschiedenen verh., 4 Ki. Erzieher, 23, led., Vors. Unser komplettes Wahlprogramm unter : stellv. Vorsitzender Waldenfelser verh., 2 Ki, Türkischer Malscher Vereinen, Jugendhausverein www.spd-malsch.de CulturClub Malsch, Nachtschreck u. ARGE Kulturverein Landesjagdverband Malsch e.V. Schwarzwaldverein Waldprechtsweier Kreistagswahl 26. Mai 2019 Unsere Kandidaten für den Landkreis Karlsruhe Veronika Wehr- Thomas Schick Dagmar Giese Heike Staubringer Steffen Schoch Dr. Martin Burkart Stefan Tiede Simone Hermann Volker Paulini Schwander Waldprechtsweier, Sekretärin, verh., 3 Ki., Franz-Belzer-Straße 9, Allmendstr. 13, Bank- Melanchthonstr. 19, Freiolsheimer Str. 14, Lehrerin, 41, verh., Kreuzstr. 1, IT Bahnhofstr. 17, Beamter i.R., 52, GR u. Gemeinderätin, Turn- Pfarramtssekretärin, kundenberater, 28, Arzt, 51, verh., 2 Ki., selbst. Dozent, Handels- 2 Ki., DLRG Malsch, Kaufmann, 55, verh., Lehrerin -
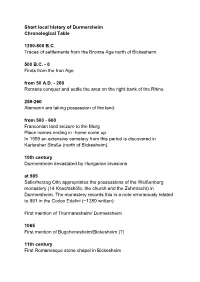
Short Local History of Durmersheim Chronological Table 1200-800 B.C. Traces of Settlements from the Bronze Age North of Bickeshe
Short local history of Durmersheim Chronological Table 1200-800 B.C. Traces of settlements from the Bronze Age north of Bickesheim 500 B.C. - 0 Finds from the Iron Age from 50 A.D. - 260 Romans conquer and settle the area on the right bank of the Rhine. 259-260 Alemanni are taking possession of the land. from 500 - 600 Franconian land seizure to the Murg Place names ending in -home come up. In 1959 an extensive cemetery from this period is discovered in Karlsruher Straße (north of Bickesheim). 10th century Durmersheim devastated by Hungarian invasions at 985 Salierherzog Otto appropriates the possessions of the Weißenburg monastery (14 Knechtshöfe, the church and the Zehntrecht) in Durmersheim. The monastery records this in a note erroneously related to 991 in the Codex Edelini (~1280 written): First mention of Thurmaresheim/ Durmersheim 1065 First mention of Bugchenesheim/Bickesheim (?) 11th century First Romanesque stone chapel in Bickesheim 1156 First mention of Wirmeresheim/Würmersheim 1250 First mention of the Knights of Durmersheim 1260/80 Durmersheim becomes 1259 Baden. Margrave Rudolf I of Baden and Kunigunde of Eberstein build an early Gothic church in Bickesheim instead of the old Romanesque chapel. 1318 The oldest documented mention of the church in Bickesheim 1388 The margravial "Schloss Rohrburg" is mentioned for the first time. 1473 The first parish church is built (in the parish garden on the Roman road, where the highest point of the then built-up area was located). 1480 Earliest mention of the estate of the Counts of Eberstein 1481 Oldest fiefdom letter about the Rohrburg (to Otto von Seckendorf) 1510 "Renovation" (description of the margrave's rights and possessions) about Durmersheim 1514 The community of Durmersheim addresses complaints to Margrave Philipp I. -

Im Ferienprogramm Der Villa Federbach
GEMEIND E ANZE IGER Nr. 32 • 107. Jahrgan g • 8.8. 2019 mit Amtsblatt der Gemeinde Malsch Einzelpreis 0,80 € · Bezugspreis monatlich 3,15 € Druck und Verlag: Druckerei Stark GmbH • Benzstraße 24 • 76316 Malsch Telefon 07246 922828 • Telefax 07246 9228 79 Internet: www.druckerei-stark.de • E-Mail: [email protected] „Natur pur“ im Ferienprogramm der Villa Federbach „Natur pur“ hieß das Motto beim Ferienprogramm des Jugendhauses Villa Federbach. Die Idee dazu kam laut Leiterin Christina Rübenacker durch die Nähe der Einrichtung zum Federbach. Mit ein Höhe - punkt war es für die sieben- bis zehnjährigen Kinder am Freitag, mit wasserfesten Schuhen ausgestattet durch das Gewässer zu laufen. Dabei sammelten sie, wie bereits bei einem Ausflug am Montag, zurück - gelassenen Müll ein. Durch das Einsammeln von Unrat wurde laut Rübenacker auch das Bewusstsein der Kinder für Umweltschutz geschult. So machten sie sich gegenseitig etwa darauf aufmerksam, selbst kein Plastik in die Umgebung zu werfen. Am mit Bäu - men gesäumten Bachlauf befassten sie sich auch mit der Heilkraft des Waldes und ordneten Aussagen darüber verschiedenen Bildern zu. Gelernt haben sie dabei auch, wie ein Zehnjähriger berichtet, dass Abgase dem Wald nicht gut tun. Da das Angebot fünf Tage dauert, fordere es laut Rübenacker Kinder wie auch Betreuer. So müssten alle morgens früh aufstehen und seien den ganzen Tag auf den Beinen. Neu war, dass Rübenacker, ihr Kollege Jörg Höger und Timo Strnadl, der ein freiwilliges soziales Jahr absolviert, diesmal viele Helfer hatten. Neben den Ferienjobbern Kim und Sophia waren dies Ian, Han - nah, Joleen, Niklas, Ann-Kathrin und Jonas. Da sie alle zu alt für das Angebot bis zehn Jahren sind, halfen sie beim Betreuen der Kinder mit. -
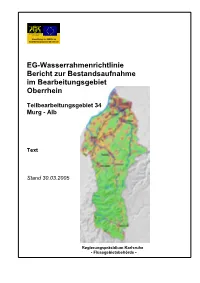
EG-Wasserrahmenrichtlinie Bericht Zur Bestandsaufnahme Im Bearbeitungsgebiet Oberrhein
REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE Umsetzung der WRRL im Bearbeitungsgebiet Oberrhein EG-Wasserrahmenrichtlinie Bericht zur Bestandsaufnahme im Bearbeitungsgebiet Oberrhein Teilbearbeitungsgebiet 34 Murg - Alb Text Stand 30.03.2005 Regierungspräsidium Karlsruhe - Flussgebietsbehörde - Bearbeitungsstand 30.03.2005 Impressum: Koordination: Regierungspräsidium Karlsruhe, Flussgebietsbehörde Abteilung Umwelt, Karlsruhe Bearbeitung und Gewässerdirektion Nördlicher Oberrhein Bereich Karlsruhe Gestaltung: Fachliche Beteiligung: Regierungspräsidien Freiburg und Karlsruhe Landkreise: Calw, Enz, Freudenstadt, Karlsruhe, Ortenau, Rastatt Stadtkreise: Baden-Baden, Karlsruhe Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Karlsruhe Geschäftsführung Wasserrahmenrichtlinie beim Bereich Heidelberg Gewässerdirektion Nördlicher Oberrhein Bereich Freudenstadt Gewässerdirektion Südlicher Oberrhein/Hochrhein Bereich Offenburg Landesanstalt für Umweltschutz, Karlsruhe Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, Freiburg Textband: WRRL-Bestandsaufnahme Teilbearbeitungsgebiet 34 Murg - Alb Seite II von 64 Bearbeitungsstand 30.03.2005 Inhaltsübersicht Kartenverzeichnis im Anhang V Tabellenverzeichnis im Anhang VI Verzeichnis der Abkürzungen VII 0 Einführung 1 1 Allgemeine Beschreibung des Teilbearbeitungsgebietes 34 Murg - Alb 4 1.1 Übersicht und Basisinformationen 4 1.2 Lage und Grenzen 5 1.3 Raumplanung und Landnutzung 5 1.4 Naturräume 5 1.5 Gewässer 6 1.5.1 Oberflächengewässer 6 1.5.1.1 Hauptstrom Rhein 6 1.5.1.2 Nebengewässer 7 1.5.1.3 Seen 7 1.5.1.4 Sonstige Gewässer (Talsperren, -

Sachverständigen Büro Für Kfz.- Technik Karlheinz Giese Am Federbach 16, 76461 Muggensturm BEAUFTRAGUNG + ABTRETUNG (Erfül
Sachverständigen Büro für Kfz.- Technik Tel.: +49(0)7222 – 50 17 105 Karlheinz Giese Am Federbach 16, 76461 Muggensturm Mobil.: +49(0)171 – 362 4357 Karosserie u.-Fahrzeugbauer-Meister / [email protected] öffentlich bestellt und vereidigter Sachverständiger www.sv-buero-malsch.de der Handwerkskammer Karlsruhe BEAUFTRAGUNG + ABTRETUNG (erfüllungshalber) ZAHLUNGSANWEISUNG Aus Gründen der Schadenfeststellung, der Beweissicherung oder zur Fahrzeugbewertung, sowie eines Wertgutachten, oder nach einem Unfallschadenereignis, beauftrage ich das Kfz -Sachverständigen Büro Karlheinz Giese, ein Gutachten zu erstatten. Die Schadensersatz Ansprüche aus dem unten näher bezeichneten Verkehrsunfall trete ich sicherungshalber, gegen den Halter, Fahrer sowie die in der Regulierungspflicht stehende Versicherungsgesellschaft, in voller Höhe meiner Honorarforderung incl. Mehrwertsteuer, unwiderruflich, an das Sachverständigenbüro Karlheinz Giese ab. Das Sachverständigenbüro Giese ist berechtigt, diese Abtretung bei den Anspruchsgegnern offen zu legen, sowie die der Sicherung dienenden, abgetretenen Ansprüche, gegenüber den Anspruchsgegnern, im eigenen Namen geltend zu machen. Wenn der Auftraggeber das Sachverständigenhonorar zum Zeitpunkt der Fälligkeit gar nicht, oder nur Teilweise bezahlt hat. In diesem Fall weise ich hiermit die Anspruchsgegner unwiderruflich an, die Honorargebühren direkt -und in voller Höhe, an das Sachverständigenbüro Giese, zu bezahlen. Durch diese Sicherungsabtretung werden die Ansprüche des SV – Büro Giese, aus dieser Beauftragung, -

Altrhein Maxau“
Rund – halbrund – um den „Altrhein Maxau“ (Beitrag im pdf-Format) Vorab: Bevor Sie sich auf den Weg machen, betrachten Sie das Video mit dem Titel „Rund um den Altrhein Maxau“. Der Film führt Sie in die vor Ihrer Haustür liegende Natur, verbunden mit der Hoffnung, dass Sie selbst einmal Ihren Weg dahin finden. Eine Anmerkung kann an dieser Stelle nicht ausbleiben: Nehmen Sie nicht nur im Leimgrubengrund besondere Rücksicht auf die Natur, die Sie umgibt. Leinen Sie Ihre Hunde an, vertiefen Sie ihren Aufenthalt nicht bei einem Lager z.B. an den Aussichtspunkten. Und bedenken Sie, dass im Schutzgebiet eine Gefahr von Astbruch und Baumfall ausgehen kann. Geschichte: Das Naturschutzgebiet “Altrhein Maxau“ bewahrt seit 1980 den Rest des Altrheinarmes Katersgrund als Refugium einer auetypischen Pflanzen- und Tierwelt. Eigentümer des Katersgrund waren einst linksrheinische Gemeinden, u.a. die Gemeinde Pforz. 1817 brachte die Geradlegung des Rheins diese Rheinschlinge von der bayerischen auf die badische Seite. Der Markgraf Maximilian von Baden erwarb 1835 den Altrheinarm zusammen mit dem Abtsgründl und dem Langengrund. Nördlich seines Besitzes teilte ab 1862 eine Verkehrstrasse von Knielingen an den neuen Rhein den alten Rheinlauf in Hafen (heute Yachthafen) und Katersgrund (heute Altrhein Maxau). 1938 folgte die Errichtung eines Dammes eigens für die Bahn. Auf der alten Trasse – heute B10 - verläuft der Straßenverkehr. Am südlichen Rand des Bahndammes verläuft der erste Teil dieses Weges. Bis 1957 blieb die Landschaft draußen am Rhein – konzentriert auf den betrachteten Bereich - unberührt von großen Veränderungen. Dann genehmigte die Stadt dem Eigentümer Markgraf von Baden die Auskiesung des Langengrund und des Katersgrund. 1964 beantragte Prof. -

Zum Ferienprogrammheft
Ferienprogramm 2021 Hurra – Sommerferien! Liebe Kinder und Jugendliche, auch wenn vieles immer noch nicht ist, wie es einmal war, eins ist sicher: Die nächsten Sommerferien kommen bestimmt. Und mit ihnen unser Ferienprogramm! Wie gewohnt haben wir mit der Unterstützung von Vereinen, Firmen und in diesem Jahr auch mit Hilfe des Jugendgemeinderates ein abwechslungsreiches Programm für Euch auf die Beine gestellt. Es gibt wieder tolle Ausflüge, Workshops, Sportevents und viele andere beliebte Programmpunkte, die Ihr schon aus den Vorjahren kennt. Aber auch neue Angebote werden dabei sein – stöbert einfach im Programm und seht selbst, was es alles Interessantes gibt! Während der Sommerferien wird keine Langeweile aufkommen – Ein Ferienprogramm voller Spiel und Spaß, Sport und Abenteuer wartet auf Euch! Ein ganz herzliches Dankeschön geht an alle engagierten ehrenamtlichen Betreuer/- innen, die fleißigen Helfer/-innen aus den Vereinen, Institutionen und Firmen, sowie an alle Privatpersonen, die sich rund um das Ferienprogramm einbringen. Ohne diese Unterstützung könnte so ein umfangreiches Programm nicht angeboten werden. Ich wünsche uns allen eine wunderschöne Sommerzeit und Euch viel Freude und tolle Erlebnisse beim Ferienprogramm! Euer Sebastian Schrempp Oberbürgermeister WIE MELDET MAN SICH ZUM FERIENPROGRAMM IN RHEINSTETTEN AN? Unter www.unser-ferienprogramm.de/rheinstetten können Sie sich ganz einfach registrieren und gemeinsam mit Ihren Kindern die entsprechenden Veranstaltungen aussuchen. Bitte lesen Sie vor der Anmeldung unbedingt die Teilnahmebedingungen. Anmeldungen sind vom 05.07. bis 16.07.2021 möglich. Damit alle Kinder und Jugendliche eine faire Chance erhalten, an den Angeboten teilzunehmen, werden alle Anmeldungen gesammelt, die Plätze werden dann per Verlosung fest vergeben. Am Montag, den 19.07.2021, ist das online-Anmeldeprogramm inaktiv.