Magisterarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

GFL Kalender 36
Nr. 33/19 13.08.2019 www.football-aktuell.de eHUDDLE 33/19 13. August 2019 GFL Kalender 36 Mercenaries können Comets nicht stoppen 3 NFL Zehnte Südmeisterschaft gesichert 4 Quinns Agent meckert 38 Lions Bollwerk hält gegen Dresden 6 Kritik an der NFL 38 Kiel reduziert Hildesheim auf 21 Punkte 8 Eagles verlieren und verlieren Backup-QB 39 Dukes zähmen Wildkatzen erneut 10 Erfolgreiches Debüt 40 Sieg nach Puntfestival 12 Broncos verpflichten Ex-Lion Riddick 40 GFL 2 St.-Brown-Touchdown leitet Sieg ein 42 Die Kritiker verstummen lassen 42 Fans und Head Coach sind begeistert 15 Ein Blick in die Zukunft 43 Paladins auch im zweiten Derby sieglos 16 Neue Männer braucht New England 43 Viel Arbeit für Detroit 43 Griffins müssen sich geschlagen geben 18 Kasim Edebalis siebte Station 44 Komfortable Situation für Elmshorn 19 Ein neuer Cornerback für die Chiefs 44 Regionalligen NFL Flag Football in Hamburg 45 Neuzugang mit gebrochener Hand 45 Oldenburg lässt Chancen ungenutzt 23 Angriff der Chiefs schon wieder in Fahrt 46 News Ein Corner statt eines Receivers 46 Invaders rüsten für Spitzenspiel 23 Wenig Aussagekraft auf beiden Seiten 47 McLaurin überzeugt 47 Meisterschaft nach Aufholjagd 24 Steelers starten mit Sieg in Preseason 48 Saisonfinale im Deutschordenstadion 25 Ravens mit bekannter Formel zum Sieg 48 Invaders zum ersten Mal in GFL-Playoffs 26 Browns in großartiger Frühform 49 U19 verpasst den Junior Bowl 26 Texans verstärken Backfield 49 Wiesbaden gewinnt Halbfinale in Berlin 27 Das Tight End-Projekt ist gescheitert 50 Schweden ringt Britannien -

American Football Players in Finland: the Cultural Differences
American football players in Finland: The cultural differences Mikael Viljanen Bachelor’s thesis 2019 Summary Author Mikael Viljanen Degree programme Liiketalouden koulutusohjelma (Eng. Bachelors of Business Administrations) The title of the thesis Pages American football players in Finland: The cultural differences 43 + 33 The goal for this research was to discover and analyze the cultural differences between Finnish and American cultures, more specifically between Finnish and American athletes playing American football in Finland. This was done by interviewing American athletes who have played American football in Finland as professional import players. The interview the writer held was a qualitative open-ended question interview and was conducted to five American athletes who have played American football in Finland. The framework for this thesis is earlier cross-cultural research about Finland and United States. The writer uses the cultural dimension theories by cross-cultural researchers Geert Hofstede and Fons Trompenaars to research about the ways in which the two research groups could be culturally different. Despite Finnish and American culture are perceived quite similar to each other in the theo- retical framework of this thesis, this thesis did find out there is distinctive differences be- tween Finnish and American culture according to the research interviews. The cultural dif- ferences are mostly in the cultural dimensions of power distance, individualism, masculin- ity, specificness and affectiveness of the researched Finnish and American cultures. This thesis explains what each of these cultural dimensions stand for, as well as explaining the theory of cultural dimensions in general. An important background difference between the two research groups is that the game of American football is played very differently in Finland and in United States. -

BASL Vol 15 2
VOLUME 15 · ISSUE 2 · 2007 sport and the law journal ISSUE 2 VOLUME 15 SPORT AND THE LAW JOURNAL Editor British Association for Sport and Law Limited Simon Gardiner c/o The School of Law, King’s College London Strand, London WC2R 2LS Editorial Board Telephone: 020 7848 2278, Fax: 020 7848 2788 Dr Hazel Hartley Murrey Rosen QC www.britishsportslaw.org Dr Richard Parrish Jonathan Taylor Martin Matthews Registered Office Registered in England. Company No. 4947540. Directors Registered Office: 66 Lincoln’s Inn Fields Michael Beloff QC: President London WC2A 3LH. Mel Goldberg: Chairman VAT Reg No. 673 5989 73 Paul Harris: Deputy Chairman Gerry Boon: Hon. Treasurer ISSN 1353-0127 Serena Hedley-Dent: Hon. Secretary Darren Bailey Graphic design Morris Bentata www.heliographic.co.uk Nick Bitel Stephen Boyd Sara Friend Edward Grayson Jane Mulcahy Walter Nichols Murray Rosen QC Sam Rush Jonathan Taylor Maurice Watkins VOLUME 15 · ISSUE 2 · 2007 Contents Editorial 2 Opinion and Practice Interview with Michael Beloff QC 4 Stephen Boyd Annual Review of Football Finance 2007 11 Highlights Sports Business Group at Deloitte Analysis On the front foot against corruption 16 Simon Gardiner and Urvasi Naidoo Sport Governance and EU legal order: 28 Present and future Professor Melchior Wathelet Survey and Reports Sports Law Foreign Update 43 Walter Cairns 1 ISSUE 2 VOLUME 15 SPORT AND THE LAW JOURNAL Editorial By Simon Gardiner, Editor This issue of the Sport and the Law Journal concerns a Subsequently, in March 2007, the European Parliament number of on-going and current topics. The Opinion and adopted a resolution on “The Future of Professional Practice section provides an interview with the Right Football in Europe”, the content of which was partly Hon. -

Uefa Euro 2008
Expect emotions Info-Guide Impressum Publisher Euro 2008 SA Headquarters Route de St.-Cergue 9 1260 Nyon 1 Switzerland Tel.: +41 (0) 848 00 2008 Fax: +41 (0) 848 01 2008 Translation UEFA Language Services Design The Works Ltd. / Leeds (England) Layout/Setting team2graphics / Helsingør (Denmark) Printing ATAR Roto Press SA / Vernier (Switzerland) Photos: Keystone, GEPA, Action Images, L’Equipe, EMPICS, Terry Linke, Euro 2008 SA, UEFA 2 Contents 4 Editorial – Expect emotions 6 UEFA EURO 2008™ – Facts and figures 7 Countdown 8 Distances and travel times 10 UEFA EURO 2008™ match schedule 12 The stadiums 14 The finals 15 The winning captains The champion coaches 16 Attendances 17 Numbers games from 2004 in Portugal 18 Brief portraits of the host countries 22 The two host associations 26 The organisers 27 The Board of Administration 32 Tasks of Euro 2008 SA 33 The Management Board 36 EURO ABC – from A for accommodation to Z for Zurich 70 Contact details The Henri Delaunay trophy and EUROPASS, the official UEFA EURO 2008™ match ball. 3 Expect emotions The official UEFA EURO 2008™ slogan, expect emotions, describes in a nutshell what the 2008 European Championship has to offer: emotions that are felt by everyone alike – be they fans, players, coaches, referees, officials or organisers. Over a million spectators will flock to the 31 matches in the eight stadiums. Many millions will celebrate on the streets and in the official fan zones. Eight billion (cumulative) television viewers will share the excitement on screen. UEFA EURO 2008™ is by far the biggest sports event ever to take place in Austria and Switzerland. -
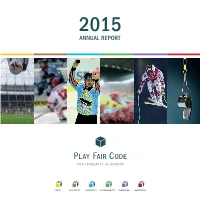
ANNUAL REPORT 2 | Messages and Voices Messages and Voices | 3
2015 ANNUAL REPORT 2 | Messages and Voices Messages and Voices | 3 “Betting fraud is the new threat to sport world- There is quite wide. With its education and training courses, consultations and information events, Play a lot to say about Fair Code is creating broad awareness of the threats of match-fixing. It is helping us protect the issue of our athletes and defend the integrity of sport.” match-fixing! Gerald KLUG AUSTRIAN MINISTER OF SPORT “People love to watch sports “We not only succeeded in organising nearly “Fairness and integrity are sport’s most im- 100 training and education courses aimed at portant attributes, and crucial prerequisites if because they don’t know our core target audiences in 2015; we also we want competitive sport to remain attrac- played an important role on the international tive – and that goes not just for spectators, stage once again, as a model for best prac- but also for the athletes themselves. Play Fair how it’s going to end!” tice. Play Fair Code has some extremely Code is playing a hugely important role in pre- Sepp Herberger exciting challenges facing it in the future, venting match-fixing in Austria, and by doing Former manager, German national football team especially the Council of Europe’s recent so, keeping sport clean, the way we all want it. Convention on the Manipulation of Sports That’s why I shall be continuing to work side- Competitions and the National Platform being by-side with Play Fair Code in 2016.” set up.” Günter KALTENBRUNNER Dietmar HOSCHER PRESIDENT, PLAY FAIR CODE BOARD OF DIRECTORS, CASINOS AUSTRIA „It has been a good thing to remind our-selves of this issue once again; it’s incre-dible just what vast sums of money the betting mafia are dealing with. -
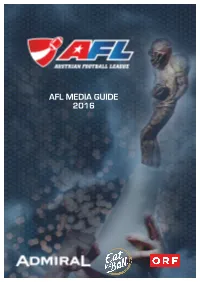
Afl Media Guide 2016
AFL MEDIA GUIDE 2016 INHALTSVERZEICHNIS AFC SWARCO RAIDERS TIROL - 3 - AFC VIENNA VIKINGS - 6 - PRAGUE BLACK PANTHERS - 10 - DANUBE DRAGONS - 12 - PROJEKT SPIELBERG GRAZ GIANTS - 14 - LJUBLJANA SILVERHAWKS - 18 - CINEPLEXX BLUE DEVILS - 20 - AFC MÖDLING RANGERS - 23 - - 2 - AFC SWARCO RAIDERS TIROL Gegründet: 1992 Erfolge: Austrian Bowl XX Sieger (2004) Austrian Bowl XXII Sieger (2006) Austrian Bowl XXVII Sieger (2011) Austrian Bowl XXXI Sieger (2015) Eurobowl XXII Sieger (2008) Eurobowl XXIII Sieger (2009) Eurobowl XXV Sieger (2011) EFAF-Cup Sieger 2004 Finalist Austrian Bowl XVI (2000) Finalist Austrian Bowl XVII (2001) Finalist Austrian Bowl XXI (2005) Finalist Austrian Bowl XXIV (2008) Finalist Austrian Bowl XXVI (2010) Finalist Austrian Bowl XXVIII (2012) Finalist Austrian Bowl XXIX (2013) Finalist Austrian Bowl XXX (2014) Finalist Eurobowl XXVII (2013) Finalist EFAF-Cup 2003 Die SWARCO RAIDERS Tirol sind ein 1992 gegründetes American Football-Team aus Innsbruck. Trotz der noch jungen Geschichte sind die Tiroler eine der besten Mannschaften in ganz Europa. Insgesamt gewannen die SWARCO RAIDERS Tirol drei Mal die Euro Bowl. Den Austrian Bowl haben sie vier Mal nach Innsbruck geholt. Zudem sicherten sie sich einmal den Titel im EFAF-Cup. Weiterhin sind die SWARCO RAIDERS Tirol der einzige Football-Verein der Welt, der eine offizielle Kooperation mit einem Team der National Football League (NFL) führt. Seit 2008 arbeiten die Tiroler mit den Oakland Raiders zusammen. Zu den Heimspielen der SWARCO RAIDERS Tirol pilgern bis zu 9.000 Zuschauer. Zudem setzen die SWARCO RAIDERS Tirol mit raidersTV einen international einmaligen Standard in punkto LiVe-Web-TV-Übertragung. Die SWARCO RAIDERS Tirol spielen weiterhin mit ihrer 2. -

IB16 Nachweis 3-2007
Drucksache 16/0973 05.11.2007 16. Wahlperiode Vorlage – zur Kenntnisnahme – Nachweisung über die Verteilung der Mittel der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin für das 3. Kalendervierteljahr 2007 Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses können über die Internetseite www.parlament-berlin.de (Startseite>Parlament>Plenum>Drucksachen) eingesehen und abgerufen werden. Senatsverwaltung für Finanzen I B – GS 4490-1/2002 Tel.: 90 20 - 20 82 An das Abgeordnetenhaus von Berlin über Senatskanzlei - G Sen - V o r l a g e - zur Kenntnisnahme - über Nachweisung über die Verteilung der Mittel der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin für das 3. Kalendervierteljahr 2007 Die Senatsverwaltung für Finanzen legt nachstehende Vorlage dem Abgeordnetenhaus zur Besprechung vor: Im Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September 2007 hat eine Sitzung des Stiftungsrats der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin stattgefunden. Die Nachweisung über die Verteilung der Mittel im Einzelnen gemäß § 11 Abs. 3 des Gesetzes über die Deutsche Klassenlotterie Berlin und die Stiftung Deutsche Klassen- lotterie Berlin (DKLB-Gesetz) vom 7. Juni 1974 (GVBl. S. 1338), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Mai 1996 (GVBl. S. 179), ergibt sich aus den Anlagen. Die Stiftung hat insgesamt 23.907.645,00 Euro zur Verfügung gestellt, davon - gemäß § 6 DKLB-Gesetz (Zweckabgabe/Bilanzgewinn): 23.366.725,00 Euro (Anlage 1) - gemäß § 4 Abs. 5 Spielbankengesetz (Anteil an der Zusatzabgabe): 540.920,00 Euro (Anlage 2). Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung: a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben: Die aus der Anlage 1 unter den laufenden Nummern 5, 6, 9 und 21 ersichtlichen Mit- tel fließen dem Haushalt als zweckgebundene Einnahmen zu und werden entspre- chend der Zweckbindung verwendet. -

2008 Team Roster(1)
2008 TEAM NAME EFAF-Roster # Name Pos. Height Weight Date of birth Passport Prev. Program 2 Haritonenko Nic DB 187 96 15.06.89 D Dresden Monarch 3 Wu Ting Feng RB 180 85 26.11.83 CH Zürich Renegades 4 Drake Charles DB 187 84 25.09.81 USA Detroit Lions 5 Mortazavi Mo DB 180 80 27.07.80 Iran Devils 6 Okrah Joseph DB 180 85 07.03.83 GH Devils 7 Thurnher Paul QB 185 84 06.10.90 A Devils Juniors 8 Haas Robin WR 174 84 20.11.74 CH Devils 9 Wilhelm Kevin DB 177 70 13.10.90 A Devils Juniors 10 Dieufaite Wilfred DB 188 82 02.12.68 BAH Devils 11 Bonnell Carl QB 190 94 20.09.83 USA Univ. of Washington 11 Troth Paul QB 194 102 19.08.82 USA East Carolina 13 Dorlean Frantzy DL 192 120 12.09.84 F Argonauts 14 Michael Kiehm LB 185 105 14.12.78 D Allgäu Comets 15 Jung Herbert LB 173 84 07.01.76 A Devils 16 Lamprecht David DB 176 80 25.05.89 A Devils Juniors 17 Lutz Emanuel RB 170 90 05.05.86 A Devils 18 Pieh Lionell DB 180 90 05.05.83 SL Devils 20 Ritter Nico DB 185 80 21.09.90 A Devils Juniors 21 Jesacher Patrick RB 178 75 16.10.91 A Devils Juniors 22 Bunderla Mario RB 160 60 22.11.88 A Devils Juniors 33 Muggwyler Tino RB 175 75 04.02.85 CH Landquart Broncos 34 Wirz Laurent DB 180 85 08.08.74 CH Rookie 35 Fröhlich Oliver RB 180 111 20.08.73 CH Devils 36 Walters Matthew RB 189 120 26.08.81 USA Michigan State 37 Balta Dalibor WR 178 80 11.12.76 A Devils 42 Keil Daniel DL 185 120 01.09.77 D Devils 44 Edouard Coissy RB 180 85 30.01.82 CH Zürich Renegades 48 Bonnell Raymond LB 189 113 27.09.81 USA Washington State Univ. -

Team Roster As of SAT 22 JUL 2017 GER - Germany Shirt Playing Height Weight Name Age Club No
American Football Men's Team Roster As of SAT 22 JUL 2017 GER - Germany Shirt Playing Height Weight Name Age Club No. Position m / ft in kg / lbs 2 HANSEN Thiadric Linebackers 1.90 / 6'3" 100 / 220 24 Kiel Baltic Hurricanes 3 GROOTEN Richard Secondary 1.77 / 5'10" 84 / 185 24 Düsseldorf Panther 4 MAU Bejamin Receivers 1.99 / 6'6" 89 / 196 25 Hamburg Huskies 5 ADEGBESAN Aurieus Receivers 2.08 / 6'10" 102 / 225 24 Schwäbisch Hall Unicorns 6 GOMEZ Sebastian Silva Linebackers 1.80 / 5'11" 85 / 187 24 Samsung Frankfurt Universe 7 JANSSEN Till Linus Luca Caleb Secondary 1.90 / 6'3" 95 / 209 23 Düsseldorf Panther 8 ZIMMERMANN Paul Quarterback 1.88 / 6'2" 93 / 205 21 Berlin Adler 10 ROBINSON Tissi Secondary 1.93 / 6'4" 93 / 205 29 New Yorker Lions 11 WEISHAUPT Sonny Tim Robin Quarterback 1.93 / 6'4" 93 / 205 25 Samsung Frankfurt Universe 12 HAUPERT Alexander Quarterback 1.88 / 6'2" 85 / 187 22 Saarland Hurricans 15 OWUSO Jason Secondary 25 Berlin Rebels 16 BAUMGÄRTNER Yannik Receivers 79 / 174 26 Assindia Cardinals 20 ABRAHAMSEN Jan Secondary 1.80 / 5'11" 77 / 170 24 Kiel Baltic Hurricanes 21 KOEPPE Christian Secondary 1.81 / 5'11" 85 / 187 25 Schwäbisch Hall Unicorns 23 YASSAR Jazan Running Backs 1.67 / 5'6" 80 / 176 20 Dresden Monarchs 24 POZNANSKI Joshua Secondary 1.90 / 6'3" 91 / 201 22 Samsung Frankfurt Universe 26 SCHERENBERG Marc Secondary 1.83 / 6'0" 92 / 203 29 Schwäbisch Hall Unicorns 29 NICK Tobias Running Backs 1.81 / 5'11" 95 / 209 23 Assindia Cardinals 30 POETSCH Patrick Running Backs 1.79 / 5'10" 111 / 245 28 Solingen Paladins -

Driveon Corporate Magazine | 01–2019
SWARCO DRIVEON CORPORATE MAGAZINE | 01–2019 SPECIAL ISSUE ON THE OCCASION OF OUR 50TH ANNIVERSARY www.swarco.com The Better Way. Every Day. SWARCO | The Better Way. Every Day. | 2 DEAR READER, The year 2019 is a special one for SWARCO: We celebrate our 50th anniversary. On this occasion, we have compiled a special issue of our corporate magazine DRIVE ON, looking back on CONTENTS some stages of our five-decade long story. A story which at the same time is the story and lifetime achievement In memoriam Manfred Swarovski (1940 - 2018) 4 of the Tyrolean entrepreneur Manfred Swarovski who founded in 1969 what It all started in a bar in Mexico 8 we call SWARCO today. Unfortunately „MS“ – as he was known and labeled SWARCO: Five decades of positive growth 12 throughout the whole group of companies SWARCO's ITS adventure – how it started 14 – did not make it for the anniversary year. DRIVE ON | 50-YEAR ANNIVERSARY ISSUE | 3 ANNIVERSARY ON | 50-YEAR DRIVE He passed away in May 2018 at the Spotlights from SWARCO history – part I 18 age of 77. Nevertheless it would have been his utter wish that we celebrate Tales from a thousand and one glass beads 20 the success story of his life's work. I am Germany – SWARCO's no. 1 market 26 sure he will be mentally linked to all of us and follow the SWARCO year 2019 Spotlights from SWARCO history – part II 28 from heaven. SWARCO International Management Meetings 31 As many businesses, SWARCO is a Job rotation 32 story of ups and downs, of successes and failures, but we managed to be in HR goes digital 33 place since 50 years now. -

UNICORNS German Bowl 36 Media Guide English
Media Guide - German Bowl XXXVI Seite 1 von 30 Content Coaching-Staff ............................................................................................. 3 Roster – numerical ........................................................................................ 8 Roster – alphabetical .................................................................................... 10 Depth Chart ................................................................................................ 12 Key Players Offense ...................................................................................... 13 Key Players Defense ..................................................................................... 15 The UNICORNS Season 2014 ........................................................................... 17 Results Season 2014 ..................................................................................... 18 Statistics 2014 ............................................................................................ 19 Game Superlatives 2014 ................................................................................ 26 Unicorns Facts ............................................................................................ 28 Unicorns Success ......................................................................................... 29 More information ........................................................................................ 30 Contact: Axel Streich Pressesprecher Schwäbisch Hall UNICORNS Mobil: +49 172 719 -

International Nfl International Feel
INTERNATIONAL NFL INTERNATIONAL FEEL While the NFL continues to grow in popularity across the globe, international players are making an increasing impact on the field. For the 14th time in the past 15 seasons, at least one player who attended high school outside of the United States was selected in the NFL Draft. This year, the Pittsburgh Steelers selected wide receiver CHASE CLAYPOOL (right) in the second round of the NFL Draft. The Canadian wide receiver recorded 150 receptions 2,159 receiving yards and 19 touchdowns during his career at Notre Dame. “When you get drafted to a team like the Steelers, it doesn’t seem real. It’s a super cool thought and idea of me playing for the Steelers,” said Claypool. “Each day it’s going to get more and more real.” In addition, the Dallas Cowboys selected NEVILLE GALLIMORE (below) in the third round of the NFL Draft. The Canadian defensive tackle was credited with 148 tackles, nine sacks, and five forced fumbles during his career at Oklahoma. “It’s one of those things where I didn’t know whether I was going to laugh, cry or scream,” Gallimore said. “It was definitely a surreal moment. It was definitely worth the wait.” This season, seven teams will carry an oversees player on their practice squad during the 2020 season as part of the International Player Pathway program. “The International Player Pathway program is an important part of our ongoing efforts to grow the game globally and provide pathways for international players to make it to the NFL.” -NFL International Chief Operating Officer DAMANI