Alles Frankreich Oder Was?«
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
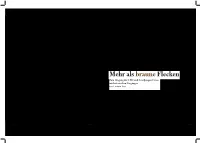
Braune Flecken CDU Saar
Mehr als braune Flecken Zum Umgang der CDU und ihrer Jungen Union mit historischen Vorgängen von Luitwin Bies NSDAP cvp CDU Manuskript eines Vortrages, den der Autor am 05. März 2009 unter dem Titel: Die CDU-Saar – mit braunen Flecken in einer Veranstaltung der Peter-Imandt-Gesellschaft / Rosa-Luxemburg-Stiftung in Saarbrücken gehalten hat. Impressum Peter-Imandt-Gesellschaft e.V. Rosa-Luxemburg-Stiftung, Saarbrücken Futterstraße 17-19 66111 Saarbrücken Tel. 0049 (0) 681-5953892 Fax: 0049 (0) 681-5953893 www.peter-imandt.de email: [email protected] Luitwin Bies, Jahrgang 1930, Historiker, Dr. phil., Veröffentlichungen zur Ge- schichte der KPD an der Saar, zu antifaschistischem Widerstand und Verfolgung durch Gestapo und NS-Justiz, biographische Skizzen saarländischer Persönlich- keiten der Arbeiter- und der Widerstandsbewegung, Arbeiten zur Völklinger Stadtgeschichte. Luitwin Bies verstarb im Mai 2009. Auswahl seiner Veröffentlichungen: Klassenkampf an der Saar 1919–1935 – Die KPD im Saargebiet im Ringen um die soziale und nationale Befreiung des Volkes, Frankfurt / Main 1978 Widerstand aus dem katholischen Milieu, St. Ingbert 1993 Derichsweiler – Luisenthal – Dachau – New York – Stationen im Leben des jüdischen Arztes Dr. Rudolf Fromm aus Luisenthal, Völklingen 1999 Widerstand an der Grenze – Des deux côtés d‘une frontière, Saarbrücken 2002 Verfolgt,Vertrieben, Ermordet – Saarländerinnen gegen die Nazis, Saarbrücken 2004 Für den Sturz des Naziregimes – Widerstand und Verfolgung von saarländischen Antifaschisten, Saarbrücken 2007 Ein Erlebnis, das mich beschäftigt hat, führte dazu, ein schon in Grundzügen er- arbeitetes Manuskript über ehemalige Nazis in der Saarpolitik nach 1945 hervor- zuholen und als Vortrag anzubieten. Assoziationen stellten sich bei mir ein, als ich im September 2007 durch ein Spa- ihrer Aufrüstung zu verkaufen. -

Aufsatz Die Unterschiedlichen Regelungen Zur Amtszeit Des Amtseides »Vor« Dem Amtsantritt Bzw
LKRZ_10_2011:LKRZ_4_2011.qxd 28.09.2011 13:35 Seite 361 10/2011 LKRZ 5. Jahrgang, Seiten 361–400 Zeitschrift für Landes- und Kommunalrecht Hessen | Rheinland-Pfalz | Saarland Herausgeber: Claus Böhmer, Präsident des Oberverwaltungsgerichts des Saarlandes | Prof. Dr. Christoph Gröpl, Universität des Saarlandes | Dr. Herbert Günther, Ministerialdirigent a.D., Staatskanzlei des Landes Hessen | Klaus-Ludwig Haus, Direktor des Landesverwaltungsamtes des Saarlandes | Prof. Dr. Reinhard Hendler, Universität Trier | Prof. Dr. Georg Hermes, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | Prof. Dr. Hans-Detlef Horn, Philipps-Universität Marbug, Richter am Hessischen Verwaltungsgerichtshof | Prof. Dr. Friedhelm Hufen, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Mit- glied des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz | Dr. Curt M. Jeromin, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Andernach | Prof. Dr. Siegfried Jutzi, Minis- terialdirigent, Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz des Landes Rheinland-Pfalz, Vertreter des öffentlichen Interesses des Landes Rheinland- Pfalz, Honorarprofessor der Johannes Gutenberg-Universität, Mainz | Prof. Dr. Holger Kröninger, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Saarbrücken | Prof. Dr. Klaus Lange, Justus-Lie big-Universität Gießen, Präsident a.D. und Mitglied des Staatsgerichtshofs des Landes Hessen | Prof. Dr. Karl-Friedrich Meyer, Präsident des Verfassungsgerichtshofs und des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz | Wolfgang Reimers, Präsident des Hessischen Verwal- tungsgerichtshofs a.D. | Prof. Dr. Gunnar Schwarting, -

60 Jahre JU Saar
„60 Jahre Junge Union Saar – Eine Chronik“ Inhaltsverzeichnis Seite Grußwort Markus Uhl 3 Grußwort Dr. Angela Merkel 4 Grußwort Annegret Kramp-Karrenbauer 5 Grußwort Paul Ziemiak 6 Chronik Die 1950er Jahre 7 Die 1960er Jahre 17 Die 1970er Jahre 21 Die 1980er Jahre 31 Die 1990er Jahre 47 Die 2000er Jahre 61 Die 2010er Jahre 67 Übersicht der Landesvorsitzenden 76 Der aktuelle Landesvorstand 78 Impressum 80 Grußwort des Landesvorsitzenden der Jungen Union Saar Markus Uhl Liebe Freundinnen und Freunde, in diesem Jahr wird die Junge Union Saar 60 Jahre alt. Seit ihrer Gründung im Jahr 1955 haben zehntausende JU’ler für ihre Überzeugungen gekämpft und sich für unsere Gesellschaft engagiert. Wir blicken also heute, im Jahr 2015, auf eine lange, bewegte und auch bewegende Geschichte zurück. Die Junge Union war dabei stets der Motor und Vorreiter – noch ehe die Themen Einzug in die „große Politik“ hielten. Die Geschichte der JU Saar ist eine Erfolgsgeschichte. Sie zeigt, dass es sich lohnt, sich zu engagieren. Exemplarisch sei an dieser Stelle nur an die Initiativen im Rahmen der Diskussionen um die Polen-Verträge in den 70ern und den Ausstieg aus dem Kohle-Bergbau an der Saar in den 90er Jahren erinnert. Aber auch ganz pragmatische politische Forderungen im Interesse der jungen Generation vermochte die JU sowohl durch- als auch umzusetzen. Unvergessen bleibt die Einführung des Erfolgsprojek- tes „Führerschein mit 17“ oder die landesweite Etablierung von Nachtbussen. So wundert es nicht, dass ihre Erfolgsgeschichte nicht nur eine inhaltliche, sondern eben auch eine personelle ist: Denn fast alle die saarländische Politik prägenden Köpfe waren (oder sind) Mitglieder der Jungen Union Saar. -

Stahlbranche Bergbau Strukturpolitik Politik
IM STAHLBRANCHE DAS SAARLAND 1756 1856 Entstehung eines Gründung der Burbacher 1685 Schmelz- und Ham- Hütte als Saarbrücker-Eisen- STRUKTURWANDEL Gründung der merwerks am Hal- hütten-Gesellschaft Dillinger Hütte berg, Saarbrücken im Auftrag des 1873 Sonnenkönigs 1733 1806 Entstehung der Völklinger Hütte 1945 Louis XIV. Gründung des Übernahme der Die Saarhütten Burbach, Dillingen Stahlwerks St. Neunkircher 1879 und Neunkirchen sind erheblich Ingbert (Alte Hütte durch die Erfindung des Thomas-Verfahrens 1926 durch Kriegsschäden gezeichnet, Schmelz) Gebrüder Stumm zur Verhüttung der Minette-Erze 1593 aus Luxemburg und Lothringen Otto Wolff (Köln) die Dillinger Hütte ist zu 65% zer- erste Hinweise 1809 übernimmt gro- stört - das Werk Völklingen über- 1951 1956 auf eine Eisen- Dillinger wird zur 1881 ße Aktienanteile steht den Krieg fast unbeschadet Die Produktion der Röchling erhält hütte in Neun- ersten deutschen Karl Röchling kauft die am Eisenwerk - bis zum Eintreffen der Alliierten Völklinger Hütte erreicht die Völklinger kirchen Aktiengesellschaft Völklinger Eisenhütte Neunkirchen wird hier produziert ihren Höchststand Hütte zurück STAHLBOOM IN DEN 1950ER JAHREN 1400 1500 1600 1700 1750 1800 1850 1900 1920 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1429 1822 1866 1914 1923 1935 1942 1945 1957 Erste Erwäh- erster Schacht Eröffnung des Rückgang der Kohle- „Hundert-Tage-Streik“ der weiterhin Spitzenzeit Verminderung der Beleg- Gründung der nung von Koh- von oben Saarkohlekanals förderung mit Beginn Bergleute gegen den zu- Anstieg der der Kohleför- schaft bis Kriegsende; Saarbergwerke levorkommen des 1. Weltkriegs nehmenden französischen Fördermenge derung trotz Gründung der Mission Fran- im Saarland 1751 1889 Einfluss 2. Weltkrieg çaise des Mines de la Sarre Verstaatlichung der Streik der Bergarbeiter (erster Kohlegruben und Massenstreik in der Saarindus- 1920 anschließender sys- trie und anschließende Ent- Die Saargruben werden tematischer Ausbau wicklung einer Gewerkschaft) als Reparationsleistungen Frankreich zugesprochen. -

Braune Spuren Im Saar-Landtag Die NS-Vergangenheit Saarländischer Abgeordneter Inhalt
Dr. Hans-Peter Klausch Braune Spuren im Saar-Landtag Die NS-Vergangenheit saarländischer Abgeordneter Inhalt Vorwort Oskar Lafontaine 3 Einführung 4 Zur Vorgehensweise 5 Allgemeine Ergebnisse 5 Frühere SA- und SS-Angehörige im saarländischen Landtag 6 Zur Anzahl vormaliger NSDAP-Mitgliedschaften 8 Differenzierte Betrachtung nötig 9 Zum Zeitpunkt des Parteieintritts: Langjährige NSDAP-Mitglieder bei CDU und FDP 9 Allmähliche Rückkehr - die ersten Ex-NSDAP-Mitglieder im Saarländischen Landtag 10 Der „Durchbruch“ ehemaliger NSDAP-Mitglieder bei der Wahl vom 18. Dezember 1955 10 Die CDU-Fraktion der Wahlperiode 1956-1961 - über die Hälfte Ex-NSDAP-Mitglieder 11 Andere Situation bei der Christlichen Volkspartei (CVP) des Saarlandes 12 Auch in der SPD-Fraktion: Hoher NSDAP-Anteil 12 Tief im braunen Sumpf - Die DPS-Fraktion 1956-1961 12 Gesteigerter Höhenflug der Ex-NSDAP-Mitglieder nach der Wahl vom 4. Dezember 1960 14 Die weitere Entwicklung bis hinein in die 1970er-Jahre 14 Schlussbetrachtung 16 Liste der saarländischen Landtagsabgeordneten mit NSDAP-Mitgliedschaft 18 Liste der saarländischen CDU/DVP-Abgeordneten mit NSDAP-Mitgliedschaft 19 Liste der saarländischen SPD/SPS-Abgeordneten mit NSDAP-Mitgliedschaft 20 Liste der saarländischen FDP/DPS-Abgeordneten mit NSDAP-Mitgliedschaft 21 Liste ehemaliger NSDAP-Mitglieder in herausgehobenen politischen Ämtern und Funktionen 21 Informationen zum Autor 23 Vorwort Als ich 1970 zum ersten Mal in den saarländischen Landtag gewählt wurde, wusste ich nicht, wie viele meiner Abgeordnetenkollegen ehemalige NSDAP Mitglieder wa- ren. Im saarländischen Landtag hatte eine Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit nicht stattgefunden. Mit der vorliegenden Broschüre soll diese Lü- cke, wenn auch spät, geschlossen werden. Die Nachkriegsgeneration, zu der ich gehöre, war in einem demokratischen Geist und voller Abscheu für die Verbrechen der Nazis erzogen worden. -

Saarabstimmungen: 1935 Und 1955 Dokumentation Einer Vortragsreihe
saarabstimmung_cover_Layout 1 23.06.2016 08:23 Seite 1 Schriften der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt Saarabstimmungen: 1935 und 1955 Dokumentation einer Vortragsreihe Neue Sichtweisen braucht das alte Thema. Mit dem Abtreten der Herausgegeben von letzten Zeitzeugen verliert der bisherige, „prodeutsch“ dominierte geschichtspolitische Erinnerungsoktroi an Bedeutung. Wilfried Busemann Es ist zum Beispiel an der Zeit, den wirtschaftshistorischen Vergleich der „kleinen“ (Saar) und „großen“ (DDR) Vereinigung auf seinen Erkenntnisertrag zu überprüfen. Ebenso nötig ist es, die Abstim- mungen von 1935 und 1955 einzubetten in die spezifisch saarländi- sche „Politische Kultur“ zwischen 1870 und ca. 1970 oder die sozialpolitischen Verwerfungen für die Arbeitnehmer zu betonen. Das Buch dokumentiert die Vortragsreihe der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt, die im Herbst 2015 auf dem Campus der Universität des Saarlandes stattfand. Saarabstimmungen: 1935 und 1955 Saarabstimmungen: universaar Universitätsverlag des Saarlandes Saarland University Press Presses Universitaires de la Sarre Schriftenreihe der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der Universität des Saarlandes Die zentrale Aufgabe der Kooperationsstelle Wissenschaft und Ar- beitswelt der Universität des Saarlandes besteht in der Generierung von arbeitsweltorientiertem Wissen und der gegenseitigen Zusam- menführung von Wissensbeständen in Wissenschaft und Arbeits- welt mit dem Ziel einer nach haltigen Kooperation zum Nutzen aller Kooperationspartner/innen. -

L N H a L T S V E R Z E L C H N
1 ,1+$/769(5=(,&+1,6 ',(&'86$$5$8)(,1(1%/,&. Kurzer historischer Überblick………………………………………………………...3 '(5$8)%$8'(5&'86$$5 Landesverband………………………………………………………………………..5 Kreisverbände………………………………………………………………………… 6 Gemeindeverband und Ortsverband……………………………………………….. 6 Vertreter der CDU Saar auf Bundes- und Europaebene…………………………. 7 ',(*(6&+,&+7('(5&'86$$5 Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg…………………………………………. 8 CVP für Autonomie und Europäisierung der Saar………………………………… 8 Erste Gründungsversuche der CDU Saar…………………………………………. 9 Die Abstimmung über das Saarstatut………………………………………………. 9 Fortdauernde Auseinandersetzungen zwischen CDU und CVP………………. 10 Einigung der christlichen Parteien unter Egon Reinert…………………………. 10 20 Jahre CDU Regierung unter Franz-Josef Röder…………………………….. 11 Alleinregierung der CDU – Rückkehr der FDP ins Kabinett……………………. 11 Regierungswechsel 1985: Absolute Mehrheit der SPD………………………… 12 CDU gewinnt Landtagswahl 1999: Das Saarland wird zum Aufsteigerland….. 12 Landtagswahl 2004: Die CDU Saar startet erfolgreich in die zweite Zukunft… 14 $1+$1* Die Landesvorsitzenden der CDU Saar seit 1955…………………………….... 16 Die Landtagspräsidenten der CDU Saar seit 1957……………………………... 17 Wahlergebnisse der CDU Saar seit 1955………………………………………... 18 Die CDU-geführten Landesregierungen seit 1956……………………………… 20 2 ',(&'86$$5$8)(,1(1%/,&. .XU]HUKLVWRULVFKHUhEHUEOLFN Die Historie des christlichen Lagers an der Saar ist nach dem Zweiten Weltkrieg im Wesentlichen von der Auseinandersetzung über das ‚Saarstatut’ einerseits sowie dem Konflikt zwischen -

Der Traum Von Rückkehr Ins Paradies
FREITAG, 13. JULI 2018 Region B3 Der Traum von Rückkehr ins Paradies Nach dem Aus für den plare anspricht, dann legt er los. ten der Universität des Saarlandes“ Botanischen Garten der Kann zu jedem „Zögling“ etwas er- findet man sehr unterhaltsame Ge- zählen, gerät ins Schwärmen und schichten immer schön rund um die Saar-Uni hält dessen wieder hinaus. Hinaus deshalb, Pflanzenwelt. Leiter Wolfgang Stein weil ihm immer noch das Herz blu- Und seine Lieblingspflanze, wie die Erinnerung an die tet, wenn er an die Schließung sei- heißt sie? Es ist dies die Glocken- nes Paradieses denkt. An den An- blume, weil er „protzige“ Pflanzen Pflanzen im Internet spruch einer Lehrinstitution mit nicht unbedingt mag. Und was wach. Er hofft, dass nach öffentlichem Bildungsauftrag. An wächst bei dem 63-jährigen Fami- 2020 ein neuer Garten die Pflanzen in den tropischen Ge- lienvater im heimischen Garten? wächshäusern, die versteigert wur- Na, das ist dann nicht so üppig wie entsteht. den. Dem ehemaligen Leiter des Bo- einst im botanischen Refugium an tanischen Gartens geht heute noch der Saar-Universität. Erstens, sagt VON MICHÈLE HARTMANN der Hut hoch, denkt er daran, dass er, wohne er am Sulzbach. Und die ein Kind eine sehr seltene Orchide- Schnecken würden „werfen wie die SAARBRÜCKEN Hier hat er nun enart für einen Euro erwarb. „Die Karnickel“. Mit einem Nutzgar- Platz genommen und schaut sich Leute haben uns überrannt. Da hat ten sei da kein Staat zu machen. um. Nicht verbittert, nicht geladen. die Erde geweint“, spricht er das aus, Zum zweiten befinde sich unterm Trotz dessen, was ihn vor mehr als was er als Katastrophe erlebte. -

Ausgabe 02 2012 QUI.Indd
QUIERSCHIED · FISCHBACH/CAMPHAUSEN · GÖTTELBORN Februar 2012 KNEIPP VEREIN QUIERSCHIED E.V. KIRCHLICHE INFORMATIONEN EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE FISCHBACH-QUIERSCHIED ES BLEIBT EINEM IM LEBEN NUR DAS, WAS MAN VERSCHENKT HAT. ROBERT STOLZ PRESBYTERIUMSWAHL AM 5. FEBRUAR 2012 Zur Presbyteriumswahl Leute ab 14 Jahren, also am 5. Februar 2012 haben unsere Neu-Konfi rmier- sich dankenswerterweise ten. 7 Gemeindemitglieder zur Kandidatur bereit Am Wahlsonntag ist das erklärt. 6 Plätze sind zu Wahllokal im Gemeinde- besetzen. Bis zu 6 Kreuz- saal Fischbach von 09.00 Gisela Brotschar, 60 Jahre, chen dürfen demnach auf Viktoria Porteset, 26 Jahre, Uhr bis 14.00 Uhr geöff- Hausfrau, den Stimmzetteln am Studentin, net - mit Unterbrechung erstmalige Kandidatur seit 2006 Presbyterin Wahltag gesetzt werden. in der Zeit des Gottes- dienstes. Alle Kandidierenden stel- len sich persönlich in der Der Antrag auf Briefwahl Gemeindeversammlung kann bis zum 31. Januar am kommenden Sonn- gestellt werden. Die tag, den 22. Januar, im Briefwahlumschläge Anschluss an den Gottes- müssen bis zum 4. Febru- Birgit Geerkens, 41 Jahre, dienst in der ev. Kirche Eva Rech, 51 Jahre, ar, 16.00 Uhr zurückge- Nachmittagsbetreuung Regierungsangestellte, Fischbach vor. Dazu auch geben sein. seit 2008 Presbyterin Grundschule, auf diesem Weg herzliche seit 1996 Presbyterin Einladung! Der Gottes- dienst beginnt um 10.00 Uhr. KURZ-INFOS: Wer wählt, entscheidet · Jugendgruppe: mit. Die 6 gewählten Pres- Freitag, 20. Januar, Kinobesuch in Saarbrücken, byter/innen, die Mitar- Treffpunkt um 18.30 Uhr Bahnhof Fischbach, Bianca Junk, 38 Jahre, beiter-Presbyterin Frau I. Anmeldung bei Frau B. Geerkens, Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte, Heberger und Pfarrer Tel.: 96 66 95. erstmalige Kandidatur H.-L. -

Schriftgut Politischer Entscheidungsträger
Transferarbeit zum Abschluss des 44. Wissenschaftlichen Kurses Betreuer am Hauptstaatsarchiv Stuttgart: Dr. Albrecht Ernst Betreuerin an der Archivschule Marburg: Dr. Irmgard Christa Becker SCHRIFTGUT POLITISCHER ENTSCHEIDUNGSTRÄGER CHANCEN UND RISIKEN BEI DER ÜBERLIEFERUNGSBILDUNG FÜR STAATLICHE ARCHIVE VON EVA RÖDEL M.A. STAND: MÄRZ 2011 INHALTSVERZEICHNIS 1. Einleitung 3 2. Schriftgut politischer Entscheidungsträger – Überlieferungsbildung seit 1945 6 2.1. Nachlassakquirierung in staatlichen Archiven und den Archiven der 6 politischen Stiftungen 2.2. Schriftgut von Regierungsmitgliedern in Bund und Ländern 11 3. Schriftgutverwaltung in Ministerien – fünf Fallbeispiele 19 4. Schlussfolgerungen und Lösungsmöglichkeiten 25 Anhang I. Übersicht zu den untersuchten Entscheidungsträgern 34 II. Diagramme zum Nachweis von Nachlässen 40 III. Fragebogenmuster für Registraturen 46 IV. Fragebogenmuster für staatliche Archive 48 V. Musteranschreiben an die Minister 50 VI. Literatur- und Quellenverzeichnis 52 VI.I. Literatur 52 VI.II. Normen 57 VI.III. Antworten auf Fragebögen 60 VI.IV. Ansprechpartner: Emails, Auskünfte und Interviews 61 VI.V. Gesichtete Archivbestände 62 VII. Abkürzungsverzeichnis 63 2 1. Einleitung Vorliegende Arbeit widmet sich schwerpunktmäßig dem Schriftgut von Ministern und Mi- nisterpräsidenten1, v.a. dem während ihrer Amtszeit in ihren Büros anfallenden Schriftgut, und analysiert, welche Chancen und Risiken sich bei der Überlieferungsbildung für staatli- che Archive ergeben – zu denken ist hier in analoger wie digitaler -

Die NS-Belastung Saarländischer Landtagsabgeordneter
Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte Prof. Dr. Norbert Frei Philosophische Fakultät Historisches Institut Fürstengraben 13 07743 Jena Telefon: 03641 ·9444 50 Telefax: 03641· 9444 52 [email protected] www.nng.uni-jena.de Die NS-Belastung saarländischer Landtagsabgeordneter Vorstudie und Forschungsempfehlungen Bearbeiter: Dr. Maik Tändler 14. November 2016 Einleitung ........................................................................................................................ 3 I. Zum Stand der Forschung ....................................................................................... 5 II. NS-Belastungen saarländischer Landtagsabgeordneter ...................................... 10 1. Ehemalige NSDAP-Mitglieder im saarländischen Landtag – statistische Auswertung und historische Einordnung .......................................................... 11 2. Quellenlage und Quellenfunde .......................................................................... 16 Archiv des Landtages des Saarlandes (ALS) ................................................. 16 Landesarchiv Saarbrücken (LASB) ................................................................. 19 3. Biographische Einzeldarstellungen ................................................................... 23 Franz Josef Röder .......................................................................................... 23 Heinrich Schneider ......................................................................................... 36 Erwin Albrecht ...............................................................................................