JAHRBUCH DER GEOLOGISCHEN BUNDESANSTALT Jb
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bezirk Gmunden Seite 1 Von 3
Lehrbetriebsübersicht Bezirk Gmunden Seite 1 von 3 ForstfacharbeiterIn Fischthaller Maximilian Österreichische Bundesforste Westumfahrung 38, 4810 Gmunden Forstbetrieb Bad Ischl Wirerstraße 6, 4820 Bad Ischl Kofler Norbert Hüttwinkel 1, 4663 Laakirchen Österreichische Bundesforste Forstbetrieb Traun-Innviertel Neff Claudia und Johann Steinkoglstraße 25, 4802 Ebensee Offenseestraße 10, 4802 Ebensee Österreichische Bundesforste Forsttechnik Steinkoglstraße 25, 4802 Ebensee HolztechnikerIn Löberbauer Christoph Landstraße 74, 4645 Grünau im Almtal ZimmererIn | ZimmereitechnikerIn | FertigteilhausbauerIn Amering Thomas Karl Kieninger Bau GmbH Sonnenweg 1, 4656 Kirchham Sternberg 4, 4812 Pinsdorf Brandl BaugmbH Schiffbänker Klaus Traunkai 18, 4820 Bad Ischl Leherbauernweg 9, 4812 Pinsdorf Herwig Besendorfer GmbH Steinkogler Bau GmbH Edt 57, 4822 Bad Goisern Bahnhofstraße 48, 4802 Ebensee Holzbau Bammer GmbH Stern & Hafferl BaugmbH Obersperr 11, 4644 Scharnstein Kuferzeile 30, 4810 Gmunden Kieninger Bau GmbH Wolf Systembau GmbH Stambach 77, Fischerbühel 1, 4644 Scharnstein 4822 Bad Goisern am Hallstättersee Zeppetzauer Bau und Zimmerei GmbH Wolfganger Straße 7, 4820 Bad Ischl Lehrbetriebsübersicht Bezirk Gmunden Seite 2 von 3 TischlerIn | TischlereitechnikerIn - Planung/Produktion Baumgartner Andreas Lidauer Tischlerei GmbH Hummelbrunn 30, 4655 Vorchdorf Schloßberg 2, 4644 Scharnstein Feichtinger GmbH Mayr - Schulmöbel GmbH Laudachtal 51, 4816 Gschwandt Mühldorf 2, 4644 Scharnstein Franz Attwenger und Söhne GmbH Möbel-Baumgartner GmbH Guggenberg -

Senioren-Sportfest-Gschwandt 2017 ORTSGRUPPEN
Senioren-Sportfest-Gschwandt 2017 ORTSGRUPPEN Ortsgruppe Name Rang Punkte m/w Altmünster Almhofer Hans 4 148 m Altmünster Schögl Franziska 10 142 w Altmünster Wolfsgruber Karl 14 138 m Altmünster Höller Josef 26 130 m Altmünster Krenn Josef 43 117 m Altmünster Keinprecht Hans 45 116 m Altmünster Biedermann Käthe 51 114 w Altmünster SchiffbänkerWalpurga 59 111 w Altmünster Schiffbänker Elfriede 76 103 w Altmünster Würflinger Gerhard 76 103 m Altmünster Ferstl Elfriede 81 102 w Altmünster Kubista Burgi 94 93 w Altmünster Schögl Mathias 104 87 m Altmünster Zeirzer Josef 104 87 m Altmünster Langer Udo 117 81 m Altmünster Ferstl Heinz 121 80 m Altmünster Schögl Josef 128 77 m Altmünster Voglgruber Ingeborg 130 72 w Altmünster Voglgruber Josef 130 72 m Altmünster Schögl Cäcilia 140 65 w Altmünster Höller Sigrid 151 53 w Altmünster Kaiser Erika 160 23 w Altmünster Schiffbänker Johann 161 1 m Altmünster Wolfsgruber Waltraud 161 1 w Bad Goisern Kogler Mandlmayr Christine 43 117 w Bad Goisern Krummböck Erika 61 109 w Bad Goisern Mandlmayr Johann 90 95 m Bad Ischl Floß Josef 16 137 m Bad Ischl Stibl Peter 24 131 m Bad Ischl Stibl Christl 66 106 w Bad Ischl Strubreiter Agnes 72 104 w Bad Ischl Luther Hedwig 76 103 w Bad Ischl Taborsky Rosa 111 84 w Bad Ischl Wallner Irmi 113 83 w Bad Ischl Trabesiner Helga 140 65 w Bad Ischl Floß Margarete 144 59 w Bad Ischl Eisl Julia 146 56 w Bad Ischl Gamperl Helene 146 56 w Bad Ischl Neumeister Ilse 161 1 w Bad Wimsbach Huemer Veronika 18 135 w Bad Wimsbach Hitzenberger Marianne 41 118 w Bad Wimsbach Kettl Theresia -
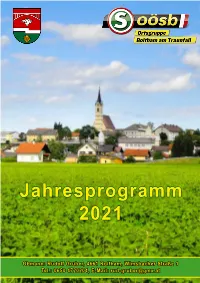
Jahresprogramm 2021
Jahresprogramm 2021 Obmann: Rudolf Gruber, 4661 Roitham, Wimsbacher Straße 1 Tel.: 0650 4720204, E-Mail: [email protected] Jahresprogramm 2021 Liebe Mitglieder! Jedes Jahr bemüht sich der Altbauern- und Seniorenbund für seine Miglie- der ein umfangreiches Programm zu erstellen. Bedingt durch die Corona-Pandemie musste unser Programm im vergan- genen Jahr auf ein Minimum reduziert werden. Ein gemeinsames Treffen war fast nie möglich. Den geplanten 4-Tagesausflug nach Südtirol, ge- meinsam mit dem Seniorenbund Laakirchen, mussten wir auf heuer ver- schieben. Unsere alljährliche Adventfeier konnte ebenfalls nicht abgehal- ten werden. Für das Jahr 2021 hoffen wir, dass wir uns wieder öfter treffen können. Wir haben daher wieder ein Programm für unsere Mitglieder zusammenge- stellt. Ausflüge, die wir 2020 nicht machten konnten, haben wir für heuer vorgesehen. Der im Jahr 2020 geplante Bezirks-Wandertag, der ebenfalls abgesagt werden musste, wird am 2. September 2021 in Roitham abge- halten. Zu den Kegelabenden werden wir kurzfristig einladen. Wir hoffen, dass es im heurigen Jahr wieder möglich sein wird, an ge- meinsamen Aktivitäten des Seniorenbundes teilzunehmen und die Freiheit wieder zu genießen. Der Obmann: Rudolf Gruber 2 Funktionäre Obmann Rudolf Gruber 0650 4720204 1. Obmann Stellvertreterln Inge Ziegler 0677 61350253 2. Obmann Stellvertreter Johann Niederhauser 0664 73450748 Schriftführer Franz Helmberger 0688 8236917 Kassier Hermann Heimberger 0664 3553450 Kulturreferent Elisabeth Auinger 0660 8319905 Sportreferent Georg Schubert 0699 11913329 Beiräte / Sprengelbetreuer Berta Waldl Pfarrhofstraße 9 0664 2200913 Josef Gasser Lindacherstraße 27 0650 4922120 Ernst Stöttinger Wangham 15 07613 5388 Monika Bachmayr Außerroh 4 07613 5208 Anna Hiesmair Deising 4 07613 5216 Franziska Dollberger Vornbuch 7 07613 5506 Franz Quirimayr Palmsdorf 16 0699 17237442 Michael Oder Nöstling 2 07613 5215 Romana Grabner Außerpühret 39 0664 9419460 3 Erlebniswelt KTM Motohall Mattighofen Donnerstag, 22. -

Naturraumkartierung Oberösterreich
Naturraumkartierung Oberösterreich Biotopkartierung Gemeinde Kirchham natur raum Endbericht Naturraumkartierung Oberösterreich Naturraumkartierung Oberösterreich Biotopkartierung Gemeinde Kirchham Endbericht Kirchdorf an der Krems, Salzburg, 2006 Biotopkartierung Gemeinde Kirchham Projektleitung Naturraumkartierung Oberösterreich: Mag. Kurt Rußmann Projektbetreuung Biotopkartierung: Mag. Ferdinand Lenglachner, DI Franz Schanda, Mag. Günter Dorninger EDV/GIS-Betreuung Mag. Günter Dorninger Auftragnehmer: REGIOPLAN INGENIEURE Salzburg GmbH Schillerstraße 30 A-5020 Salzburg Tel. +43 / 662 / 45 16 22-0 Fax +43 / 662 / 45 16 22-20 Email [email protected] Internet http://www.regioplan.com Geländearbeiten: Ökokart Gesellschaft für Ökologische Auftragsforschung GbR Wasserburger Landstraße 151 D-81827 München Tel. +49 / 89 / 439 87 435 Fax +43 / 89 / 439 87 436 Email [email protected] Internet http://www.oekokart.de GIS-Bearbeitung: ICRA Dumfarth & Schwap OEG Lilli-Lehmann-Gasse 4 A-5020 Salzburg Tel. +43 / 662 / 62 44 96-0 Fax +43 / 662 / 62 44 96-15 email [email protected] Internet http://www.icra.at natur raum 1 Naturraumkartierung Oberösterreich Biotopkartierung Gemeinde Kirchham Projektleitung: Dipl.-Ing. Andreas Knoll (REGIOPLAN INGENIEURE) Projektteam: Dr. Gabriele Anderlik-Wesinger (Ökokart) Dipl.-Ing. Erich Dumfarth (ICRA) Dipl.-Ing. Herwig Hadatsch (Ökokart) Dipl.-Biol. Monika Hess (Ökokart) Dipl.-Ing. Barbara Rainer (REGIOPLAN INGENIEURE) Dipl.-Ing. Alexander Schwap (ICRA) Dipl.-Ing. Cornelia Siuda (Ökokart) Mag. Stefanie Zobl (REGIOPLAN INGENIEURE) im Auftrag des Landes Oberösterreich, Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung OÖ Fotos Titelseite: Foto links: Laudach-Klamm Foto rechts: Orchidee Fotonachweis: alle Fotos Ökokart Redaktion: AG Naturraumkartierung Impressum: Medieninhaber: Land Oberösterreich Herausgeber: Amt der O ö. Landesregierung Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich 4560 Kirchdorf an der Krems Tel.: +43 7582 685 533 Fax: +43 7582 685 399 E-Mail: [email protected] Graphische Gestaltung: Mag. -

47. Internationales Saukopfspringen / 23.03.2019
47& 'nternationales Sauko)*sprin#en / 2+&0+&201$ ,eranstalter: Christian Reisenbichler, Feuerkogelhaus; Statistik: "(swert(n#: SBC Ebensee Teilnehmer: 46 Schüler 1+2 männlich 2004-2007 / Kleine Schanze Rang St.Nr. Name Wohnort Jahrgang 1.Sprung 2. Sprung Gesamt 2 1Großpointner Nico Ebensee 2005 8 7 8 3Hochreither Jakob Gschwandt 2007- 1 10Hametner Alexander Ebensee 2004 8 8 8 3 12Hametner Julian Ebensee 2006 6 6 6 13Ehrengast 5 4 Schüler 1+2 weiblich 2004-2007 / Kleine Schanze Rang St.Nr. Name Wohnort Jahrgang 1.Sprung 2. Sprung Gesamt 1 8Mattes Paula Ebensee 2007 5 5 Snowboar Schüler 1+2 männlich 2004-2007 / Kleine Schanze Rang St.Nr. Name Wohnort Jahrgang 1.Sprung 2.Sprung Gesamt 1 4Bäck David Ullrichsberg 2007 7,5 7 7,5 2 6Bäck Niklas Arnreit 2007 6,5 6,5 6,5 3 2Pröll Linus Aigen/Schlägl 2007 6 6,5 6,5 3 5Grieshofer Luca Altmünster 2007 6 6,5 6,5 3 8Moritz Kobler Arnreit 2007 5,5 6 6 7??? 7 !amen "ll#emeine Klasse 1$%$-1$$% / Kleine Schanze Rang St.Nr. Name Wohnort Jahrgang 1.Sprung 2. Sprung Gesamt 1 45Jaritsch Christina Ebensee 1994 6,5 7 7 1 47Hartl Alexandra St. Peter/Wimberg 1999 7 6,5 7 3 46Jaritsch Maria Ebensee 1997 6 7 7 4 36Huber Tanja Ebensee 1997 6,5 6 6,5 4 37Steinkogler Isabella Bad Ischl 1996 6 6,5 6,5 !amen Rang St.Nr. Name Wohnort Jahrgang 1.Sprung 2. Sprung Gesamt 1 52Spiessberger Manuela Ebensee 1967 6 5,5 6 2 53Brummer Silvia Ebensee 1966 5,5 5 5,5 3 22Schulz Katja Waltershausen/DE 1982 4,5 5,5 5,5 4 58Hametner Sabine Ebensee 1970 4 4,5 4,5 -(#en 1+2 männlich 1$$$-200+ / .rosse Schanze Rang St.Nr. -

Senioren-Sportfest-Gschwandt 2019 ORTSGRUPPEN
Senioren-Sportfest-Gschwandt 2019 ORTSGRUPPEN Ortsgruppe Name Rang Punkte m/w Altmünster Wolfsgruber Karl 3 144 m Altmünster Langer Udo 10 135 m Altmünster Ferstl Heinz 28 124 m Altmünster Voglgruber Josef 35 121 m Altmünster Schögl Matthias 56 112 m Altmünster Schögl Franziska 66 106 w Altmünster Höller Josef 68 105 m Altmünster Thalhamer Johann 71 103 m Altmünster Ferstl Elfriede 75 101 w Altmünster Keinprecht Johann 78 100 m Altmünster Biedermann Käthe 82 97 w Altmünster Almhofer Johann 84 96 m Altmünster Rosenauer Julia 93 93 w Altmünster Schögl Josef 95 92 m Altmünster Altmanninger Ingrid 98 91 w Altmünster Schögl Cilli 98 91 w Altmünster Hitzenberger Brigitte 110 83 w Altmünster Schiffbänker Johann 127 79 m Altmünster Kaiser Erika 134 75 w Altmünster Schiffbänker Walburger 137 74 w Altmünster Wolfsgruber Waltraud 150 65 w Altmünster Zeizer Josef 153 62 m Altmünster Hödl Horst 157 59 m Altmünster Klein Elfi 160 53 w Altmünster Zopf Bettina 164 50 w Altmünster Pesendorfer Theresia 165 49 w Altmünster Voglgruber Ingeborg 168 47 w Altmünster Schweiger Ottilie 169 45 w Altmünster Mühlegger Carina ausser B. 171 43 w Bad Ischl Floss Josef 11 134 m Bad Ischl Taborsky Rosa 115 82 w Bad Ischl Kohlberger Margarethe 141 71 w Bad Ischl Dögl Doriet 153 62 w Bad Ischl Wallner Irmi 155 61 w Bad Ischl Trabesiner Helga 166 48 w Bad Ischl Floss Margarete 175 36 w Bad Ischl Luther Hedwig 177 21 w Bad Ischl Taborski Rosina 179 1 w Gmunden Rapberger Albert 16 130 m Gmunden Pühringer Helmut 23 127 m Goisern Anlanger Elisabeth 45 116 w Goisern Mandlmayr -

Aktuelle Gemeinde
Amtliche MiƩeilung - Zugestellt durch Post.at Gemeindezeitung Grünau im Almtal Grünau im Almtal Folge 2/2018 www.gruenau.at Gemeindezeitung Die Bürgermeister Nabaffa und Bammer feiern Gemeindepartnerscha in Idro Foto: Leo Meiseleder Impressum Aus dem Inhalt Medieninhaber und Herausgeber: Gemeinde Grünau im Almtal i Bericht des Bürgermeisters ............................................ 2 4645 Grünau im Almtal, Im Dorf 17 Tel.-Nr. 07616/8255-0 (Fax-DW 4) i GemeindepartnerschaŌsfest in Idro .............................. 3 Erscheinungsort: 4645 Grünau im Almtal i Verleihung Oberschulrat/Silbernes Verdienstzeichen .... 7 Für den Inhalt verantwortlich: i Grünau golŌ ................................................................ 10 Bürgermeister Wolfgang Bammer Gemeinde Grünau im Almtal i Stockschützen gewinnen MeisterƟtel .......................... 17 Redakon und Layout: Bammer Helga, [email protected] i 5. Biologicum Almtal .................................................... 18 Hersteller/Druckerei: i SelbstschutzƟpp „Kindersicherer Haushalt“.................20 Druckerei Haider, 4274 Schönau Gemeindezeitung Grünau im Almtal besonders, dass so viele Kinder aus unserer Ge- meinde daran teilgenom- men haben. Zubau im Kindergarten Gemeinsam mit der Unter- stützung von Landesrätin Mag. Christine Haberlan- der ist es nun möglich, den vor fast zehn Jahren als Provisorium aufgestellten Containeranbau für die vierte Kindergartengruppe durch einen modernen Zubau zu ersetzen. Der Finanzierungsplan wurde bereits im Gemeinderat beschlossen und -

Vorchdorfer Tipp 1 NR
VORchdorfer Tipp 1 NR. 221 - OKTOBEROktober 2017 2017 ÖSTERREICHISCHE POST AG, RM 94A465501 K, 4655 VORCHDORF. AUFLAGE: 17.200 EXEMPLARE VORCHDORF, LAAKIRCHEN, ROITHAM, BAD WIMSBACH-N., STEINERKIRCHEN/TRAUN, EBERSTALZELL, PETTENBACH, SCHARNSTEIN, GRÜNAU, ST. KONRAD, GSCHWANDT, KIRCHHAM BNP Wirtschaftstreuhand und Steuerberatungs GmbH [email protected] , www.bnp.at Ihr Spezialist für Eheringe: Ihr Spezialist für Heizung, Bad und Sanitär! Der topaktuelle Steuertipp zum Thema Sozial- Am 11. und 12. 11. bei der Hochzeitsmesse! www.amering.at versicherungs-Zuordnungsgesetz auf Seite 8. Vernetzte Frauenpower! „Die Welt einer Frau“ erstmals in Vorchdorf als Themenherbst und Podiumsdiskussion Foto: vorchdorfmedia e.U. vorchdorfmedia Foto: Mit einem achtteiligen Themenherbst startete der Verein Kitzmantelfabrik mit Kuratorin Mag. Marle- ne Elvira Steinz (zweite von rechts). Unter dem Titel „Die Welt einer Frau“ gliedert sich der Themen- herbst in vier historischen Vorträge, eine Fahrt nach Wien, einem Jazz-Konzert, ein Kabarett und eine Podiumsdiskussion. Für letztere hat die engagierte Vorchdorferin eine hochkarätige Diskussi- onsrunde von erfolgreichen Frauen aller Altersgruppen aus Politik, Wirtschaft und Kultur zusam- mengetrommelt. Jede Rednerin erzählt am 25. Oktober über ihre eigenen Erlebnisse, Erfahrungen und den erreichten Erfolg. Der Eintritt ist frei, im Anschluss gibt es bei Soul-Musik und kulinarischen Köstlichkeiten genug Zeit zum Vernetzen und Austauschen. Der Werbering unterstützt die Veran- WOHNWOCHEN ! staltung mit voller Frauenpower durch susanne anziehend (Susanne Maier, rechts) und SchnittVision 12. Okt – 23. Nov! (Lisa Thalinger, zweite von links). Der gesamte Reinerlös geht an den Vorchdorfer Sozialfonds „Wir Helfen“ mit Obfrau Christine Baumgartinger (links). Mehr Informationen erfahren Sie auf Seite 9. www.bam-wohnen.at VORchdorfer Tipp 2 Oktober 2017 AKTUELLES AUS DER 06. -

Ergebnisse 2015
Gesamtstrecke - Herren Nr. Name JG TN N Wohnort Ges. 222 Aichinger Dominik DI 1968 7 AT Wien 09:08 69 Albrecht Peter 1989 1 AT St. Lorenzen 11:18 20 Anzengruber Friedrich 1959 20 AT Haag am Hausruck 10:35 171 Asamer Franz Xaver 1956 8 AT Vöcklamarkt 11:45 113 Asamer Johannes 1989 3 AT Pinsdorf 14:40 109 Aschenberger Franz 1979 10 AT Vöcklamarkt 12:22 271 Auer Franz 1951 16 AT Eferding 16:29 198 Auer Peter DI 1977 16 AT Eferding 14:32 67 Baier Jan 1983 1 CZ Brloh 09:57 273 Baiger Peter 1973 1 AT Naarn 11:03 16 Baldinger Andreas 1988 2 AT Redlham 14:03 93 Benz Roman 1972 10 AT Wien 12:33 190 Berchtaler Jürgen Ing. 1977 2 AT Pinsdorf 17:05 115 Birlmüller Andreas 1989 3 AT Gschwandt 13:29 153 Birnbaumer Alexander 1983 1 AT Frankenburg 14:49 52 Birthelmer Kurt 1957 2 AT Scharnstein 14:23 255 Bloderer Franz 1971 7 AT Leonstein 13:24 100 Bosnjak Thomas 1975 1 AT Gmunden out 213 Bracher Franz 1962 7 AT Laakirchen 12:08 269 Bramberger Johannes 1991 1 AT Gmunden 10:33 4 Brandstetter Heinrich 1975 1 AT Bad Wimsbach out 218 Brein Christian 1980 5 AT Berg im Attergau 14:37 86 Breit Mike 1986 1 AT Guntramsdorf 16:11 124 Buchegger David 1990 3 AT Vorchdorf 10:10 152 Burgstaller Christoph Mag. 1976 1 AT Offenhausen 14:35 55 Burkhard Wolfgang 1970 2 AT Gmunden out 228 Böck Carl 1989 2 AT Vorderweissenbach out 184 Böttcher Florian 1980 1 AT Lasberg 13:24 268 Csegedi Imre Mr. -

Smart City Gmunden Ein Kooperatives Entwicklungskonzept Für Betriebe, Mobilität Und Raumentwicklung Der Region Gmunden
Blue Globe Report SmartCities #4/2016 Smart City Gmunden ein kooperatives Entwicklungskonzept für Betriebe, Mobilität und Raumentwicklung der Region Gmunden Technologiezentrum Salzkammergut GmbH VORWORT Die Publikationsreihe BLUE GLOBE REPORT macht die Kompetenz und Vielfalt, mit der die österreichische Industrie und Forschung für die Lösung der zentralen Zukunftsaufgaben arbeiten, sichtbar. Strategie des Klima- und Energiefonds ist, mit langfristig ausgerichteten Förderprogrammen gezielt Impulse zu setzen. Impulse, die heimischen Unternehmen und Institutionen im internationalen Wettbewerb eine ausgezeichnete Ausgangsposition verschaffen. Jährlich stehen dem Klima- und Energiefonds bis zu 150 Mio. Euro für die Förderung von nachhaltigen Energie- und Verkehrsprojekten im Sinne des Klimaschutzes zur Verfügung. Mit diesem Geld unterstützt der Klima- und Energiefonds Ideen, Konzepte und Projekte in den Bereichen Forschung, Mobilität und Marktdurchdringung. Mit dem BLUE GLOBE REPORT informiert der Klima- und Energiefonds über Projektergebnisse und unterstützt so die Anwendungen von Innovation in der Praxis. Neben technologischen Innovationen im Energie- und Verkehrsbereich werden gesellschaftliche Fragestellung und wissenschaftliche Grundlagen für politische Planungsprozesse präsentiert. Der BLUE GLOBE REPORT wird der interessierten Öffentlichkeit über die Homepages www.klimafonds.gv.at sowie www.smartcities.at zugänglich gemacht und lädt zur kritischen Diskussion ein. Der vorliegende Bericht dokumentiert die Ergebnisse eines Projekts aus dem -

Pfarrblatt Ostern 2021
Ostern 2021 Pfarrblatt Gschwandt DER NEUE Ruf • Karwoche und Ostern • Abschluss Innenrenovierung • Segensdecke fertig • Erstkommunion • Firmung • Zukunftsweg der Kirche ... und vieles mehr erwartet euch in diesem Pfarrblatt Kraftquellen Denn bei dir, oh Gott, ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht schauen wir das Licht. Psalm 36,10 48. Ausgabe Pfarrblatt Gschwandt DER NEUE Ruf Liebe Pfarrgemeinde! Wenn ich in eigentlich Lockdown ist“, hat vor gemeinsamen Saals mit der Ge- diesen Wochen kurzem jemand bemerkt. Ja, ich meinde. Ich bitte in dieser Frage bei Spazier- freue mich, dass es uns gelingt auch um euer Gebet für gute Ent- gängen oder das Pfarrleben ANDERS und doch scheidungen! am Telefon mit lebendig und herzlich zu gestalten Menschen ins und immer wieder Impulse und Ge- Planungen sind in dieser Zeit Gespräch kom- schenke für zu Hause mitzugeben. schwierig. Deshalb verzichten wir in me, dann höre Herzlichen Dank, dass ihr euch auf diesem Pfarrblatt auch weitgehend ich immer wieder Sätze wie „Es die immer wieder neuen Vorgaben auf Termine. Über die Verlautba- wird jetzt einfach schon lange…“ und Regeln einlasst. Wer hätte rungen, Homepage und pfarrliche Ja, viel Durchhalten ist von uns al- noch vor einem Jahr gedacht, dass WhatsApp-Gruppe werden diese len gefordert in dieser Zeit der Pan- wir einmal Platzkarten für den Kir- aber zeitgerecht bekanntgegeben. demie. Eine zweite Karwoche und chenbesuch brauchen werden? ein weiteres Osterfest im Corona- Danke allen, die gewissenhaft nur So wünsche ich euch, dass sich Modus erwarten uns. Da ist es hilf- die Anzahl an Karten mitnehmen, gerade in dieser Zeit der Unsicher- reich uns auf unsere Kraftquellen die sie wirklich benötigen. -

Raumeinheit Unteres Almtal
NATUR UND LANDSCHAFT / LEITBILDER FÜR OBERÖSTERREICH BAND 39.: UNTERES ALMTAL Band 39 Raumeinheit Unteres Almtal Amt der Oö.Landesregierung, Naturschutzabteilung In Zusammenarbeit mit grün integral – Technisches Büro für Landschaftsplanung Bearbeiter: Karin Fuchs Helga Gamerith Stefan Guttmann Wolfgang Hacker Elke Holzinger Michael Strauch Linz, September 2007 Projektleitung: Projektbetreuung: Dipl.-Ing. Helga Gamerith Stefan Guttmann BÜRO GRÜN INTEGRAL / NATURSCHUTZABTEILUNG LAND OÖ SEITE 1 NATUR UND LANDSCHAFT / LEITBILDER FÜR OBERÖSTERREICH BAND 39.: UNTERES ALMTAL INHALTSVERZEICHNIS I Natur und Landschaft – Leitbilder für Oberösterreich 4 I.I Wozu Leitbilder für Natur und Landschaft? 4 I.II Ziele und Aufgaben der Leitbilder 4 I.III Projektstruktur 7 I.IV Leitbilder in der Praxis 7 II Raumeinheit Unteres Almtal 10 A Charakteristik der Raumeinheit 11 A1 Verwendete Grundlagen / Quellen 11 A2 Lage und Abgrenzungen 11 A2.1 Lage 11 A2.2 Abgrenzung von Untereinheiten 14 A3 Zusammenfassende Charakteristik Raumeinheit 14 A4 Zusammenfassende Charakteristik Untereinheiten 14 A5 Standortfaktoren 14 A5.1 Geologie 14 A5.2 Boden 16 A5.3 Klima 17 A5.4 Gewässersystem 18 A6 Raumnutzung 21 A6.1 Siedlungswesen / Infrastruktur 21 A6.2 Erholung / Tourismus 22 A6.3 Landwirtschaft 23 A6.4 Forstwirtschaft 24 A6.5 Jagd 25 A6.6 Rohstoffgewinnung 25 A6.7 Energiegewinnung 26 A6.8 Trinkwassernutzung 26 A6.9 Fischerei 27 A7 Raum- und Landschaftscharakter 28 A7.1 Lebensraum 28 A7.1.1 Leitstrukturen und Beziehungen zu angrenzenden Raumeinheiten 28 A7.1.2 Lebensraumtypen