Regierungsbildung 2006/2007
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
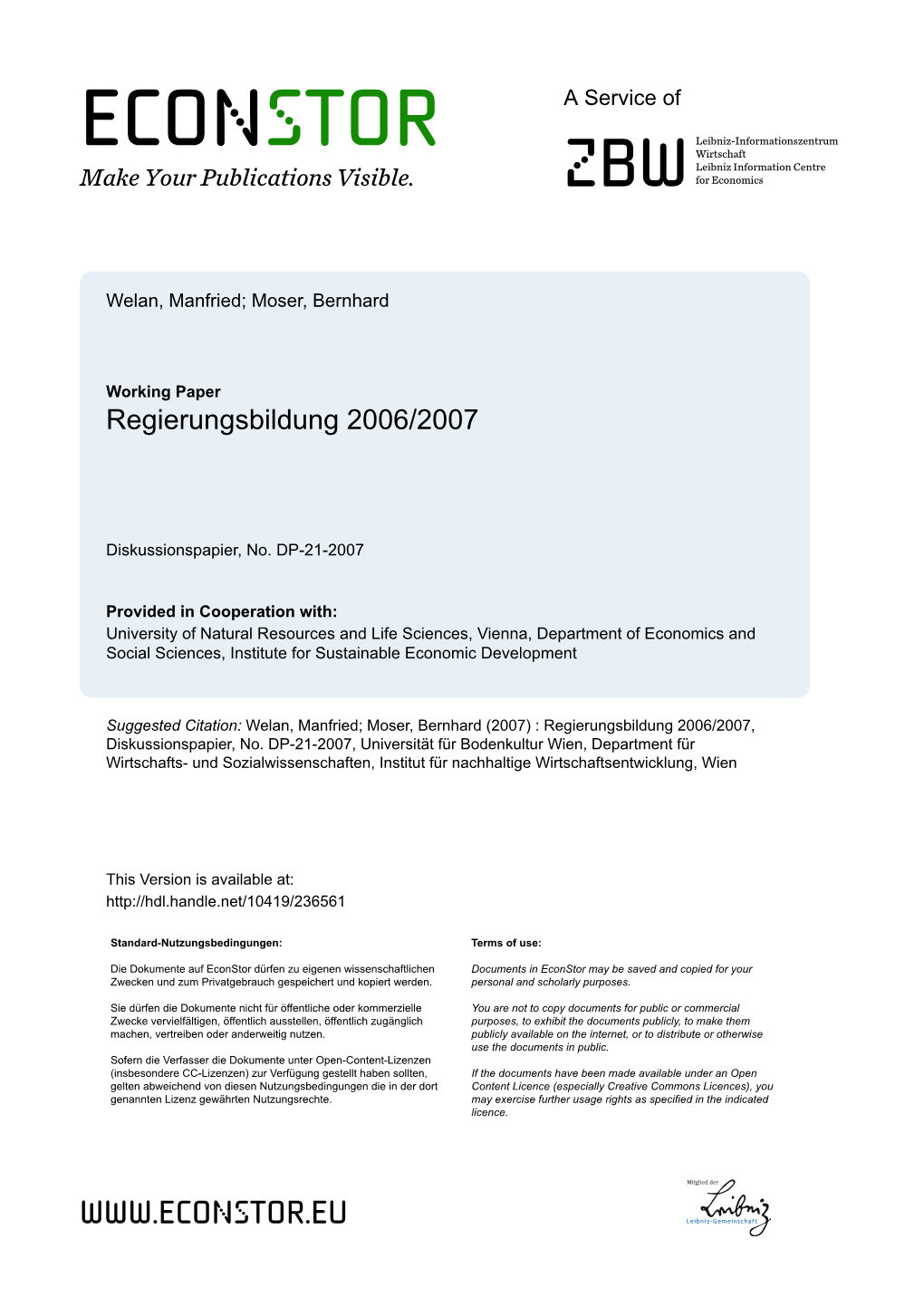
Load more
Recommended publications
-

Hauptakteurskatalog Zur Medienanalyse Nationalratswahl 2008
Austrian National Election Study (AUTNES) Appendix B Hauptakteurskatalog zur Medienanalyse Nationalratswahl 2008 AUTNES Media Side – Mass Media Coverage and Effects (FWF-Projektnummer: S10904-G11) AUTNES – Innsbruck | Media Side Austrian National Election Study Institut für Politikwissenschaft UNIVERSITÄT INNSBRUCK Endversion: Mai 2010 HAUPTAKTEURSKATALOG Der Akteurskatalog differenziert grundsätzlich zwischen individuellen Personen-Akteuren (Bundeskanzler, MinisterInnen etc.) und kollektiven Organisations-Akteuren (SPÖ, Landtag, Bundesland, Institutionen, Unternehmen etc.). Organisations-Akteure und Kategorien sind im Katalog durch Großschreibung gekennzeichnet. Nicht großgeschriebene Kategorien sind solche, die grundsätzlich nur individuelle Personen-Akteure (als Einzel- oder Sammelkategorie) erheben. Während die Kategorie „Spitzenkandidat SPÖ“ nur die Person Werner Faymann betrifft, existieren im Katalog sowohl individuelle als auch kollektive Sammelkategorien, in die all jene individuellen und kollektiven Akteure codiert werden, die zu diesem Personenkreis bzw. Organisationskreis gehören (z.B. ÖffentlichkeitsarbeiterInnen der Ministerien, Landtage). Akteure, die somit im Akteurskatalog nicht explizit und dezidiert angeführt sind, werden der betreffenden, übergeordneten Sammelkategorie zugeordnet. Wenn ein Akteur grundsätzlich mehreren Sammelkategorien zugeordnet werden kann (z.B. Peter Pilz könnte sowohl in die Kategorie Mitglieder des grünen Clubs im Parlament als auch in die Kategorie VertreterInnen der grünen Bundespartei fallen), -

Stenographisches Protokoll
Stenographisches Protokoll 55. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich XXII. Gesetzgebungsperiode Mittwoch, 24. März 2004 1 Stenographisches Protokoll 55. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich XXII. Gesetzgebungsperiode Mittwoch, 24. März 2004 Dauer der Sitzung Mittwoch, 24. März 2004: 9.00 – 22.33 Uhr ***** Tagesordnung 1. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Karenzurlaubszuschussgesetz und das Karenz- geldgesetz, das Karenzurlaubsgeldgesetz und das Kinderbetreuungsgeldgesetz geän- dert werden 2. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Ausländerbeschäftigungsgesetz und das Arbeitslosenversicherungsgesetz geändert werden (EU-Erweiterungs-Anpassungsge- setz) 3. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Arbeitszeitgesetz und das Arbeitsruhegesetz geändert werden 4. Punkt: Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Art. 15a B-VG über gemeinsame Maßnahmen zur vorübergehenden Grundversorgung für hilfs- und schutzbedürftige Fremde (Asylwerber, Asylberechtigte, Vertriebene und andere aus rechtlichen oder faktischen Gründen nicht abschiebbare Menschen) in Österreich (Grundversorgungsvereinbarung – Art. 15a B-VG) 5. Punkt: Bericht und Antrag über den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesbetreuungsgesetz geändert wird 6. Punkt: Übereinkommen über die Beteiligung der Tschechischen Republik, der Re- publik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik am Europäischen Wirtschaftsraum -

Diss Final Final Final
DISSERTATION Titel der Dissertation Der irreguläre Pflegearbeitsmarkt. Zum Transformationsprozess von unbezahlter in bezahlte Arbeit durch die 24-Stunden-Pflege Verfasserin Mag. Almut Bachinger angestrebter akademischer Grad Doktor der Philosophie (Dr. phil.) Wien, 2009 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 092 300 Dissertationsgebiet lt. Studienblatt: Politikwissenschaft Betreuerin: Univ.-Prof. Dr. Sieglinde Rosenberger 2 Inhaltsverzeichnis Tabellenverzeichnis ............................................................................................................................. 5 Abbildungsverzeichnis ........................................................................................................................ 6 Abkürzungsverzeichnis ....................................................................................................................... 7 Einleitung ................................................................................................................................................ 8 1 Theoretischer Rahmen ................................................................................................................... 20 1.1 Haus- und Sorgearbeit ........................................................................................................... 20 1.2 Transmigration und Mobilität ............................................................................................... 36 1.3 Resümee ............................................................................................................................... -

Politik & Wirtschaft
Repräsentation und Partizipation von Frauen in Politik und Wirtschaft Kapitel 8 Repräsentation und Partizipation von Frauen in Politik und Wirtschaft Frauenbericht 2010 Teil I: Statistische Analysen zur Entwicklung der Situation von Frauen in Österreich 351 Repräsentation und Partizipation von Frauen in Politik und Wirtschaft Inhaltsverzeichnis Das Wichtigste in Kürze...................................................................................................353 Results at a glance...........................................................................................................354 8 Repräsentation und Partizipation von Frauen in Politik und Wirtschaft................355 8.1 Repräsentation von Frauen im europäischen Vergleich...............................................355 8.2 Frauen in Parlamenten und Regierungsämtern...........................................................360 8.2.1 Frauen im Nationalrat........................................................................................360 8.2.2 Frauen in der Bundesregierung.........................................................................362 8.2.3 Frauen in den Landesregierungen....................................................................365 8.2.4 Frauen in den Landtagen..................................................................................366 8.2.5 Frauen als Bürgermeisterinnen.........................................................................367 8.3 Frauen und Männer in Parteien und Interessenvertretungen.......................................368 -

Outline Programme
Programme (Sessions and speakers may still be subject to change) Sunday 30th November – Day 1 08:30 Registration opens 09:30 – 10:45 Workshops and Tutorials (individual registration required) Improving the Riga Dashboard for Web Accessibility: Solutions & Strategies – W1 Microsoft and HiSoftware 10:45 Coffee Break 11:30-12:45 Workshops and Tutorials (individual registration required) eInclusion: role of large Third Sector organizations W2 Improving the Riga Dashboard for Web Accessibility: Solutions & Strategies – W3 Microsoft and HiSoftware Spanish National Organisation for the Blind (ONCE) W4 European Commissions e-Inclusion policies and project: how can I be included? W5 Delivering Assistive Technology Services across Europe without barriers : New W6 Opportunities - New Options 12:00 Press Conference 12:30 Exhibition Opening Ceremony Erwin Buchinger, Federal Minister of Social Affairs and Consumer Protection, Austria Vladimír Špidla, European Commissioner for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Followed by: Tour of the exhibition Erwin Buchinger, Federal Minister of Social Affairs and Consumer Protection, Austria Vladimír Špidla, European Commissioner for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Heidrun Silhavy, Federal Minister for Women, Media and Regional Policy, Austria Paul Rübig, Member of the European Parliament 12:45 Buffet Lunch Master of Ceremonies: Wolfgang Blau 13:45 Welcome and keynote addresses PL1 Alfred Gusenbauer, Federal Chancellor, Austria Vladimír Špidla, European Commissioner for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Eric Besson, Minister of State to the Prime Minister, with responsibility for Forward Planning, Assessment of Public Policies and Development of the Digital Economy, France e-Inclusion: the real story - a selection of personal tales highlighting the positive impact ICT has had on their lives − Frieda Spielmann, Austria − Jamshid Kohandel, France − Rhodri Buttrick, United Kingdom Craig R. -

 Transparenzinitiative "Meine Abgeordneten"
Politik | Termine | Kultur | Kommentar | Initiativen | Wissenschaft | Life | Herstory | Sitemap | Suche » Innenpolitik International Europa Frauenrechte Wirtschaft & Arbeit Medien Startseite  » Artikel » Politik » Innenpolitik » Transparenzinitiative "Meine Abgeordneten" ist zwei Jahre alt >> Innenpolitik (2.12.2013) Im November 2011 startete die Initiative "Meine (Kein) Koalitionskonflikt um das Abgeordneten", die mittlerweile 550 PolitikerInnen auf Landes-, Bundesheer... Bundes- und EU-Ebene erfasst hat. Den Anstoss gab Respekt.net- Welche Frauenpolitik braucht Präsident Martin Winkler, der gemeinsam mit UnterstützerInnen bei Österreich?... einer Pressekonferenz Bilanz zog. Es war, erinnert er sich, für die Integrationsunw illige "politische Kaste" neu, ihre Funktionen offenzulegen. "Meine MuslimInnen?... Abgeordneten" ist eines der über Respekt.net finanzierten Projekte, in Vortrefflicher Staat - neue Zivilgesellschaft?... dem tausende Stunden an Recherche, Einarbeiten und Aufbereiten von Informationen steckt. Wir haben eine Regierung!... Darf eine Familienministerin Natürlich muss die Seite auch laufend aktualisiert werden, schon allein, kinderlos sein?... weil etwa ein Drittel der 183 Abgeordneten neu im Parlament sind, für Dohnal und Bures - fairer Vergleich?... sie teilweise andere auf anderen Ebenen nachrücken. Marion Breitschopf zeichnet als Chefredakteurin für "Meine Abgeordneten" Hat sich w as verändert?... verantwortlich und sagt, dass die Recherche damit verbunden war, Internationaler Frauentag 2007... "sich einige Klagen anhören zu müssen". Denn es war ungewohnt, wo Statements zum Frauentag... die Parteien unter politischer Kommunikation meist nur verstehen, in Diskussion mit Bures und Marek... Wahlkampfen an die WählerInnen heranzutreten. Dass es Porno in der PolitikerInnen hilft, wenn WählerInnen jederzeit Informationen zur Landesverteidigungsakademie... Verfügung haben, wenn sie wissen, wer sie vertritt, war vielen nicht Grüne wollen Budget-Veto der einsichtig. -

Politikszene 17.1
politik & Ausgabe Nr. 121 kommunikation politikszene 17.1. – 23.1.2007 Richard Gaul berät BDI Der langjährige Leiter Konzernkommunikation und Politik von BMW, Richard Gaul (60), hat zum Jahresbeginn gemeinsam mit seiner Frau Sibylle Zehle die Zehle-Gaul-Communications gegründet. Er berät den Bun- desverband der Deutschen Industrie (BDI) beim Umbau der Kommunikationsstrukturen. Weiterer Kunde: Der Acatech – Konvent für Technikwissenschaften, der voraussichtlich ab 2008 als Deutsche Akademie der Tech- nikwissenschaften firmieren wird. Richard Gaul Bucksteeg geht zu Deekeling Arndt Advisors Mathias Bucksteeg (40) ist neuer Geschäftsführer bei Deekeling Arndt Advisors in Berlin. Das Beratungs- unternehmen baut mit dieser Personalie die politische Kommunikation weiter aus. Bucksteeg, Mitglied im Zukunftsforum 2020 des FDP-Bundesvorstands, war zuletzt als Direktor Deutschland bei Prognos für die Be- ratung verschiedener Bundesministerien zuständig. Politische Sporen erarbeitete sich der studierte Historiker als Mitarbeiter von Bodo Hombach, unter anderem in der ersten SPD-Kampa. Von 1998 bis 2002 leitete er das Mathias Bucksteeg Referat „Politische Planung und Grundsatzfragen“ in Bundeskanzleramt. Regierung in Österreich gebildet Österreichs Regierung ist komplett: Kanzler Alfred Gusenbauer (46, SPÖ) führt ein Kabinett aus Sozialdemo- kratischer Partei Österreichs (SPÖ) und Österreichischer Volkspartei (ÖVP). Die SPÖ stellt folgende Ressorts- chefs: Werner Faymann (46, Verkehr, Innovation, Technologie), Claudia Schmied (47, Bildung, Wissenschaft, Kultur), Maria Berger (50, Justiz), Norbert Darabos (42, Verteidigung), Erwin Buchinger (51, Soziales, Generationen, Konsumentenschutz) und Doris Bures (44, ohne Portefeuille). Für die ÖVP am Kabinettstisch: Alfred Gusenbauer Wilhelm Molterer (51, Vizekanzler, Finanzen), Ursula Plassnik (50, Auswärtiges), Günther Platter (52, Inne- res), Andrea Kdolsky (44, Gesundheit, Frauen), Josef Pröll (38, Land-, Forst- und Wasserwirtschaft, Umwelt), Martin Bartenstein (53, Wirtschaft, Arbeit) und Johannes Hahn (49, ohne Portefeuille). -

Diplomarbeit
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by OTHES DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Mediale Selbstinszenierung in der Politik Eine Analyse der öffentlichen Auftritte der Bundesministerin für Gesundheit, Familie und Jugend Andrea Kdolsky Verfasserin Sylvia Anna Ertl angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Maga. phil.) Wien, 2009 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 317 Studienrichtung lt. Studienblatt: Theater-, Film- und Medienwissenschaft Betreuerin / Betreuer: Ao. Univ.-Prof. Dr. Brigitte Marschall 2 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ………………………………………………………..……........ 4 2 Begriffe ………………………………………………………..………........ 9 2.1 Inszenierung ……………………………………………………..…………. 9 2.2 Politische Inszenierung – Politik als Theater ………………………………. 13 2.3 Begriffsabgrenzung Selbstdarstellung - Selbstinszenierung ……………….. 17 2.3.1 Selbstdarstellung im alltäglichen Leben …………………………………… 18 2.3.2 Selbstinszenierung …………………………………………………………. 21 3 Selbstinszenierung in der Politik ………………………………………… 27 3.1 Historischer Hintergrund der politischen Selbstinszenierung …………....... 29 3.2 Aktueller Entwicklungsstand in der Politik ………………………………... 33 3.2.1 Allgemeine Entwicklungen in der Politik …………………………………. 33 3.2.2 Personalisierung ……………………………………………………………. 35 3.2.3 Die politische Situation in Österreich ……………………………...………. 38 3.3 Das Verhältnis von Politik, Medien und Bürger …….………………........... 39 3.4 Inhalt der Selbstinszenierung ………………………………………………. 44 3.4.1 Das Selbst ……………………………………………...…………………… 45 3.4.2 -

Stenographisches Protokoll Der 9. Sitzung / PDF, 1604 KB
Stenographisches Protokoll 9. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich XXIII. Gesetzgebungsperiode Dienstag, 16., und Mittwoch, 17. Jänner 2007 1 Stenographisches Protokoll 9. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich XXIII. Gesetzgebungsperiode Dienstag, 16., und Mittwoch, 17. Jänner 2007 Dauer der Sitzung Dienstag, 16. Jänner 2007: 9.05 – 24.00 Uhr Mittwoch, 17. Jänner 2007: 0.00 – 1.04 Uhr ***** Tagesordnung Erklärung der Bundesregierung ***** Inhalt Nationalrat Trauerkundgebung anlässlich des Ablebens von Bundesministerin Liese Prokop ................................................................................................................... 16 Mandatsverzicht der Abgeordneten Dr. Martin Bartenstein, Dr. Alfred Brader, Dr. Ulrike Baumgartner-Gabitzer, Doris Bures, Mag. Norbert Darabos, Dr. Al- fred Gusenbauer, Dr. Reinhard Lopatka, Christine Marek, Dr. Christoph Matznetter, Mag. Wilhelm Molterer, Dr. Ursula Plassnik, Günther Platter und Heidrun Silhavy ..................................................................................................... 16 Angelobung der Abgeordneten Sonja Ablinger, Dkfm. Dr. Hannes Bauer, Michael Ehmann, Mag. Peter Eisenschenk, Mag. Peter Michael Ikrath, Ing. Norbert Kapeller, Jochen Pack, Katharina Pfeffer, Astrid Stadler, Gabriele Tamandl und Johannes Zweytick ......................................................... 17 Personalien Verhinderungen ...................................................................................................... 16 Geschäftsbehandlung Redezeitbeschränkung -

Diplomarbeit
Diplomarbeit Titel der Diplomarbeit „Frauen im Parlament – Zur Relevanz der Repräsentation von Frauen in der Gesetzgebung“ Verfasserin Verena Holzer angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. phil.) Wien, 2012 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 300 Studienrichtung lt. Studienblatt: Politikwissenschaft Betreuerin/Betreuer: Univ.-Doz. Dr. Johann Wimmer Inhaltsverzeichnis Widmung .......................................................................................................................... 4 1 Einleitung.................................................................................................................. 5 2 Parlamentarismus und Partizipation .................................................................... 10 2.1 Begriffsdefinition..................................................................................................... 10 2.1.1 Parlamentarismus ........................................................................................... 10 2.1.2 Partizipation .................................................................................................... 11 2.2 Entwicklung des österreichischen Parlamentarismus seit 1867.............................. 13 2.3 Funktionen des österreichischen Parlamentarismus............................................... 15 2.3.1 Gesetzesinitiativen .......................................................................................... 16 2.3.2 Organisatorische Elemente ............................................................................ -

Legislative Eliten in Österreich Rekrutierungsmuster Und Karriereverläufe
Legislative Eliten in Österreich Rekrutierungsmuster und Karriereverläufe Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Mag. rer. soc. oec. im Diplomstudium Soziologie Eingereicht von: Andreas Payer Angefertigt am: Institut für Soziologie Beurteilerin: Mag.a Dr.in Karin Fischer Juni 2015 Eidesstattliche Erklärung Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt beziehungsweise. die wörtlich oder sinngemäß entnommenen Stellen als sol- che kenntlich gemacht habe. Die vorliegende Diplomarbeit ist mit dem elektronisch übermittelten Textdokument identisch. ____________________ __________________________ Ort, Datum Unterschrift 2 Kurzfassung Funktionalistischen Überlegungen folgend wendet sich diese Arbeit einer Personen- gruppe zu, die durch ihre formale Position in der österreichischen Gesetzgebung eine wichtige Rolle spielen. Diese Personengruppe soll als „legislative Eli- te“ bezeichnet werde. Unter Zuhilfenahme vorhandenen biografischen Materials wer- den individuelle Karriereverläufe auf etwaige Rekrutierungsmuster untersucht und somit Strukturen aufgedeckt, die einen Aufstieg in diese Führungsrollen begünstigen. In diese Analyse gelangen dabei Personen des österreichischen Nationalrats, die im Untersuchungszeitraum 1996-2013 eine der folgenden Positionen inne hatten: Natio- nalratspräsident_in, Vorsitzende_r eines Fachausschusses beziehungsweise Parla- mentsklubobmann_frau. Neben einer theoretischen Klärung -

Wir Haben Eine Neue Bundesregierung Am 11
Ausg. Nr. 44 • 19. Jänner 2007 Unparteiisches, unabhängiges und kostenloses Magazin speziell für Österreicherinnen und Österreicher in aller Welt in vier verschiedenen pdf- Formaten • http://www.oe-journal.at Wir haben eine neue Bundesregierung Am 11. Jänner 2007 hat Bundespräsident Heinz Fischer – 99 Tage nach der Wahl – die neue Österreichische Bundesregierung angelobt. Die Zeremonie verlief in entspannter Atmosphäre. Bundeskanzler Alfred Gusenbauer sieht sich indes mit massiver Kritik, ja sogar mit Rücktrittsforderungen konfrontiert. Von Michael Mössmer. Bernhard J. Holzner / HOPI-MEDIA Am 11. Jänner 2007 wurde die neue Bundesregierung von Bundespräsident Heinz Fischer in in der Wiener Hofburg angelobt. Im Bild Bundespräsident Heinz Fischer (l.) mit Bundeskanzler Alfred Gusenbauer und Vizekanzler Wilhelm Molterer s ist eigentlich „verrückt“, was sich da in spielte in den Monaten vor der Wahl eine abzulösen. Doch so richtige Freude konnte Eden letzten Wochen abgespielt hat. Da Rolle, etwa der „BAWAG“-Skandal, nur um beim Wahlgewinner nicht aufkommen. Der gab es eine Wahl am 1. Oktober 2006, die – ein Beispiel zu nennen, das der Sozialdemo- von Bundespräsident Heinz Fischer mit der trotz aller Umfragen und Vermutungen – so kratie schwer zu schaffen machte. Das Er- Regierungsbildung beauftragte SPÖ-Vorsit- ganz anders ausging, als erwartet wurde. Die gebnis kam mehr als überraschend: die SPÖ zende Alfred Gusenbauer stand von Anfang ÖVP lag im Hoch, in der SPÖ dominierte erreichte (dank wesentlich geringerer Stimm- an unter massivem Druck – und das nicht der Wunsch, nach sieben Jahren Opposition verluste, als die ÖVP hinnehmen mußte) ihr nur von außen, sondern auch bis zum heuti- wieder an die Regierung zu kommen. Vieles Ziel, die so ungeliebte Vorgänger-Regierung gen Tag.