Geschichten Aus Der Geschichte
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
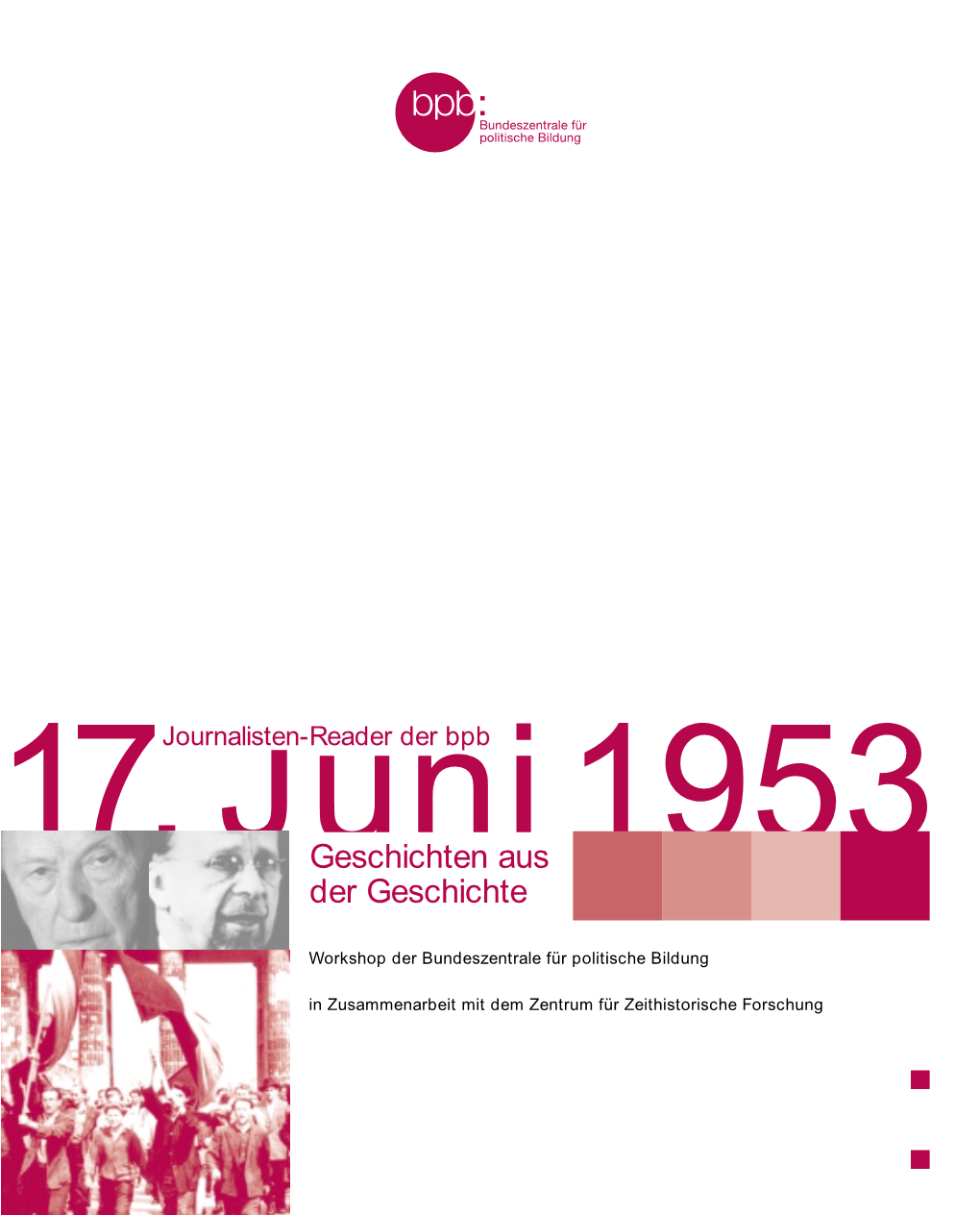
Load more
Recommended publications
-

Conclusion: How the GDR Came to Be
Conclusion: How the GDR Came to Be Reckoned from war's end, it was ten years before Moscow gave real existing socialism in the GDR a guarantee of its continued existence. This underscores once again how little the results of Soviet policy on Germany corresponded to the original objectives and how seriously these objectives had been pursued. In the first decade after the war, many hundreds of independent witnesses confirm that Stalin strove for a democratic postwar Germany - a Germany democratic according to Western standards, which must be explicitly emphasized over against the perversion of the concept of democracy and the instrumentalization of anti-fascism in the GDR. 1 This Germany, which would have to of fer guarantees against renewed aggression and grant access to the re sources of the industrial regions in the western areas of the defeated Reich, was to be established in cooperation with the Western powers. To this purpose, the occupation forces were to remain in the Four Zone area for a limited time. At no point could Stalin imagine that the occupation forces would remain in Germany permanently. Dividing a nation fitted just as little with his views. Socialism, the socialist revolution in Germany, was for him a task of the future, one for the period after the realization of the Potsdam democratization programme. Even when in the spring of 1952, after many vain attempts to implement the Potsdam programme, he adjusted himself to a long coexistence of the two German states, he did not link this with any transition to a separate socialism: the GDR had simply wound up having to bide its time until the Cold War had been overcome, after which it would be possible to realize the agree ments reached at Potsdam. -

Bulletin 10-Final Cover
COLD WAR INTERNATIONAL HISTORY PROJECT BULLETIN Issue 10 Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, D.C. March 1998 Leadership Transition in a Fractured Bloc Featuring: CPSU Plenums; Post-Stalin Succession Struggle and the Crisis in East Germany; Stalin and the Soviet- Yugoslav Split; Deng Xiaoping and Sino-Soviet Relations; The End of the Cold War: A Preview COLD WAR INTERNATIONAL HISTORY PROJECT BULLETIN 10 The Cold War International History Project EDITOR: DAVID WOLFF CO-EDITOR: CHRISTIAN F. OSTERMANN ADVISING EDITOR: JAMES G. HERSHBERG ASSISTANT EDITOR: CHRISTA SHEEHAN MATTHEW RESEARCH ASSISTANT: ANDREW GRAUER Special thanks to: Benjamin Aldrich-Moodie, Tom Blanton, Monika Borbely, David Bortnik, Malcolm Byrne, Nedialka Douptcheva, Johanna Felcser, Drew Gilbert, Christiaan Hetzner, Kevin Krogman, John Martinez, Daniel Rozas, Natasha Shur, Aleksandra Szczepanowska, Robert Wampler, Vladislav Zubok. The Cold War International History Project was established at the Woodrow Wilson International Center for Scholars in Washington, D.C., in 1991 with the help of the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation and receives major support from the MacArthur Foundation and the Smith Richardson Foundation. The Project supports the full and prompt release of historical materials by governments on all sides of the Cold War, and seeks to disseminate new information and perspectives on Cold War history emerging from previously inaccessible sources on “the other side”—the former Communist bloc—through publications, fellowships, and scholarly meetings and conferences. Within the Wilson Center, CWIHP is under the Division of International Studies, headed by Dr. Robert S. Litwak. The Director of the Cold War International History Project is Dr. David Wolff, and the incoming Acting Director is Christian F. -

Bulletin 10-Final Cover
COLD WAR INTERNATIONAL HISTORY PROJECT BULLETIN 10 61 “This Is Not A Politburo, But A Madhouse”1 The Post-Stalin Succession Struggle, Soviet Deutschlandpolitik and the SED: New Evidence from Russian, German, and Hungarian Archives Introduced and annotated by Christian F. Ostermann I. ince the opening of the former Communist bloc East German relations as Ulbricht seemed to have used the archives it has become evident that the crisis in East uprising to turn weakness into strength. On the height of S Germany in the spring and summer of 1953 was one the crisis in East Berlin, for reasons that are not yet of the key moments in the history of the Cold War. The entirely clear, the Soviet leadership committed itself to the East German Communist regime was much closer to the political survival of Ulbricht and his East German state. brink of collapse, the popular revolt much more wide- Unlike his fellow Stalinist leader, Hungary’s Matyas spread and prolonged, the resentment of SED leader Rakosi, who was quickly demoted when he embraced the Walter Ulbricht by the East German population much more New Course less enthusiastically than expected, Ulbricht, intense than many in the West had come to believe.2 The equally unenthusiastic and stubborn — and with one foot uprising also had profound, long-term effects on the over the brink —somehow managed to regain support in internal and international development of the GDR. By Moscow. The commitment to his survival would in due renouncing the industrial norm increase that had sparked course become costly for the Soviets who were faced with the demonstrations and riots, regime and labor had found Ulbricht’s ever increasing, ever more aggressive demands an uneasy, implicit compromise that production could rise for economic and political support. -
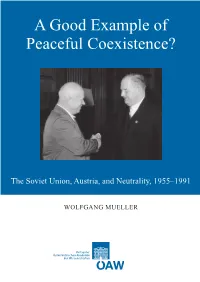
A Good Example of Peaceful Coexistence?
A Good Example of Peaceful Coexistence? The Soviet Union, Austria, and Neutrality, 1955–1991 WOLFGANG MUELLER WOLFGANG MUELLER A GOOD EXAMPLE OF PEACEFUL COEXISTENCE? THE SOVIET UNION, AUSTRIA, AND NEUTRALITY, 1955‒1991 ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN PHILOSOPHISCH-HISTORISCHE KLASSE HISTORISCHE KOMMISSION ZENTRALEUROPA-STUDIEN HERAUSGEGEBEN VON ARNOLD SUPPAN UND GRETE KLINGENSTEIN BAND 15 WOLFGANG MUELLER A Good Example of Peaceful Coexistence? The Soviet Union, Austria, and Neutrality 1955‒1991 Vorgelegt von w. M. Arnold Suppan in der Sitzung am 18. Juni 2010 Cover: The Austrian chancellor, Julius Raab (r.), welcomes Nikita Khrushchev in his office, 30 June 1960, photograph by Fritz Kern, Österreichische Nationalbibliothek – Bildarchiv, FO504632_4_48. Cover design: Oliver Hunger British Library Cataloguing in Publication data. A Catalogue record of this book is available from the British Library. Die verwendete Papiersorte ist aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt, frei von säurebildenden Bestandteilen und alterungsbeständig. Alle Rechte vorbehalten ISBN 978-3-7001-6898-0 Copyright © 2011 by Österreichische Akademie der Wissenschaften Druck und Bindung: Prime Rate kft., Budapest http://hw.oeaw.ac.at/6898-0 http://verlag.oeaw.ac.at Contents Acknowledgements ........................................................................................... 9 Introduction ....................................................................................................... 13 Soviet-Austrian relations, 1945–1955 ........................................................ -

Reexamining Soviet Policy Towards Germany During the Beria Interregnum”
WOODROW WILSON INTERNATIONAL CENTER FOR SCHOLARS REEXAMINING SOVIET POLICY Lee H. Hamilton, Christian Ostermann, Director Director TOWARDS GERMANY BOARD OF DURING THE BERIA INTERREGNUM TRUSTEES: ADVISORY COMMITTEE: Joseph A. Cari, Jr., Chairman JAMES RICHTER William Taubman Steven Alan Bennett, (Amherst College) Vice Chairman Bates College Chairman PUBLIC MEMBERS Michael Beschloss The Secretary of State (Historian, Author) Colin Powell; The Librarian of Congress James H. Billington James H. Billington; (Librarian of Congress) The Archivist of the United States Working Paper No. 3 John W. Carlin; Warren I. Cohen The Chairman of the (University of Maryland- National Endowment Baltimore) for the Humanities Bruce Cole; John Lewis Gaddis The Secretary of the Smithsonian Institution (Yale University) Lawrence M. Small; The Secretary of Education James Hershberg Roderick R. Paige; (The George Washington The Secretary of Health University) & Human Services Tommy G. Thompson; Washington, D.C. Samuel F. Wells, Jr. PRIVATE MEMBERS (Woodrow Wilson Center) Carol Cartwright, June 1992 John H. Foster, Jean L. Hennessey, Sharon Wolchik Daniel L. Lamaute, (The George Washington Doris O. Mausui, University) Thomas R. Reedy, Nancy M. Zirkin COLD WAR INTERNATIONAL HISTORY PROJECT THE COLD WAR INTERNATIONAL HISTORY PROJECT WORKING PAPER SERIES CHRISTIAN F. OSTERMANN, Series Editor This paper is one of a series of Working Papers published by the Cold War International History Project of the Woodrow Wilson International Center for Scholars in Washington, D.C. Established in 1991 by a grant from the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, the Cold War International History Project (CWIHP) disseminates new information and perspectives on the history of the Cold War as it emerges from previously inaccessible sources on “the other side” of the post-World War II superpower rivalry. -

Wilhelm Wanka Collection – Printed Books
Wilhelm Wanka Collection – Printed Books (Special Collections Room, University of Winnipeg Library, Centennial Hall, 515 Portage Avenue, Winnipeg, Manitoba) Catalogued in 1996 Contents 1. By Author 2. By Title 3. By Subject 1. By author Author Title Imprint Subject Call number 100 Jahre Auswärtiges Amt 1870 -1970 / Bonn : Auswärtiges Amt, 1970. Germany. Auswärtiges Amt -- DD 221 E5 herausgegeben vom Auswärtigen Amt. History.;Germany -- Foreign relations -- 1970 1971- 40 Jahre Bundesrepublik Deutschland : Köln : Verlag Wissenschaft und Germany (West) -- Politics and JN 3971 Verantwortung für Deutschland / herausgegeben Politik, c1989. government.;Germany -- Politics and A2A15 von Dieter Blumenwitz und Gottfried Zieger. government -- 1945-1990. 1989 40 Jahre nach Flucht und Vertreibung -- : als der Düsseldorf : Rau, 1 985. World War, 1939 -1945 -- D 809 Exodus begann : Augenzeugen berichten / Hans- Refugees;Refugees -- Germany G3A15 Ulrich Engel (Hg.). (West);Refugees -- Europe, 1985 Eastern.;Germans -- Europe, Eastern;Europe, Eastern -- Ethnic relations. 50 Jahre Münchner Abkommen : Zusammenhä nge München : Institutum Bohemicum, Germans -- Czechoslovakia -- Politics DB 2042 Erkenntnisse Urteile Perspektiven. 1988. and government.;Sudetenland (Czech G4F9 Republic) -- Politics and government. 1988 Aber das Herz Hä ngt daran : ein Gemeinschaftswerk Stuttgart : Brentanoverlag, c1955. German literature -- Czechoslovakia -- PT 3838 der Heimatvertriebenan. Sudetenland.;Sudetenland (Czech S94A2 Republic) -- Literary collections. 1955 Arbeiterbewegung -

Revolution and Counterrevolution in the Soviet Occupied Zone of Germany
THE NATIONAL COUNCIL FOR SOVIET AND EAST EUROPEAN RESEARC H TITLE : Revolution and Counterrevolution in th e Soviet Occupied Zone of Germany , 1945-46 AUTHOR: Norman M. Naimark CONTRACTOR : Boston University PRINCIPAL INVESTIGATOR : Norman M. Naimark COUNCIL CONTRACT NUMBER : 802-14 DATE : June 6, 199 1 The work leading to this report was supported by funds provided by the National Council for Soviet and Eas t European Research. The analysis and interpretations contained in the report are those of the author . Executive Summar y This paper traces the history of the first year of the Sovie t military occupation of Germany with particular emphasis on the ways i n which the Soviet administration changed, defeated, and encouraged th e political aspirations and responses of large numbers of people t o their situation in the zone . The focus is especially on the fate o f the German left under Soviet rule immediately after the World War II . The paper begins with a discussion of the structure and functions o f the Soviet Military Administration of Germany (SVAG in Russian, SMAD in German) . Then it considers two major cases of Soviet interventio n in socialist politics : the suppression of the anti-fascist committee s and the formation of the Socialist Unity Party . In these cases, as well as others in the Soviet Zone of Occupation (SBZ), Russia n administration frustrated the hopes of political revolution, while i t destroyed the social bases for counterrevolution -- a situation not unlike that of the Soviet Union itself . It does not stretch the evidence to characterize the role of SVA G in the politics of the Eastern zone as fundamentally counter - revolutionary . -

Der 17. Juni 1953
Der 17. Juni 1953 Auswahlbibliographie zusammengestellt durch die Bibliothek der Konrad-Adenauer-Stiftung 3. verb. und erg. Aufl. Stand: Juni 2003 Ansprechpartner: Hildegard Krengel Bibliothek der Konrad-Adenauer-Stiftung Rathausallee 12 53757 Sankt Augustin Tel.: 02241 / 246-204 E-Mail: [email protected] Gliederung Aktuelle Neuerscheinungen zum 50. Jahrestag 2003 3 Allgemeine Darstellungen und Sammelbände ........................................................7 Bildbände und Ausstellungskataloge .......................................................................8 Dokumentationen zu Vorgeschichte, Verlauf, Folgen ............................................9 Dokumentationen der Bundesregierung ...............................................................11 Zeitzeugenberichte, autobiographische Zeugnisse und Quellen .........................12 Literarische Rezeption (Literatur und Theater) ..................................................14 Einzelanalysen ..........................................................................................................17 • Deutschlandpolitik und Kalter Krieg .......................................................17 • Vergleichende Studien .............................................................................18 • Regionale Studien ....................................................................................19 • Opposition und Widerstand .....................................................................22 • Bürgerliche Parteien und Kirchen ...........................................................23 -

Rug 2007 1-2.Pdf
Rundfunk und Geschichte 1– 2/2007 Mitteilungen des Studienkreises Rundfunk und Geschichte 33. Jahrgang Nr. 1–2/2007 Rundfunk und Geschichte Geschichte und Rundfunk Ein Instrument wird zum Entscheidungsfaktor. Zur Entwicklung des Fernsehdesigns »Sie stehen nicht allein da in der Zone.« Zwei SWF-Sendereihen in der Analyse Signaturen des Kalten Krieges. Zur Bedeutung der deutsch-deutschen Programmbeobachtung »Public Value«: Leitbegriff oder Nebelkerze? Die Allianz der Devianz: zur Rolle von Filmmanifesten Rezensionen Bibliografie Mitteilungen des Studienkreises Rundfunk und Geschichte Zitierweise: RuG – ISSN 0175-4351 Redaktion: Claudia Kusebauch Christoph Rohde Steffi Schültzke Hans-Ulrich Wagner 1 Inhalt 33. Jahrgang Nr. 1–2/2007 Aufsätze Inge Marszolek Von der Politisierung der Medien zur Medialisierung Barbara Link des Politischen? Zum Verhältnis von Medien Ein Instrument wird zu einem Entscheidungsfaktor. und Politik im 20. Jahrhundert. Tagungsbericht 55 Zur Entwicklung des Fernsehdesigns seit den 1950er Jahren 5 Andreas Kozlik Das »Aufbau-Archiv Digital« Sina Rosenkranz, Sarah Renner in der Staatsbibliothek zu Berlin 59 »Sie stehen nicht allein da in der Zone.« Die SWF-Sendereihen »So sieht es Walter Hömberg, Manuel Bödiker der Westen …« und »So lebt man im Osten …« Die Gegenwart in der Vergangenheit. in den frühen 1950er Jahren 15 Kommunikations- und Medienmuseen in Deutschland 61 Susanne Paulukat, Uwe Breitenborn Signaturen des Kalten Krieges. Zur medienhistorischen und dokumentarischen Rezensionen Bedeutung der deutsch-deutschen Programmbeobachtungen 29 Internet-Rezension Das Internet-Portal www.mediamanual.at. (Daniel Bickermann) 69 Forum Gerrit Binz: Uwe Hasebrink Filmzensur in der Demokratie. »Public Value«: Leitbegriff oder Nebelkerze (Brigitte Braun) 70 in der Diskussion um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? 38 Jochen Fritz/Neil Stewart (Hrsg.): Das schlechte Gewissen der Moderne. -

September 11, 2001, Had a Paradox Meaning for the Study of the Cold
Dissertation Cold War in Germany: The United States and East Germany, 1945-1953 Submitted to the Philosophical Faculty University of Cologne By Christian Ostermann Washington, D.C. Adviser: Prof. Dr. Norbert Finzsch 1 TABLE OF CONTENTS Page I Introduction 4 II “An Iron Curtain of Our Own”? The United States, the Soviet Zone, and the Division of Germany, 1945-1948 1. “Toward a Line Down the Center of Germany:” 21 Dividing Germany 2. “Western Democracy on the Elbe:” Clay’s Conception of‘ Roll-back’ in Germany 40 3. German Central Administrations: The Double-Edged Sword 53 4. “The Most Significant Event in Germany Since the Overthrow of the Nazi Regime?” The U.S. and the 1946 SPD-KPD Merger 70 5. “Trojan Horse” or “Dead Duck”? Countering the People’s Congress Movement 101 6. “Action Point Berlin” 115 7. The Soviet Zone as a “Springboard for Penetration”? 125 8. Conclusions 135 III From “Diplomatic Blockade” to Psychological Warfare: The United States and East Germany, 1948-1952 1. Moscow’s “Major Satellite”? The U.S. and the Establishment of the GDR 136 2. “Ideological Rollback:” Defining the Cold War Discourse in Germany 145 3. Preventing “Roll up:” The United States and the 1950 FDJ Deutschlandtreffen in Berlin 158 4. “Hotting Up” the Cold War 169 5. Imagining Aggressive Rollback in Germany: The Carroll-Speier Report 180 6. Target: East German Youth 199 2 7. Mobilizing East German Resistance Spirit: The U.S. Reaction to the 1952 Stalin Note in New Light 208 8. Conclusion 218 IV Economic Cold War Against the GDR 1. -

Intelligence Memorandum
APPROVED FOR RELEASE DATE: JUN 2007 RSS No. 0019 Copy NO: 24 February 1967 DIRECTORATE OF INTELLIGENCE Intelligence Memorandum STRAINS ZG SOVIET-EAST GERMAN RELATIONS: 1962-1967 (Reference Title: CAESAR XXIX) 6. e STRAINS IN SOVIET-EAST GERMAN RELATIONS: 1962-1967 Prefatory Note This working paper of the DDI/Research Staff examines Soviet-East German relations duzing the period of compara- tive calm in Europe that has followed the 1962 Cuban mis- sile crisis. STRAINS IN SOVIET-EAST GERMAN RELATIONS: 1962-1967 Contents -Page SIIIILD1~Y...............................................i \ I. THE SHELVING OF KHRUSHCHEV'S FORCEFUL GERMAN STRATEGY: OCTOBER 1962-OCTOBER 1963........... 1 The Cuban Missile Crisis and the German Problem .......................................1 The Aftermath of The Crisis: Diminution of The German Crisis.... .........................3 The Detente And The German Problem .............7 I I. TEE DEVELOPMENT OF KHRUSHCHEV * S GERMAN POL ICY: OCTOBER 1963-OCTOBER 1964... ..................10 Evaluating The New Chancellor.................10 Trouble With East Germany.............. .......13 Adzhubey's Last Ambassade.....................19 Mounting GDR Insecurity. ...................... 29 The Presidium Oppos it ion Intervenes. .. .. .35 111. THE NEW SOVIET LEADERSHIP AND THE GEREbAN QUESTION: OCTOBER 1964-JANUARY 1967. .. .. .46 The German Problem And The COUP...............^^ Signals of Renewed Disquiet ................... 51 The Respite, Then The Renewal of The Triangle............ ......................... 65 The Coalition -

EAST GERMANY BETWEEN PAST and FUTURE Jean-Marie Vincent ECONOMICALLY and Industrially, the German Democratic Republic Is One Of
EAST GERMANY BETWEEN PAST AND FUTURE Jean-Marie Vincent ECONOMICALLY and industrially, the German Democratic Republic is one of the most advanced people's democracies. Its standard of living can be compared to that of Czechoslovakia, and is higher than that of the Soviet Union. It is by far the second economic power of the Soviet bloc and it has, in certain economic spheres, achieved an undisputed supremacy. Yet, it is at the same time, the weakest and most threatened of the people's democracies, and the one most burdened with uncer- tainties and dangers. This paradox is, of course, based on the fact that Germany is divided, and the adverse influence which West Germany continues to have on the people of the German Democratic Republic. What remains to be explained, however, is why this division has such a one-sided impact whilst in Viet-Nam and Korea it is the reverse which seems to be the case. In order to determine what kind of relations have come to exist between the people and the regime, it is necessary to go back to the historical circumstances of Germany's division and to the emergence of the German Democratic Republic. At the beginning the Soviet authorities, true to the spirit of the Yalta and Potsdam agreements, had no thought whatever of creating whole- sale revolutionary upheaval in their zone.1 They envisaged a fairly long period of good relations and only intended to guard against an aggres- sive comeback of the old ruling classes by favouring a new anti-fascist and democratic order.