Das Engagement Des Stifters
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
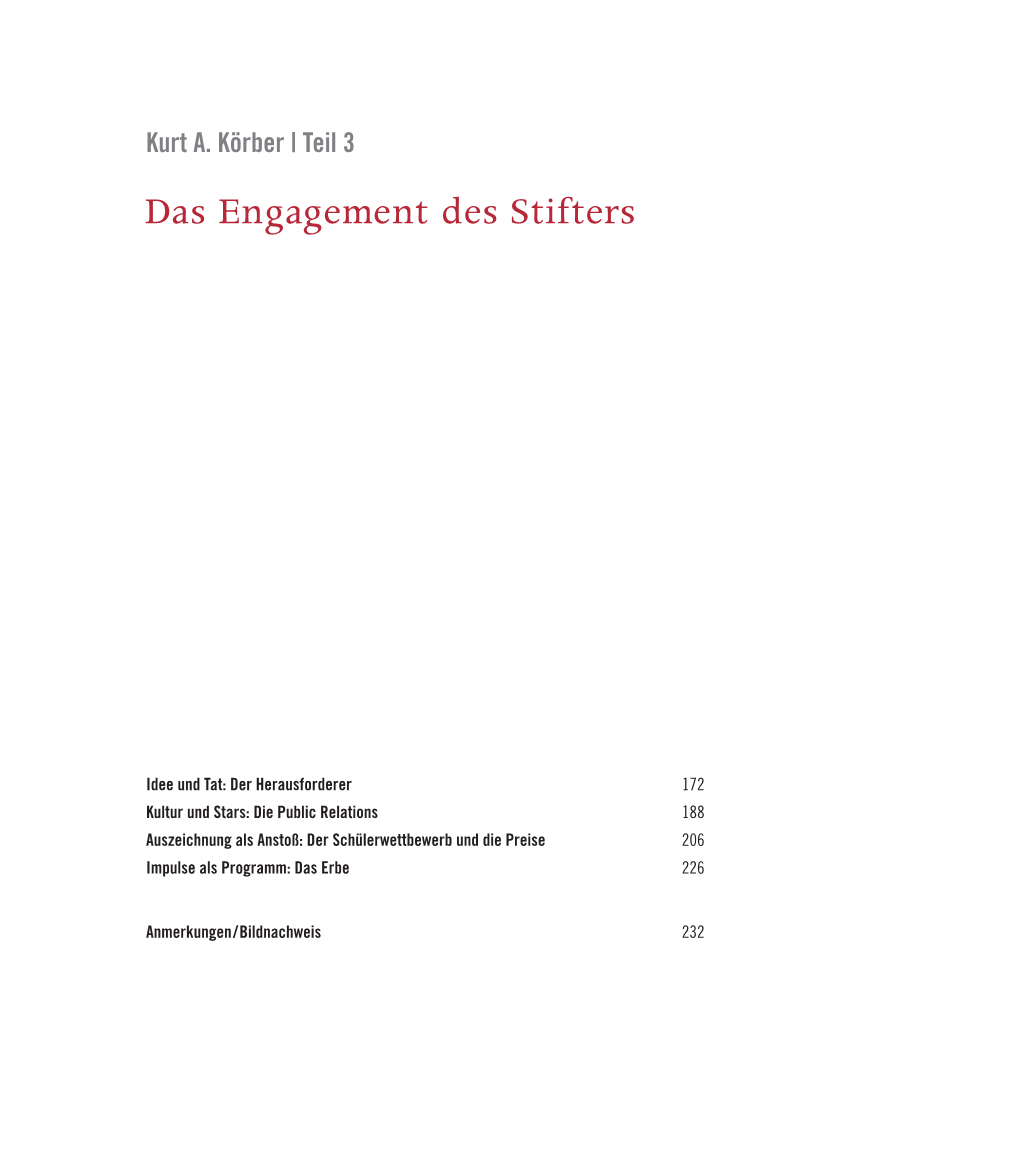
Load more
Recommended publications
-

German Jewish Refugees in the United States and Relationships to Germany, 1938-1988
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO “Germany on Their Minds”? German Jewish Refugees in the United States and Relationships to Germany, 1938-1988 A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in History by Anne Clara Schenderlein Committee in charge: Professor Frank Biess, Co-Chair Professor Deborah Hertz, Co-Chair Professor Luis Alvarez Professor Hasia Diner Professor Amelia Glaser Professor Patrick H. Patterson 2014 Copyright Anne Clara Schenderlein, 2014 All rights reserved. The Dissertation of Anne Clara Schenderlein is approved, and it is acceptable in quality and form for publication on microfilm and electronically. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Co-Chair _____________________________________________________________________ Co-Chair University of California, San Diego 2014 iii Dedication To my Mother and the Memory of my Father iv Table of Contents Signature Page ..................................................................................................................iii Dedication ..........................................................................................................................iv Table of Contents ...............................................................................................................v -

37/Voscherau (Page
Deutschland WAHLEN Der rote Sheriff Mit populistischen Reizthemen zur Inneren Sicherheit betreibt der Sozialdemokrat Henning Voscherau die Wiederwahl als Hamburger Bürgermeister. Doch der ehrgeizige Genosse strebt auch in Bonn nach einem möglichst hohen Amt. Von Hans-Joachim Noack uf dem Marktplatz von Kirchdorf- Süd, einem Ortsteil Hamburgs, der Azu den eher problemträchtigen der Freien und Hansestadt gehört, erspäht Bür- germeister Henning Voscherau einen im engen Unterhemd sich räkelnden jungen Mann, dessen furchteinflößende Körper- maße seine Neugier wecken. Den muß er sich näher ansehen. Ein bißchen komisch wirkt die Szene schon, in der danach der federgewichti- ge Senatspräsident dem von staunenden Freunden umgebenen Hünen die straffe Oberarmmuskulatur massiert. „Wirklich imposant“ findet er die prächtig gebauten Bizeps, aber dann ermahnt er den verdat- terten Kraftprotz: „Immer hübsch gewalt- frei bleiben.“ Solche Auftritte, die er häufig ins leicht Clowneske wendet, sucht der mimisch be- gabte Voscherau mit der Selbstverständ- lichkeit eines erprobten Polit-Entertainers. In Hamburg hat die heiße Phase des Bür- gerschaftswahlkampfs begonnen, und der Spitzenkandidat der SPD zieht einen Troß von Fotoreportern hinter sich her, dem er gern mal ein möglichst unkonventionelles Bildmotiv bieten möchte. Darüber hinaus illustriert das kleine In- termezzo, was ihm auch inhaltlich derzeit am wichtigsten zu sein scheint: Nichts be- flügelt ihn mehr, wenn er im eigens gechar- terten Autobus seine von stark gestiegener Alltagskriminalität heimgesuchten Außen- bezirke bereist, als das „Topthema Innere Sicherheit“. Sollen ihn Konkurrenten wie der christ- demokratische Oppositionsführer Ole von Beust einen „Maulhelden“ schimpfen – da steht er drüber. In der Pose des knallhar- ten Stadtsheriffs („… mit kaltem Blut“) fordert der 56jährige Dr. jur. -

Profile Persönlichkeiten Der Universität Hamburg Profile Persönlichkeiten Der Universität Hamburg Inhalt
FALZ FÜR EINKLAPPER U4 RÜCKENFALZ FALZ FÜR EINKLAPPER U1 4,5 mm Profile persönlichkeiten der universität hamburg Profile persönlichkeiten der universität hamburg inhalt 6 Grußwort des Präsidenten 8 Profil der Universität Portraits 10 von Beust, Ole 12 Breloer, Heinrich 14 Dahrendorf, Ralf Gustav 16 Harms, Monika 18 Henkel, Hans-Olaf 20 Klose, Hans-Ulrich 22 Lenz, Siegfried 10 12 14 16 18 20 22 24 Miosga, Caren 26 von Randow, Gero 28 Rühe, Volker 30 Runde, Ortwin 32 Sager, Krista 34 Schäuble, Wolfgang 24 26 28 30 32 34 36 36 Schiller, Karl 38 Schmidt, Helmut 40 Scholz, Olaf 42 Schröder, Thorsten 44 Schulz, Peter 46 Tawada, Yoko 38 40 42 44 46 48 50 48 Voscherau, Henning 50 von Weizsäcker, Carl Friedrich 52 Impressum grusswort des präsidenten Grußwort des Präsidenten der Universität Hamburg Dieses Buch ist ein Geschenk – sowohl für seine Empfänger als auch für die Universität Hamburg. Die Persönlichkeiten in diesem Buch machen sich selbst zum Geschenk, denn sie sind der Universität auf verschiedene Weise verbunden – als Absolventinnen und Absolventen, als ehemalige Rektoren, als prägende Lehrkräfte oder als Ehrendoktoren und -senatoren. Sie sind über ihre unmittelbare berufliche Umgebung hinaus bekannt, weil sie eine öffentliche Funktion wahrnehmen oder wahrgenommen haben. Die Universität Hamburg ist fern davon, sich selbst als Causa des beruflichen Erfolgs ihrer prominenten Alumni zu betrach- ten. Dennoch hat die Universität mit ihnen zu tun. Sie ist der Ort gewesen, in dem diese Frauen und Männer einen Teil ihrer Sozialisation erfahren haben. Im glücklicheren Fall war das Studium ein Teil der Grundlage ihres Erfolges, weil es Wissen, Kompetenz und Persönlichkeitsbildung ermöglichte. -

Central Europe
Central Europe West Germany FOREIGN POLICY AND STATUS OF BERLIN OUBJECTS discussed during British Premier Harold Wilson's offi- cial visit to Bonn from March 7 to 9 included the maintenance of the British Rhine Army in Germany, the continuation of German currency aid for the United Kingdom, and a new approach to German reunification. When East German authorities tried to interfere with the meeting of the Bundestag in Berlin on April 7 by disrupting traffic to and from the former capital, the Western Allies protested sharply. In his opening speech Eugen Gerstenmaier, president of the Bundestag, emphasized the right of the Fed- eral parliament to meet in West Berlin and denied that the session was an act of provocation. During the Easter holidays 300,000 West Berliners were permitted to visit relatives in the Eastern zone of the divided city. About a million Berliners crossed the Berlin Wall and spent Christmas with their relatives, after the renewal of an agreement in November. Queen Elizabeth II of England and her consort the Duke of Edinburgh made an official visit to West Germany and West Berlin in May, and were cheered by the population. Attempts by Foreign Minister Gerhard Schroder to bring about an improvement in relations with the United Kingdom during this visit were viewed skeptically by Franz-Josef Strauss, chairman of the Christian Social Union (CSU), representing the pro-French wing of the coalition. French President Charles de Gaulle's talks with Chancellor Ludwig Erhard in Bonn in June were described as "positive," but did not lead to an agree- ment on a conference to discuss the reorganization of the Common Market and other matters pertaining to the European community. -

Liste Deutscher Teilnehmer Bilderberg
• Egon Bahr (1968, 1971, 1982, 1987), German Minister, creator of the Ostpolitik • Rainer Barzel (1966), former German opposition leader • Kurt Biedenkopf (1992), former Prime Minister of Saxony • Max Brauer (1954, 1955, 1958, 1963, 1964, 1966), former Mayor of Hamburg • Birgit Breuel (1973, 1979, 1980, 1991, 1992, 1994), chairwoman of Treuhandanstalt • Andreas von Bülow (1978), former Minister of Research of Germany • Karl Carstens (1971), former President of Germany • Klaus von Dohnanyi (1975, 1977), former Mayor of Hamburg • Ursula Engelen-Kefer (1998), former chairwoman of the German Confederation of Trade Unions • Björn Engholm (1991), former Prime Minister of Schleswig-Holstein • Ludwig Erhard (1966), former Chancellor of Germany • Fritz Erler (1955, 1957, 1958, 1963, 1964, 1966), Socialist Member of Parliament • Joschka Fischer (2008), former Minister of Foreign Affairs (Germany) • Herbert Giersch (1975), Director, Institut fur Weltwirtschaft an der Universitat Kiel • Helmut Haussmann (1979, 1980, 1990, 1996), former Minister of Economics of Germany • Wolfgang Ischinger (1998, 2002, 2008), former German Ambassador to Washington • Helmut Kohl (1980, 1982, 1988), former Chancellor of Germany • Walter Leisler Kiep (1974, 1975, 1977, 1980), former Treasurer of the Christian Democratic Union (Germany) • Kurt Georg Kiesinger (1955, 1957, 1966), former Chancellor of Germany • Hans Klein (1986), Member of German Bundestag • Otto Graf Lambsdorff (1980, 1983, 1984), former Minister of Economics of Germany • Karl Lamers (1995), Member of the -

Elections in the Länder
chap 9 27/5/03 11:57 am Page 289 9 Elections in the Länder Introduction Five phases can be distinguished in the development of political parties in the Länder. The first phase, from 1945 to 1953, was the period during which older parties were reestablished, e.g., SPD, and new parties were founded, e.g., the refugee party (BHE), CDU, and FDP (although the CDU has its roots in the old Center Party [Zentrum] and the FDP could be traced back to liberal parties of the Empire and Weimar Republic). The second phase, from 1953 to 1969, saw the developing concentration of 1 parties culminating in the three- (or “2 ⁄2”)-party system of CDU/CSU, SPD, and FDP. The third phase, from 1969 to 1983, was the period of three-party dominance, while in the fourth phase, from 1983 to 1990, the Greens emerged as a fourth party. Finally, following a reorientation after unification in 1990, a five-party system has developed at the national level with the rise of the PDS which, however, has a special regional character, and in Land elections has been confined to the new Länder and Berlin in the East just as the Greens and FDP have been successful only or mostly in the West.1 In order to provide the reader with some of the flavor and spice of Landtag elections, and to assess better some of the hypotheses about Land elections and parties that were mentioned in the previous chapter (pp. 267–273), a very brief overview of political developments in the Länder since 1945 is presented below. -

35/Titel/Koalition (Page
Titel „Dort sitzen Stammtischstrategen“ Interview mit FDP-Generalsekretär Guido Westerwelle über Theo Waigels Forderung nach einer Kabinettsreform und sozialliberale Planspiele für Hamburg SPIEGEL: Herr Westerwelle, welche SPIEGEL: Die betreibt Kohl fast im Wirkung hat Theo Waigels Rück- Alleingang. zug in Raten auf das Ansehen der Westerwelle: Von meiner Meinung, Koalition? daß Klaus Kinkel der richtige Au- Westerwelle: Theo Waigel hat sich ßenminister für dieses Land ist, keinen Gefallen getan, aber selbst- werden Sie mich nicht abbringen. verständlich auch nicht der Koali- Wer in Anbetracht der Globalisie- tion. Ich vermute, er weiß es. Die rung eine Renationalisierung der Bürger müssen längst das Gefühl Politik fordert, ist als Meinungs- haben, daß die politische Kaste mit führer in der Außenpolitik wenig Nebensächlichkeiten beschäftigt geeignet. ist, während über vier Millionen SPIEGEL: Das ist jetzt in Richtung Menschen auf der Straße stehen CSU gesagt, wo die Europa-Skep- und arbeitslos sind. tiker sitzen. SPIEGEL: Waigel will Helmut Kohl Westerwelle: To whom it may con- zu einer Reform des Kabinetts cern, wer auch immer sich ange- zwingen. Hat er damit den Kanz- sprochen fühlt. ler in seiner politischen Hand- SPIEGEL: Suchen Sie für den Wahl- lungsfähigkeit beeinträchtigt? kampf eine ähnliche Konfrontation Westerwelle: Diese Interpretation wie früher mit Franz Josef Strauß? scheint mir zu weitgehend. Aber Damals ging es um die Ostpolitik, wenn einer in diffizilen Personal- heute heißt die Parole Europäer fragen etwas ändern will, dann gegen Nationalisten. sollte er auf PR verzichten und Westerwelle: Die Union steht ge- zum Telefonhörer greifen.Auf alle wiß von der Parteispitze bis zur Fälle entsteht natürlich, egal, ob Basis geschlossen hinter der Au- der Kanzler im Kabinett etwas än- ßenpolitik der Regierung. -

303E29a0e98ea6515df333bfa8a
BURGERMEISTER HAMBURG OLE VON BEUST LISTE DER HAMBURGER BURGERMEISTER MAX BRAUER PAUL NEVERMANN HERBERT WEICHMANN OLAF SCHOLZ PDF-31BHOVBLDHBMBPNHWOS11 | Page: 128 File Size 5,682 KB | 5 May, 2020 PDF File: Burgermeister Hamburg Ole Von Beust Liste Der Hamburger Burgermeister Max Brauer Paul 1/3 Nevermann Herbert Weichmann Olaf Scholz - PDF-31BHOVBLDHBMBPNHWOS11 TABLE OF CONTENT Introduction Brief Description Main Topic Technical Note Appendix Glossary PDF File: Burgermeister Hamburg Ole Von Beust Liste Der Hamburger Burgermeister Max Brauer Paul 2/3 Nevermann Herbert Weichmann Olaf Scholz - PDF-31BHOVBLDHBMBPNHWOS11 Burgermeister Hamburg Ole Von Beust Liste Der Hamburger Burgermeister Max Brauer Paul Nevermann Herbert Weichmann Olaf Scholz e-Book Name : Burgermeister Hamburg Ole Von Beust Liste Der Hamburger Burgermeister Max Brauer Paul Nevermann Herbert Weichmann Olaf Scholz - Read Burgermeister Hamburg Ole Von Beust Liste Der Hamburger Burgermeister Max Brauer Paul Nevermann Herbert Weichmann Olaf Scholz PDF on your Android, iPhone, iPad or PC directly, the following PDF file is submitted in 5 May, 2020, Ebook ID PDF-31BHOVBLDHBMBPNHWOS11. Download full version PDF for Burgermeister Hamburg Ole Von Beust Liste Der Hamburger Burgermeister Max Brauer Paul Nevermann Herbert Weichmann Olaf Scholz using the link below: Download: BURGERMEISTER HAMBURG OLE VON BEUST LISTE DER HAMBURGER BURGERMEISTER MAX BRAUER PAUL NEVERMANN HERBERT WEICHMANN OLAF SCHOLZ PDF The writers of Burgermeister Hamburg Ole Von Beust Liste Der Hamburger Burgermeister Max Brauer Paul Nevermann Herbert Weichmann Olaf Scholz have made all reasonable attempts to offer latest and precise information and facts for the readers of this publication. The creators will not be held accountable for any unintentional flaws or omissions that may be found. -

Dr. Henning Voscherau Ehemaliger Erster Bürgermeister Hamburg Im Gespräch Mit Werner Reuß
BR-ONLINE | Das Online-Angebot des Bayerischen Rundfunks Sendung vom 23.10.2007, 20.15 Uhr Dr. Henning Voscherau Ehemaliger Erster Bürgermeister Hamburg im Gespräch mit Werner Reuß Reuß: Verehrte Zuschauer, ganz herzlich willkommen zum alpha-forum. Unser heutiger Gast ist Dr. Henning Voscherau, in den Jahren 1988 bis 1997 Erster Bürgermeister und Präsident des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg. Das war mit neun Jahren die bisher längste Amtszeit in der Nachkriegszeit, die ein Erster Bürgermeister in Hamburg regierte. Hamburg ist ein Stadtstaat mit rund 1,8 Millionen Einwohnern und damit eines der 16 Bundesländer und vertreten im Bundesrat. Henning Voscherau war u. a. auch Präsident des Bundesrates, er war Vorsitzender des Vermittlungsausschusses von Bundestag und Bundesrat und er war langjähriges Präsidiumsmitglied seiner Partei, der SPD. Ich freue mich, dass er hier ist, herzlich willkommen, Herr Dr. Voscherau. Voscherau: Guten Tag. Reuß: "Ein Hanseat ist ein Mensch, der international denkt, der mit Handschlag Verträge schließt und sie auch hält, der Wert auf eine gepflegte anglophile Erscheinung legt, den man als Freund erst gewinnen muss, dann aber hat man ihn ein Leben lang." Dieser Satz stammt von Ihnen, Sie sind in Hamburg geboren, Sie haben in Hamburg studiert, Sie haben Hamburg regiert: Sind Sie ein Hanseat durch und durch? Voscherau: Das kann man sich selbst ja nicht bescheinigen, das müssen die Bürger einem bescheinigen. Und da gibt es vielleicht doch einige, die das bejahen würden. Reuß: "Politik ist Kampf um Macht, aber eben auch wertendes Streiten und streitendes Werten darüber, wie wir leben und wie wir dezidiert nicht leben wollen." Dieser Satz stammt von Ihrem Parteifreund, dem ehemaligen Bundesminister Erhard Eppler. -

Germany Minds
SCHENDERLEIN GERMANY ON THEIR MINDS German Jewish Refugees in the United States and Their Relationships with Germany, 1938–1988 GERMANY ANNE C. SCHENDERLEIN ON THEIR is is a solid, comprehensive study of German Jewish refugees in the United States, especially in Los Angeles and New York. It is probing and judicious. Michael A. Meyer, Hebrew Union College – Jewish Institute of Religion MINDS THEIR ON GERMANY roughout the 1930s and early 1940s, approximately ninety thousand German MINDS Jews ed their homeland and settled in the United States, prior to that nation closing its borders to Jewish refugees. And even though many of them wanted little to do with Germany, the circumstances of World War II and the postwar era meant that engagement of some kind was unavoidable—whether direct or indirect, initiated within the community itself or by political actors and the broader German public. is book carefully traces these entangled histories on GERMAN JEWISH REFUGEES both sides of the Atlantic, demonstrating the remarkable extent to which German Jews and their former fellow citizens helped to shape developments from the IN THE UNITED STATES AND THEIR Allied war e ort to the course of West German democratization. RELATIONSHIPS WITH GERMANY, 19381988 Anne C. Schenderlein is the managing director of the Dahlem Humanities Cen- ter at Freie Universität Berlin. After receiving her doctorate in modern European history at the University of California, San Diego, she was a research fellow at the German Historical Institute from 2015 to 2019. Her research has been sup- ported by numerous fellowships, including the Leo Baeck Fellowship and, more recently, a grant from the American Jewish Archives, where she conducted research on American Jewish boycotts and consumption of German products. -

Hamburger Kurs 2/2013
April/Mai 2013 | Mitteilungen der SPD Hamburg Ham burger Kurs vorwärts 1. Mai – Tag der Arbeit HAMBURG SCHAFFT DIE ENERGIEWENDE GUTE ARBEIT. JETZT UND OHNE IMMER NEUE SCHULDEN SICHERE RENTE. TEIL 1: INTERVIEW MIT JUTTA BLANKAU, SENATORIN FÜR STADTENTWICKLUNG UND UMWELT SOZIALES EUROPA. 11 UHR Wie weit sind wir mit der Energiewende versorgung als Selbstzweck angesehen. den Versorgungsunternehmen sind wir Demonstration in Hamburg? Aber für ein so verdichtetes Gebiet mit die Energiewende sofort angegangen. Wir kommen mit den beiden Kooperati - einem dichten Fernwärmenetz und meh - Hätten wir die Konfliktlinie des Vorgänger - ab Spielbudenplatz onspartnern E.ON und Vattenfall richtig reren hunderttausend angeschlossenen senats weiter gefahren, wären wir noch 12 UHR gut voran. Ein gutes Beispiel ist die Fern - Haushalten ist diese Lösung mit dem GuD- keinen Schritt weiter. Vor allem würden Kundgebung Fischmarkt wärmeversorgung der Stadt. Bislang wird Kraftwerk wesentlich effizienter als viele wichtige Entscheidungen insbesondere im das große Fernwärmenetz von einem ab - kleine Blockheizkraftwerke. Fernwärmebereich noch durch Rechts - u.a. mit Uwe Grund , Vor - gängigen Kohlekraftwerk aus den 1960er streitigkeiten jahrelang verzögert werden sitzender DGB Hamburg, Jahren versorgt. Dieses Kraftwerk wollte Sind denn noch weitere Projekte und ob die Stadt damit Erfolg hätte, ist Michael Vassiliadis , gestartet? Vattenfall eigentlich durch die sogenannte hochgradig fraglich. Es ist gut, die Energie - Vorsitzender der IG BCE Moorburgtrasse, eine Fernwärmeleitung In der Zwischenzeit ist schon vieles pas - wende sofort und pragmatisch an zu - aus dem Kohlekraftwerk Moorburg er - siert und angestoßen worden. Gerade gehen, das Klima zu schützen und 13 UHR setzen. Wir haben in den Vereinbarungen Anfang April haben wir beispielsweise mit Arbeitsplätze zu sichern. -

The Länder and German Federalism Prelims 27/5/03 11:39 Am Page Ii
GPOLGunlicks cover 21/5/2003 5:22 pm Page 1 Issues in German Politics The Länder This book provides a detailed introduction to how the Länder (the sixteen states of Germany) function not only within the country itself but also within the wider context of European political affairs. Some knowledge of the role of the Länder is and German federalism essential to an understanding of the political system as well as of German federalism. The Länder This book traces the origin of the Länder. It looks at their place in the constitutional order of the country and the political and administrative system. Their organization and administration are fully covered, as is their financing. Parties and elections in the Länder and the controversial roles of parliaments and deputies are also examined. and German Because of their role in the Bundesrat, the second legislative chamber, the Lander are clearly an important part of the national legislative process. They participate in policy-making with regard to the European Union, and have limited influence on Germany's foreign affairs outside of Europe. This is the first English language book that considers the Länder in this depth. federalism Arthur Gunlicks is a professor of political science and chair of the department at the University of Richmond, Virginia Gunlicks Arthur Gunlicks ISBN 0-7190-6533-X 9 780719 065330 prelims 27/5/03 11:39 am Page i The Länder and German federalism prelims 27/5/03 11:39 am Page ii ISSUES IN GERMAN POLITICS Edited by Professor Charlie Jeffery, Institute for German Studies Dr Charles Lees, University of Sussex Issues in German Politics is a major new series on contemporary Germany.