Aufwachsen in Der
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
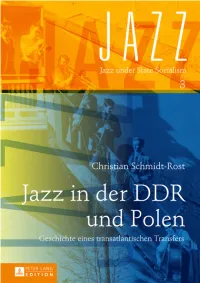
Jazz in Der DDR Und Polen
1 Einleitung „We want Miles!, We want Miles!“ skandierte das Publikum im völlig über- füllten Warschauer Kulturpalast.1 Das Abschlusskonzert des 25. Jazz Jam- boree Warsaw mit dem Miles Davis Septett ging zu Ende. Fast alle Zuhörer standen und unterstützten ihre Forderung mit rhythmischem Klatschen. Als Miles Davis für die dritte Zugabe auf die Bühne zurückkam, stimmte eine Gruppe im Publikum das Lied Sto lat an.2 Miles Davis hob zum Dank kurz den Hut. Derart emotionale Regungen von Miles waren äußerst selten und wurden in der Jazzszene als eine Sensation wahrgenommen.3 Bis heu- te sehen viele Mitglieder der polnischen Jazzszene den Auftritt von Miles Davis als einen der Höhepunkte des Jazzlebens in Polen an. Die wenigen Jazzfans aus der DDR, die es trotz des offiziellen Verbots von Reisen in die VR Polen zu diesem Konzert schafften, erinnern es auch als eines der besten Jazz Jamborees.4 Auch für Miles Davis war der Aufenthalt in Warschau ein herausragendes Erlebnis. So beschreibt er in seiner Autobiographie, er habe das Gefühl gehabt, die Menschen hätten ihn unbedingt sehen wollen und ihn und seine Musik außergewöhnlich gut verstanden. Zudem hätte man ihn wie einen Staatsgast behandelt und ihm von Yuri Andropov ausrichten lassen, dass er Davis für einen der größten Musiker der Welt halte.5 Gut 30 Jahre früher, Anfang der 1950er Jahre, wären ein Konzert eines amerikanischen Musikers und solch positive Äußerungen von sowjetischen Herrschenden über Jazz undenkbar gewesen. Jazz galt als die amerika- nische Musik schlechthin und wurde als solche von den Herrschenden in allen sozialistischen Staaten Ostmitteleuropas abgelehnt. Hierbei folgten die örtlichen Machthaber vor allem den ideologischen Vorgaben aus Mos- kau. -

Radiophonic Spaces Radiophonic Radiophonic Spaces Spaces
radiophonic spaces Radiophonic Radiophonic Spaces Spaces Ein Hör-Parcours durch die A sonic journey through radio art Radiokunst Radiophonic Spaces ist ein begehbarer Radiophonic Spaces is at the same time Radioraum und zugleich experimentelles a walk-in radio space and an experimen- Archiv – eine Symbiose aus künstleri- tal archive – a symbiosis of an artistic scher Auseinandersetzung mit Radio- exploration of radio art and radiophony kunst und Radiophonie und einem and an academic research project headed wissenschaftlichen Forschungsprojekt by the Chair of Experimental Radio at unter Federführung des Experimentel- the Bauhaus-Universität Weimar. Under len Radios an der Bauhaus-Universität the artistic direction of Nathalie Singer, Weimar. Ein Team von Radiokünst- a team of radio artists and researchers ler*innen und -forscher*innen hat unter conceived this experimental archive, Leitung von Nathalie Singer diesen which was designed by the artist, archi- Hör-Raum der Radiokunst konzipiert, tect and musician Cevdet Erek. der von dem Künstler, Architekten und Musiker Cevdet Erek gestaltet wurde. The works made accessible in Radio- phonic Spaces range from early radio Die in Radiophonic Spaces zugänglich experiments to contemporary produc- gemachten Arbeiten reichen von Experi- tions. Radio researchers, musicologists, menten aus der Frühzeit des Radios editors, critics and artists from the bis zu zeitgenössischen Produktionen. most varied of contexts and disciplines Radioforscher*innen, Musikwissen- selected over 200 works from 100 years schaftler*innen, Redakteur*innen, Kri- of international radio art for Radio- tiker*innen und Künstler*innen aus den phonic Spaces and arranged them in 13 verschiedensten Kontexten und Diszi- ‘narratives’. The result is a kaleidoscopic plinen haben für Radiophonic Spaces overview of the development of radio über 200 Arbeiten aus 100 Jahren inter- art as well as of recurring themes, motifs nationaler Radiokunst ausgewählt und and procedures. -

Volkskammer Der Deutschen Demokratischen Republik 10
Volkskammer Drucksache Nr. 134 der Deutschen Demokratischen Republik 10. Wahlperiode Antrag des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik vom 11. Juli 1990 Die Volkskammer wolle beschließen: Überleitungsgesetz zu Hörfunk und Fernsehen (Rundfunk) der Deutschen Demokratischen Republik (Rundfunküberleitungsgesetz) Lothar de Malzihre Ministerpräsident Entwurf ÜBERLEITUNGSGESETZ Zu Hörfunk und Fernsehen (Rundfunk) der Deutschen Demokratischen Republik (Rundfunküberleitungsgesetz) Inhaltsverzeichnis Seite Präambel 1. Abschnitt Allgemeines § 1 Recht der freien Meinungsäußerung, 5 Rundfunkbegrifff 2. Abschnitt Programmauftrag, Programmgrund- sätze § 2 Programmgrundsätze 5 § 3 Berichterstattung 6 § 4 Gegendarstcllung -6 § 5 Verlautbarungsrecht 7 § 6 Sendezeit für Dritte 8 § 7 Unzulässige Sendungen, Jugendschutz 8 § 8 Beweissicherung 3. Abschnitt Aufsicht über den Rundfunk § Rechtsaufsicht 10 4. Abschnitt Organisation des öffent lich-rechtlichen Rundfunks § 10 Errichtung von Landesrundfunk- 10 direktoraten § 11 Deutscher Fernsehfunk, Rundfunk 11 der DDR § 12 Aufgaben und Programmauftrag 11 § 13 Organe des Landesrundfunkdirektorates 12 § 14 Aufgaben des Beirates 13 § 15 Aufgaben des Direktors 13 § 16 Gemeinschaftliche Organe der Landes- 14 rundfunkdirektorate § 17 Aufgaben des Rundfunkausschusses 14 § 18 Aufgaben des Direktoratsrats 14 § 19 Recht der Personalvertretung 15 5. Abschnitt Finanzierung des öffentlich-recht- lichen Rundfunks § 20 Finanzierung 15 § 21 Gebühren 15 15 Einnahmen, Mittelbewirt- § 22 schaftung, Gebühreneinzug -
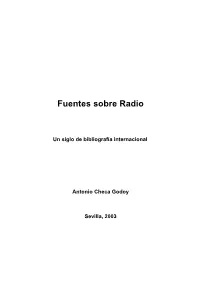
Fuentes Sobre Radio. Un Siglo
Fuentes sobre Radio Un siglo de bibliografía internacional Antonio Checa Godoy Sevilla, 2003 2 Antonio Checa Godoy Fuentes sobre radio 3 Indice Página Introducción.............................................................................................. Una periodización de la historia de la radio............................................. 1.- 1895-1920. La telegrafía sin hilos........................................... 2.- 1920-1939. La radio espectáculo............................................ 3.- 1939-1960. La radio política.................................................... 4.- 1960-1975. La era del transistor.............................................. 5.- 1975-1982. La FM y la radio libre............................................ 6.- 1982-1999. Descentralización y radio fórmula........................ 7.- 2.000. La era digital.................................................................. Los catálogos en red................................................................................. La hemerografía radiofónica...................................................................... Filmografía y videografía............................................................................ Fuentes 1.- Historia.................................................................................... 1.1.- Historias supranacionales y perspectivas generales sobre la evolución del medio. Historia y radio.. 1.2.- La radio en España................................................. 1.2.1.- Obras generales...................................... -

Mitteilungen
Studienkreis Rundfunk und Geschichte Mitteilungen 19. Jahrgang Nr. 4- Oktober 1993 ln memorlam Walter Först Seite 133 Aufsätze Luise Thuß Vom Gastarbeiterprogramm zur multikulturellen Sendung Auslanderprogramme im Rundfunk der DDR Seite 143 Sibylle Bolik Themen und Tendenzen des Hörspiels in der DDR Seite 150 Thomas Beutelschmidt Bedingungen und Entwicklungen der Studiotechnik im Fernsehen der DDR Seite 155 Joachim-Felix Leonhard Das Rundfunkarchiv Ost Folgen und Folgerungen fOr Gegenwart und Zukunft Seite 168 Dokumentation Christa Nink Folgen nationalsozialistischer Personalpolitik im Westdeutschen Rundfunk Seite 176 Klaus Scheel Quellen zur Geschichte des nationalsozialistischen Rundfunks im »Sonderarchiv« Moskau Seite 192 Nachrichten und Informationen Vorstand des Studienkreises in Leipzig neu gewahlt Seite 201 Satzung des Wilhelm-Treue-Stipendiums Seite 201 Wilhelm-Treue-Stipendien des Studienkreises vergeben Seite202 22. Doktoranden-Kolloquium des Studienkreises 1994 Seite 202 25. Jahrestagung des Studienkreises 1994 Seite 203 Schwarzes Brett RudolfWildenmann (1921 -1993) Seite 204 Walter-Karl Schweikert (1908 -1992) Seite 205 Herbart Blank. Ein biographischer Hinweis Seite 207 Unbekannte Rundfunkrede Gottfried Senns Seite 210 Amerikanische Rundfunkmacher im Dienste des Dritten Reichs Seite 211 DDR-Rundfunkzeitschrift auf Mikrofilm Seite 215 Niederländisches Jahrbuch Mediengeschichte Seite 217 Bibliographie Seite 219 Besprechungen Seite 224 Studienkreis Rundfunk und Geschichte e.V. Redaktion: Arnulf Kutsch (verantw.) Vorsitzender: Helmut Drück, Berlln Wolf Bierbach · Ansgar Diller Schriftführer: Edgar Lersch, Süddeutscher Rundfunk Waller Först · Friedrich P. Kahlenberg Postfach 106040,7000 Stuttgart 10. Tel. 0711/9293233 Marianne Ravenstein Zitierweise: Mitteilungen StRuG-ISSN 0175-4351 Autoren der längeren Beiträge Thomas Beutelschmidt, Freiberuflicher Medienjoumalist, Stubenrauchstraße 11, 12161 Bertin Sibylle Bolik, Freiberufliche Autorin und Hörspiellektorin, Kyffhäuserstraße 59, 50674 Köln Prof. Dr. Friedrich P. -

Die Öffentlich-Rechtliche Rundfunkkultur IRIS Spezial in Europa, Erweitert Aber Den Geografi Schen Horizont, Falls Ein Gewähltes Thema Rundfunkkultur Dies Nahe Legt
Die Serie Herausgegeben von der Europäischen Audiovisuellen Was können Sie IRIS Spezial ist die Publikationsreihe der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle mit umfassenden Fakten und vertiefenden Analysen. Sie konzentriert sich auf aktuelle Informationsstelle inhaltlich von Themen des Medienrechts und bereitet diese aus juristischem Blickwinkel für Sie auf. IRIS Spezial IRIS Spezial bietet Ihnen drei inhaltliche Dimensionen, die – je nach gewähltem Thema – auch miteinander verbunden sein können: erwarten? 1. Die präzise Darlegung nationaler gesetzlicher Grundlagen zur Vergleichung des in verschiedenen Ländern geltenden Rechts. So untersucht die IRIS Spezial „Pfl ichten der Rundfunkveranstalter zur Investition in die Produktion von Kinofi lmen“ die Situation in 34 europäischen Ländern. 2. Das Aufzeigen und die Analyse aktueller Problemstellungen, einschließlich juristischer Entwicklungen und Trends sowie erster Lösungsansätze. Die IRIS Spezial „Audiovisuelle Mediendienste ohne Grenzen“ ist in die Zukunft gerichtet und behält ihre Aktualität weit über die Annahme der EG-Richtlinie hinaus. 3. Die Beschreibung des europäischen oder auch internationalen Rechtsrahmens, der das nationale Recht prägt. Die IRIS Spezial „Haben oder nicht haben - Must-Carry-Regeln“ erklärt das europäische Modell und stellt es dem amerikanischen Ansatz gegenüber. Woher kommt die Jede Ausgabe der Reihe IRIS Spezial wird von unserer Abteilung für Juristische Informationen in Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen sowie einem breiten Netzwerk von Medienrechts- -

Must-Carry Rules, and Access to Free-DTT
Access to TV platforms: must-carry rules, and access to free-DTT European Audiovisual Observatory for the European Commission - DG COMM Deirdre Kevin and Agnes Schneeberger European Audiovisual Observatory December 2015 1 | Page Table of Contents Introduction and context of study 7 Executive Summary 9 1 Must-carry 14 1.1 Universal Services Directive 14 1.2 Platforms referred to in must-carry rules 16 1.3 Must-carry channels and services 19 1.4 Other content access rules 28 1.5 Issues of cost in relation to must-carry 30 2 Digital Terrestrial Television 34 2.1 DTT licensing and obstacles to access 34 2.2 Public service broadcasters MUXs 37 2.3 Must-carry rules and digital terrestrial television 37 2.4 DTT across Europe 38 2.5 Channels on Free DTT services 45 Recent legal developments 50 Country Reports 52 3 AL - ALBANIA 53 3.1 Must-carry rules 53 3.2 Other access rules 54 3.3 DTT networks and platform operators 54 3.4 Summary and conclusion 54 4 AT – AUSTRIA 55 4.1 Must-carry rules 55 4.2 Other access rules 58 4.3 Access to free DTT 59 4.4 Conclusion and summary 60 5 BA – BOSNIA AND HERZEGOVINA 61 5.1 Must-carry rules 61 5.2 Other access rules 62 5.3 DTT development 62 5.4 Summary and conclusion 62 6 BE – BELGIUM 63 6.1 Must-carry rules 63 6.2 Other access rules 70 6.3 Access to free DTT 72 6.4 Conclusion and summary 73 7 BG – BULGARIA 75 2 | Page 7.1 Must-carry rules 75 7.2 Must offer 75 7.3 Access to free DTT 76 7.4 Summary and conclusion 76 8 CH – SWITZERLAND 77 8.1 Must-carry rules 77 8.2 Other access rules 79 8.3 Access to free DTT -

Full Dissertation All the Bits 150515 No Interviews No
The Practice and Politics of Children’s Music Education in the German Democratic Republic, 1949-1976 By Anicia Chung Timberlake A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Music in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Richard Taruskin, Chair Professor Mary Ann Smart Professor Nicholas Mathew Professor Martin Jay Spring 2015 Abstract The Practice and Politics of Children’s Music Education in the German Democratic Republic, 1949-1976 by Anicia Chung Timberlake Doctor of Philosophy in Music University of California, Berkeley Professor Richard Taruskin, Chair This dissertation examines the politics of children’s music education in the first decades of the German Democratic Republic. The East German state famously attempted to co-opt music education for propagandistic purposes by mandating songs with patriotic texts. However, as I show, most pedagogues believed that these songs were worthless as political education: children, they argued, learned not through the logic of texts, but through the immediacy of their bodies and their emotions. These educators believed music to be an especially effective site for children’s political education, as music played to children’s strongest suit: their unconscious minds and their emotions. Many pedagogues, composers, and musicologists thus adapted Weimar-era methods that used mostly non-texted music to instill what they held to be socialist values of collectivism, diligence, open-mindedness, and critical thought. I trace the fates of four of these pedagogical practices—solfège, the Orff Schulwerk, lessons in listening, and newly-composed “Brechtian” children’s operas—demonstrating how educators sought to graft the new demands of the socialist society onto inherited German musical and pedagogical traditions. -

Marta Feuchtwanger Papers 0206
http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/kt10003750 No online items Finding Aid for Marta Feuchtwanger papers 0206 Finding aid prepared by Michaela Ullmann USC Libraries Special Collections Doheny Memorial Library 206 3550 Trousdale Parkway Los Angeles, California 90089-0189 [email protected] URL: http://libraries.usc.edu/locations/special-collections Finding Aid for Marta 02061223 1 Feuchtwanger papers 0206 Language of Material: English Contributing Institution: USC Libraries Special Collections Title: Marta Feuchtwanger papers creator: Franklin, Carl M. (Carl Mason) creator: Waldo, Hilde creator: Feuchtwanger, Marta Identifier/Call Number: 0206 Identifier/Call Number: 1223 Physical Description: 98.57 Linear Feet173 boxes Date (inclusive): 1940-1987 Abstract: This archive contains the correspondence of Marta Feuchtwanger, wife of German-Jewish writer Lion Feuchtwanger, who survived her husband by almost thirty years. Marta Feuchtwanger remained an important figure in the exile community and devoted the remainder of her life to promoting the work of her husband. The collection contains Marta Feuchtwanger's personal correspondence, texts and manuscripts by her and others, royalty statements received for the works of her husband, correspondence with publishers, and newspaper clippings mentioning Lion and Marta Feuchtwanger and other exiles. The collection also includes correspondence regarding the establishment and administration of the Feuchtwanger Memorial Library and Villa Aurora. Storage Unit: 91g Storage Unit: 91h Scope and Content This archive contains the correspondence of Marta Feuchtwanger, wife of German-Jewish writer Lion Feuchtwanger, who survived her husband by almost thirty years. Marta Feuchtwanger remained an important figure in the exile community and devoted the remainder of her life after his death to promoting the work of her husband. -

Warum Öffentlich-Rechtlich?
Dezember 2020 / Historische Kommission der ARD Warum öffentlich-rechtlich? Geschichte - Grundlagen - Perspektiven des Rundfunks in Deutschland WARUM ÖFFENTLICH-RECHTLICH? GESCHICHTE - GRUNDLAGEN - PERSPEKTIVEN DES RUNDFUNKS IN DEUTSCHLAND Warum gibt es überhaupt öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Wer heute vom Rundfunk spricht, weiß, dass es Ausgangspunkt dafür waren in Deutschland öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunk die extrem negativen Erfahrungen mit der gibt. Er kennt die sog. duale Rundfunkordnung, regierungsabhängigen und gleichgeschalteten in der beide seit Mitte der 1980er Jahre ihren Reichsrundfunkgesellschaft in der Zeit des Platz haben. Aber warum gibt es eigentlich Nationalsozialismus, die von Hitler und Goeb- öffentlich-rechtlichen Rundfunk und warum ist bels für ihre faschistischen Zwecke eingesetzt er so organisiert, wie wir ihn heute antreffen? und gesteuert wurde, um auf diese Weise die Welchen Auftrag hat er? Und brauchen wir ihn Bevölkerung gezielt einseitig und falsch zu heute in der digitalen Welt mit ihren schier informieren und zu beeinflussen. unendlichen Informationsmöglichkeiten noch? Diese Fragen sind auch heute noch für das Ver- ständnis des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und seines Auftrags sehr relevant. Weil dieser Auftrag, der für die Gegenwart und Zukunft verbindlich ist, bei der Errichtung der Rundfunk- anstalten zugrunde gelegt wurde, ist es zwing- end erforderlich, die Geschichte des Rundfunks zu vergegenwärtigen. Jeder, der heute, sei es als Mitarbeiter, sei es in dessen Gremien, für den öffentlich-rechtlichen -

Tätigkeitsbericht 2004-05
Tätigkeitsbericht 2004 - 2005 © 2006 Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam e.V. Am Neuen Markt 1 D-14467 Potsdam Tel.: +49-331-28991-0 Fax: +49-331-28991-40 Direktoren: Prof. Dr. Martin Sabrow (Geschäftsführend) Prof. Dr. Konrad H. Jarausch Redaktion: Dr. Hans-Hermann Hertle, Paul Benedikt Glatz Homepage: www.zzf-pdm.de Druck: Christian und Cornelius Rüss, Potsdam 2 INHALTSVERZEICHNIS Vorwort 5 1. Personal 9 Zur Emeritierung von Prof. Dr. Christoph Kleßmann 11 2. Gremien 13 3. DFG-Rahmenprojekt „Deutschland und Europa im Systemkonflikt“ und angegliederte Forschungsprojekte 15 Direktion 15 PB I: Berlin und sein Brandenburger Umland im Ost-West-Konflikt 17 PB II: Sozialismus als soziale Frage 19 PB III: Ideologien und Mentalitäten im Kalten Krieg 20 PB IV: Die Kultur des Politischen 21 PB V: Elektronische Fachinformation und -kommunikation 22 Bereich Öffentlichkeitsarbeit 25 4. Gesamtüberblick über die Forschungsprojekte 2004/2005 29 5. Koordinationsstelle des Projektverbunds „Zeitgeschichte Berlin-Brandenburg“ 35 6. Gastwissenschaftler 37 7. Institutskolloquien 40 8. Öffentlichkeitsarbeit 41 9. Veranstaltungen 44 10. Kooperationsbeziehungen 68 11. Bibliothek 81 12. Publikationen 84 13. Vorträge 116 14. Lehrveranstaltungen 146 15. Ausblick: ZZF-Forschungsprojekte 2006/2007 151 3 4 VORWORT Für das ZZF bedeuteten die Jahre 2004/2005 Kontinuität und Umbruch. Im Ja- nuar 2004 begann die zweite Phase des DFG-Projektzyklus „Deutschland und Europa im Systemkonflikt. Perzeptionen – Strukturen – Repräsentationen“, in der eine Reihe von Forschungsschwerpunkten fortgeführt und zahlreiche Pro- jekte der abschließenden Publikation näher gebracht wurden. Durch die Vielzahl der Themen gewann die Forschungsarbeit an Dynamik und Spannbreite. In der Institutsreihe „Zeithistorische Studien“ bei Böhlau erschienen 2004/2005 sechs Monographien; in anderen Verlagen wurden weitere 36 Bücher veröffentlicht. -

Features Und Reportagen Im Rundfunk Der DDR Tonträgerverzeichnis 1964-1991
Features und Reportagen im Rundfunk der DDR Tonträgerverzeichnis 1964-1991 Zusammengestellt von Patrick Conley ASKYLT VERLAG 2., überarbeitete Aufl. 1999 Nachdruck Alle Rechte vorbehalten durch Askylt Verlag, Berlin © 1998 Patrick Conley Printed in Germany ISBN 3-9807372-0-9 INHALT Vorwort...............................................................................................5 Tonträgerverzeichnis............................................................................9 Register ...........................................................................................189 Abkürzungen ...................................................................................215 VORWORT Während in Westdeutschland seit der Neugründung der Rundfunk- anstalten nach 1945 das Feature neben dem Hörspiel zum festen Bestandteil des Radioprogramms zählt, tauchte dieser Begriff im Rundfunk der DDR erst Mitte der 60er-Jahre auf. In den Vorlagen und Beschlussprotokollen des Staatlichen Rundfunkkomitees finden sich Anfang der 60er-Jahre mehrere Stellen, in denen vom Hörspiel, das unausgesprochen die Funktion des Features mit übernommen hatte, eine stärkere Betonung von Gegenwartsthemen erwartet wurde. "Die Dramaturgen", lautete eine der zentralen Forderungen, "müssen von den Mitarbeitern der aktuellen Politik lernen. Nur um die rein künstleri- sche Qualität zu kämpfen, kann nicht dazu beitragen, die aktuelle Problematik zu lösen."1 Im Januar 1963 wurde innerhalb der Hauptab- teilung Dramaturgie eine eigene Featureabteilung gegründet, die dieser Forderung