Nr. 3-4/2014 40. Jahrgang
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Dableiben Oder Ausreisen
Aus der Veranstaltungsreihe des Bundesbeauftragten Ausreisen oder dableiben? Regulierungsstrategien der Staatssicherheit Öffentliche Veranstaltung am 26. Oktober 1995 Bitte zitieren Sie diese Online-Publikation wie folgt: Bernd Eisenfeld, u. a.: Ausreisen oder dableiben? Regulierungsstragtegien der Staats- sicherheit (Reihe B: Analysen und Berichte, Nr. 1/97). Hg. BStU. 2. Auflage, Berlin 1998. http://www.nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0292-97839421304316 Mehr Informationen zur Nutzung von URNs erhalten Sie unter http://www.persistent-identifier.de/ einem Portal der Deutschen Nationalbibliothek. Reihe B: Analysen und Berichte, Nr. 1/97 Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik Abteilung Bildung und Forschung Postfach 218 10106 Berlin Die Meinungen, die in dieser Schriftenreihe geäußert werden, geben ausschließlich die Auffassungen der Autoren wieder. Abdruck und publizistische Nutzung sind nur mit An- gabe des Verfassers und der Quelle sowie unter Beachtung der Bestimmungen des Urhe- berrechtsgesetzes gestattet. 2. Auflage, Berlin 1998 ISBN 978-3-942130-43-1 Eine PDF-Version dieser Publikation ist unter der folgenden URN kostenlos abrufbar: urn:nbn:de:0292-97839421304316 Schutzgebühr: 5,00 € 3 Inhalt Vorbemerkung 3 Joachim Gauck Begrüßung und Einführung 4 Bernd Eisenfeld Strategien des Ministeriums für Staatssicherheit zur Steuerung der Ausreisebewegung 6 Hans-Hermann Lochen Die geheimgehaltenen Bestimmungen über das Ausreiseverfahren als Ausdruck staatlicher Willkür 19 Irena Kukutz Jede Weggegangene hinterließ eine Lücke 29 Werner Hilse Die Betreuung von Ausreiseantragstellern war eine Gratwanderung 32 Aus der Diskussion 37 Joachim Gauck Schlußbemerkung 56 Zu den Autoren 58 Dokumentenverzeichnis und Dokumente 60 Abkürzungsverzeichnis 126 Literaturhinweise 128 4 Vorbemerkung Seit Beginn der Entspannungspolitik fanden immer mehr Bürger der DDR den Mut, ihre Ausreise in den Westen, vornehmlich in die Bundesrepublik Deutschland und nach Berlin- West, zu betreiben. -
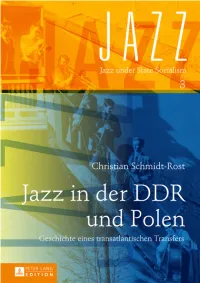
Jazz in Der DDR Und Polen
1 Einleitung „We want Miles!, We want Miles!“ skandierte das Publikum im völlig über- füllten Warschauer Kulturpalast.1 Das Abschlusskonzert des 25. Jazz Jam- boree Warsaw mit dem Miles Davis Septett ging zu Ende. Fast alle Zuhörer standen und unterstützten ihre Forderung mit rhythmischem Klatschen. Als Miles Davis für die dritte Zugabe auf die Bühne zurückkam, stimmte eine Gruppe im Publikum das Lied Sto lat an.2 Miles Davis hob zum Dank kurz den Hut. Derart emotionale Regungen von Miles waren äußerst selten und wurden in der Jazzszene als eine Sensation wahrgenommen.3 Bis heu- te sehen viele Mitglieder der polnischen Jazzszene den Auftritt von Miles Davis als einen der Höhepunkte des Jazzlebens in Polen an. Die wenigen Jazzfans aus der DDR, die es trotz des offiziellen Verbots von Reisen in die VR Polen zu diesem Konzert schafften, erinnern es auch als eines der besten Jazz Jamborees.4 Auch für Miles Davis war der Aufenthalt in Warschau ein herausragendes Erlebnis. So beschreibt er in seiner Autobiographie, er habe das Gefühl gehabt, die Menschen hätten ihn unbedingt sehen wollen und ihn und seine Musik außergewöhnlich gut verstanden. Zudem hätte man ihn wie einen Staatsgast behandelt und ihm von Yuri Andropov ausrichten lassen, dass er Davis für einen der größten Musiker der Welt halte.5 Gut 30 Jahre früher, Anfang der 1950er Jahre, wären ein Konzert eines amerikanischen Musikers und solch positive Äußerungen von sowjetischen Herrschenden über Jazz undenkbar gewesen. Jazz galt als die amerika- nische Musik schlechthin und wurde als solche von den Herrschenden in allen sozialistischen Staaten Ostmitteleuropas abgelehnt. Hierbei folgten die örtlichen Machthaber vor allem den ideologischen Vorgaben aus Mos- kau. -

March 26, 1948 Record of a Conversation Between I. V. Stalin and the Leaders of the Socialist Unity Party of Germany, Wilhelm Pieck and Otto Grotewohl
Digital Archive digitalarchive.wilsoncenter.org International History Declassified March 26, 1948 Record of a conversation between I. V. Stalin and the Leaders of the Socialist Unity Party of Germany, Wilhelm Pieck and Otto Grotewohl Citation: “Record of a conversation between I. V. Stalin and the Leaders of the Socialist Unity Party of Germany, Wilhelm Pieck and Otto Grotewohl,” March 26, 1948, History and Public Policy Program Digital Archive, APRF. F. 45. Op. 1. D. 303. pp. 24-49. http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/123209 Summary: Stalin, Pieck, and Grotewohl have a lengthy conversation about the Soviet Zone of Occupation and the activities of the Socialist Unity Party. Original Language: Russian Contents: English Translation Record of a conversation between Cde. I. V. Stalin and the leaders of the Socialist Unity Party of Germany Wilhelm Pieck and Otto Grotewohl, 26 March 1948, at 1900 hours Top Secret Present: V. M. Molotov, A. A. Zhdanov, G. M. Malenkov, V. S. Semenov (SVAG [Soviet Military Administration in Germany]), and interpreters - G. Ya. Korotkevich and F. Elsner. PIECK thanked I. V. Stalin for the welcome and also for the aid which the Soviet Military Administration in Germany gives the SED [Socialist Unity Party]. I. V. STALIN asks whether the Military Administration is actually giving aid or if this is a compliment. PIECK and GROTEWOHL say that they are actually receiving aid. STALIN, joking, asks again, does this mean that they don't just oppress you, but also give aid? PIECK, laughing, confirms [this]. Then he says that he will describe political issues and Grotewohl economic [ones]. -

African Americans, the Civil Rights Movement, and East Germany, 1949-1989
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by eScholarship@BC Friends of Freedom, Allies of Peace: African Americans, the Civil Rights Movement, and East Germany, 1949-1989 Author: Natalia King Rasmussen Persistent link: http://hdl.handle.net/2345/bc-ir:104045 This work is posted on eScholarship@BC, Boston College University Libraries. Boston College Electronic Thesis or Dissertation, 2014 Copyright is held by the author. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Boston College The Graduate School of Arts and Sciences Department of History FRIENDS OF FREEDOM, ALLIES OF PEACE: AFRICAN AMERICANS, THE CIVIL RIGHTS MOVEMENT, AND EAST GERMANY, 1949-1989 A dissertation by NATALIA KING RASMUSSEN submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy December 2014 © copyright by NATALIA DANETTE KING RASMUSSEN 2014 “Friends of Freedom, Allies of Peace: African Americans, the Civil Rights Movement, and East Germany, 1949-1989” Natalia King Rasmussen Dissertation Advisor: Devin O. Pendas This dissertation examines the relationship between Black America and East Germany from 1949 to 1989, exploring the ways in which two unlikely partners used international solidarity to achieve goals of domestic importance. Despite the growing number of works addressing the black experience in and with Imperial Germany, Nazi Germany, West Germany, and contemporary Germany, few studies have devoted attention to the black experience in and with East Germany. In this work, the outline of this transatlantic relationship is defined, detailing who was involved in the friendship, why they were involved, and what they hoped to gain from this alliance. -

Aufwachsen in Der
Siegener Periodicum zur Internationalen Empirischen______ Literaturwissenschaft Herausgegeben von Reinhold Viehoff (Halle/Saale) Gebhard Rusch (Siegen) Rien T. Segers (Groningen) Jg.20 (2001), Heft 1 Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften SPIEL Siegener Periodicum zur Internationalen Empirischen Literaturwissenschaft SPIEL: Siegener Periodicum zur Internationalen Empirischen Lite raturwissenschaft Jg.20 (2001), Heft 1 Peter Lang Frankfurt am Main • Berlin • Bern • Bruxelles • New York • Oxford • Wien Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme Siegener Periodicum zur internationalen empirischen Literatur wissenschaft (SPIEL) Frankfurt am Main ; Berlin ; Bern ; New York ; Paris ; Wien : Lang ISSN 2199-80780722-7833 Erscheint jährl. zweimal JG. 1, H. 1 (1982)- [Erscheint: Oktober 1982] NE: SPIEL ISSNISSN 2199-80780722-7833 © Peter Lang GmbH Europäischer Verlag der Wissenschaften Frankfurt am Main 2001 Alle Rechte Vorbehalten. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Siegener Periodicum zur Internationalen Empirischen Literaturwissenschaft SONDERHEFT / SPECIAL ISSUE SPIEL 20 (2001), H. 1 Unterhaltende Genres in "sozialistischen" Medien - und anderswo Genres of Entertainment, Socialism, TV Channels, and Contexts. hrsg. von -

Copyright by Sebastian Heiduschke 2006
Copyright by Sebastian Heiduschke 2006 The Dissertation Committee for Sebastian Heiduschke Certifies that this is the approved version of the following dissertation: The Afterlife of DEFA in Post-Unification Germany: Characteristics, Traditions and Cultural Legacy Committee: Kirsten Belgum, Supervisor Hans-Bernhard Moeller, Co-Supervisor Pascale Bos David Crew Janet Swaffar The Afterlife of DEFA in Post-Unification Germany: Characteristics, Traditions and Cultural Legacy by Sebastian Heiduschke, M.A. Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy The University of Texas at Austin December, 2006 Dedication Für meine Familie Acknowledgements First and foremost it is more than justified to thank my two dissertation advisers, Kit Belgum and Bernd Moeller, who did an outstanding job providing me with the right balance of feedback and room to breathe. Their encouragement, critical reading, and honest talks in the inevitable times of doubt helped me to complete this project. I would like to thank my committee, Pascale Bos, Janet Swaffar, and David Crew, for serving as readers of the dissertation. All three have been tremendous inspirations with their own outstanding scholarship and their kind words. My thanks also go to Zsuzsanna Abrams and Nina Warnke who always had an open ear and an open door. The time of my research in Berlin would not have been as efficient without Wolfgang Mackiewicz at the Freie Universität who freed up many hours by allowing me to work for the Sprachenzentrum at home. An invaluable help was the library staff at the Hochschule für Film und Fernsehen “Konrad Wolf” Babelsberg . -

Radiophonic Spaces Radiophonic Radiophonic Spaces Spaces
radiophonic spaces Radiophonic Radiophonic Spaces Spaces Ein Hör-Parcours durch die A sonic journey through radio art Radiokunst Radiophonic Spaces ist ein begehbarer Radiophonic Spaces is at the same time Radioraum und zugleich experimentelles a walk-in radio space and an experimen- Archiv – eine Symbiose aus künstleri- tal archive – a symbiosis of an artistic scher Auseinandersetzung mit Radio- exploration of radio art and radiophony kunst und Radiophonie und einem and an academic research project headed wissenschaftlichen Forschungsprojekt by the Chair of Experimental Radio at unter Federführung des Experimentel- the Bauhaus-Universität Weimar. Under len Radios an der Bauhaus-Universität the artistic direction of Nathalie Singer, Weimar. Ein Team von Radiokünst- a team of radio artists and researchers ler*innen und -forscher*innen hat unter conceived this experimental archive, Leitung von Nathalie Singer diesen which was designed by the artist, archi- Hör-Raum der Radiokunst konzipiert, tect and musician Cevdet Erek. der von dem Künstler, Architekten und Musiker Cevdet Erek gestaltet wurde. The works made accessible in Radio- phonic Spaces range from early radio Die in Radiophonic Spaces zugänglich experiments to contemporary produc- gemachten Arbeiten reichen von Experi- tions. Radio researchers, musicologists, menten aus der Frühzeit des Radios editors, critics and artists from the bis zu zeitgenössischen Produktionen. most varied of contexts and disciplines Radioforscher*innen, Musikwissen- selected over 200 works from 100 years schaftler*innen, Redakteur*innen, Kri- of international radio art for Radio- tiker*innen und Künstler*innen aus den phonic Spaces and arranged them in 13 verschiedensten Kontexten und Diszi- ‘narratives’. The result is a kaleidoscopic plinen haben für Radiophonic Spaces overview of the development of radio über 200 Arbeiten aus 100 Jahren inter- art as well as of recurring themes, motifs nationaler Radiokunst ausgewählt und and procedures. -

Volkskammer Der Deutschen Demokratischen Republik 10
Volkskammer Drucksache Nr. 134 der Deutschen Demokratischen Republik 10. Wahlperiode Antrag des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik vom 11. Juli 1990 Die Volkskammer wolle beschließen: Überleitungsgesetz zu Hörfunk und Fernsehen (Rundfunk) der Deutschen Demokratischen Republik (Rundfunküberleitungsgesetz) Lothar de Malzihre Ministerpräsident Entwurf ÜBERLEITUNGSGESETZ Zu Hörfunk und Fernsehen (Rundfunk) der Deutschen Demokratischen Republik (Rundfunküberleitungsgesetz) Inhaltsverzeichnis Seite Präambel 1. Abschnitt Allgemeines § 1 Recht der freien Meinungsäußerung, 5 Rundfunkbegrifff 2. Abschnitt Programmauftrag, Programmgrund- sätze § 2 Programmgrundsätze 5 § 3 Berichterstattung 6 § 4 Gegendarstcllung -6 § 5 Verlautbarungsrecht 7 § 6 Sendezeit für Dritte 8 § 7 Unzulässige Sendungen, Jugendschutz 8 § 8 Beweissicherung 3. Abschnitt Aufsicht über den Rundfunk § Rechtsaufsicht 10 4. Abschnitt Organisation des öffent lich-rechtlichen Rundfunks § 10 Errichtung von Landesrundfunk- 10 direktoraten § 11 Deutscher Fernsehfunk, Rundfunk 11 der DDR § 12 Aufgaben und Programmauftrag 11 § 13 Organe des Landesrundfunkdirektorates 12 § 14 Aufgaben des Beirates 13 § 15 Aufgaben des Direktors 13 § 16 Gemeinschaftliche Organe der Landes- 14 rundfunkdirektorate § 17 Aufgaben des Rundfunkausschusses 14 § 18 Aufgaben des Direktoratsrats 14 § 19 Recht der Personalvertretung 15 5. Abschnitt Finanzierung des öffentlich-recht- lichen Rundfunks § 20 Finanzierung 15 § 21 Gebühren 15 15 Einnahmen, Mittelbewirt- § 22 schaftung, Gebühreneinzug -

WEGE NACH BAUTZEN II We G E Nac H Bautz N Ii
Lebenszeugnisse – Leidenswege n ii E bautz H WEgE nac E g nacH bautzEn ii WE biographische und autobiographische Porträts Eingeleitet von Silke Klewin und Kirsten Wenzel STIFTUNG ISBN 978-3-9805527-7-6 SÄCHSISCHE GEDENKSTÄTTEN zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft 8 Heft LL8-Umschlag_042013.indd 1 06.05.13 10:00 Lebenszeugnisse – Leidenswege Heft 8 WEGE NACH BAUTZEN II Biographische und autobiographische Porträts Eingeleitet von Silke Klewin und Kirsten Wenzel Dresden 2013 Lebenszeugnisse – Leidenswege Eine Heftreihe herausgegeben von Klaus-Dieter Müller, Siegfried Reiprich und Clemens Vollnhals im Auftrag der Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft in Zusammenarbeit mit dem Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e.V. an der TU Dresden Heft 8 © Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft (1998) 4. korrigierte Auflage 2013 Titelfoto: Hossein Yazdi bei seiner Einlieferung nach Bautzen II, 1962 Satz: Walter Heidenreich, HAIT Dresden Umschlaggestaltung: CCP Kummer & Co. GmbH, Dresden Druck: Stoba-Druck GmbH, Lampertswalde Printed in Germany ISBN 978-3-9805527-7-6 In halts ver zeich nis Ein lei tung 7 Bio graphi sche und au to bio gra phi sche Por träts 15 Karl Wil helm Fri cke Mei ne We ge nach Baut zen II 17 Gus tav Just Der Re form kom mu nist 31 Man fred Wil ke Heinz Brandt – in Selbst zeug nis sen 45 Hoss ein Yaz di Als Ira ner in Baut zen II 61 Rein hard Borg mann Die vier Le ben der Eri ka Lo ken vitz 77 Jan-Hen rik Pe ters Adolf-Hen ning Frucht: Wis sen- schaft ler und Ama teur spi on 91 Mat thi as Bath Die Flucht hel fer Rai ner Schu bert und Hart mut Rich ter 105 Kirs ten Wen zel Char lot te Rauf ei sen: Haus frau und Mut ter 121 Sil ke Kle win/Cor ne lia Lie bold Bo do Streh low – Der ab trün ni ge Maat der Volks ma ri ne 131 An hang 145 Sil ke Kle win/Kirs ten Wen zel Ein lei tung I. -

The Ashgate Research Companion to Imperial Germany ASHGATE RESEARCH COMPANION
ASHGATE RESEARCH COMPANION THE ASHGatE RESEarCH COMPANION TO IMPERIAL GERMANY ASHGATE RESEARCH COMPANION The Ashgate Research Companions are designed to offer scholars and graduate students a comprehensive and authoritative state-of-the-art review of current research in a particular area. The companions’ editors bring together a team of respected and experienced experts to write chapters on the key issues in their speciality, providing a comprehensive reference to the field. The Ashgate Research Companion to Imperial Germany Edited by MattHEW JEFFERIES University of Manchester, UK © Matthew Jefferies 2015 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior permission of the publisher. Matthew Jefferies has asserted his right under the Copyright, Designs and Patents Act, 1988, to be identified as the editor of this work. Published by Ashgate Publishing Limited Ashgate Publishing Company Wey Court East 110 Cherry Street Union Road Suite 3-1 Farnham Burlington, VT 05401-3818 Surrey, GU9 7PT USA England www.ashgate.com British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Library of Congress Cataloging-in-Publication Data The Ashgate research companion to Imperial Germany / edited by Matthew Jefferies. pages cm Includes bibliographical references and index. ISBN 978-1-4094-3551-8 (hardcover) – ISBN 978-1-4094-3552-5 -

Television and the Cold War in the German Democratic Republic
0/-*/&4637&: *ODPMMBCPSBUJPOXJUI6OHMVFJU XFIBWFTFUVQBTVSWFZ POMZUFORVFTUJPOT UP MFBSONPSFBCPVUIPXPQFOBDDFTTFCPPLTBSFEJTDPWFSFEBOEVTFE 8FSFBMMZWBMVFZPVSQBSUJDJQBUJPOQMFBTFUBLFQBSU $-*$,)&3& "OFMFDUSPOJDWFSTJPOPGUIJTCPPLJTGSFFMZBWBJMBCMF UIBOLTUP UIFTVQQPSUPGMJCSBSJFTXPSLJOHXJUI,OPXMFEHF6OMBUDIFE ,6JTBDPMMBCPSBUJWFJOJUJBUJWFEFTJHOFEUPNBLFIJHIRVBMJUZ CPPLT0QFO"DDFTTGPSUIFQVCMJDHPPE Revised Pages Envisioning Socialism Revised Pages Revised Pages Envisioning Socialism Television and the Cold War in the German Democratic Republic Heather L. Gumbert The University of Michigan Press Ann Arbor Revised Pages Copyright © by Heather L. Gumbert 2014 All rights reserved This book may not be reproduced, in whole or in part, including illustrations, in any form (be- yond that copying permitted by Sections 107 and 108 of the U.S. Copyright Law and except by reviewers for the public press), without written permission from the publisher. Published in the United States of America by The University of Michigan Press Manufactured in the United States of America c Printed on acid- free paper 2017 2016 2015 2014 5 4 3 2 A CIP catalog record for this book is available from the British Library. ISBN 978– 0- 472– 11919– 6 (cloth : alk. paper) ISBN 978– 0- 472– 12002– 4 (e- book) Revised Pages For my parents Revised Pages Revised Pages Contents Acknowledgments ix Abbreviations xi Introduction 1 1 Cold War Signals: Television Technology in the GDR 14 2 Inventing Television Programming in the GDR 36 3 The Revolution Wasn’t Televised: Political Discipline Confronts Live Television in 1956 60 4 Mediating the Berlin Wall: Television in August 1961 81 5 Coercion and Consent in Television Broadcasting: The Consequences of August 1961 105 6 Reaching Consensus on Television 135 Conclusion 158 Notes 165 Bibliography 217 Index 231 Revised Pages Revised Pages Acknowledgments This work is the product of more years than I would like to admit. -

Programy Reichs- Rundfunk-Gesellschaft W Polsce (1923–1939)
T. XXIII (2020) Z. 1 (57) ROCZNIK ISSN 1509-1074 HISTORII PRASY POLSKIEJ DOI 10.24425/rhpp.2020.133417 The German Broadcasting Programy Reichs- Corporation (Reichs- Rundfunk-Gesellschaft -Rundfunk-Gesellschaft) w Polsce (1923–1939) and Poland (1923–1939) Instytut Dziennikarstwa Sebastian Uniwersytet Śląski w Katowicach FIKUS ul. Bankowa 11 PL 40-007 Katowice e-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0002-1155-2762 KEY WORDS: SŁOWA KLUCZOWE: history of broadcasting in Poland and Germany traktat wersalski, II wojna, okres międzywojenny, in the Interwar period, Polish-German relations in kompanie prasowe, prowokacja gliwicka, the Interwar period, Polish Radio and the German radiofonia w Gdańsku, radiofonia we Wrocławiu, Broadcasting Corporation, politics and radio in historia radia Upper Silesia and the Free City of Gdańsk, German Radio at the outbreak of World War II, the Gleiwitz incident ABSTRACT ABSTRAKT This article surveys the relations between the Artykuł omawia trudne relacje pomiędzy polską Polish Radio and the German Broadcasting i niemiecką radiofonią w okresie Corporation (Reichs-Rundfunk-Gesellschaft) in międzywojennym. Zaczęły się one od sporów the interwar period. In its early phase the o treści programów na Górnym Śląsku i przejęcia relationship was overshadowed by disputes over kontroli przez stronę niemiecką nad rozgłośnią programmes on Upper Silesia and the takeover by w Gdańsku. Po dojściu Hitlera do władzy a German company of the radio station in the Free relacje te się poprawiły, a nawet wzajemnie City of Gdańsk (Danzig). After Hitler became retransmitowano programy. Ostatecznie chancellor in 1933 there was a marked improve- niemiecka radiofonia odegrała podczas ment in relations: the two parties even made an inwazji Wehrmachtu we wrześniu 1939 roku agreement to relay each other's programmes.