WEGE NACH BAUTZEN II We G E Nac H Bautz N Ii
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Dableiben Oder Ausreisen
Aus der Veranstaltungsreihe des Bundesbeauftragten Ausreisen oder dableiben? Regulierungsstrategien der Staatssicherheit Öffentliche Veranstaltung am 26. Oktober 1995 Bitte zitieren Sie diese Online-Publikation wie folgt: Bernd Eisenfeld, u. a.: Ausreisen oder dableiben? Regulierungsstragtegien der Staats- sicherheit (Reihe B: Analysen und Berichte, Nr. 1/97). Hg. BStU. 2. Auflage, Berlin 1998. http://www.nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0292-97839421304316 Mehr Informationen zur Nutzung von URNs erhalten Sie unter http://www.persistent-identifier.de/ einem Portal der Deutschen Nationalbibliothek. Reihe B: Analysen und Berichte, Nr. 1/97 Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik Abteilung Bildung und Forschung Postfach 218 10106 Berlin Die Meinungen, die in dieser Schriftenreihe geäußert werden, geben ausschließlich die Auffassungen der Autoren wieder. Abdruck und publizistische Nutzung sind nur mit An- gabe des Verfassers und der Quelle sowie unter Beachtung der Bestimmungen des Urhe- berrechtsgesetzes gestattet. 2. Auflage, Berlin 1998 ISBN 978-3-942130-43-1 Eine PDF-Version dieser Publikation ist unter der folgenden URN kostenlos abrufbar: urn:nbn:de:0292-97839421304316 Schutzgebühr: 5,00 € 3 Inhalt Vorbemerkung 3 Joachim Gauck Begrüßung und Einführung 4 Bernd Eisenfeld Strategien des Ministeriums für Staatssicherheit zur Steuerung der Ausreisebewegung 6 Hans-Hermann Lochen Die geheimgehaltenen Bestimmungen über das Ausreiseverfahren als Ausdruck staatlicher Willkür 19 Irena Kukutz Jede Weggegangene hinterließ eine Lücke 29 Werner Hilse Die Betreuung von Ausreiseantragstellern war eine Gratwanderung 32 Aus der Diskussion 37 Joachim Gauck Schlußbemerkung 56 Zu den Autoren 58 Dokumentenverzeichnis und Dokumente 60 Abkürzungsverzeichnis 126 Literaturhinweise 128 4 Vorbemerkung Seit Beginn der Entspannungspolitik fanden immer mehr Bürger der DDR den Mut, ihre Ausreise in den Westen, vornehmlich in die Bundesrepublik Deutschland und nach Berlin- West, zu betreiben. -

The Ashgate Research Companion to Imperial Germany ASHGATE RESEARCH COMPANION
ASHGATE RESEARCH COMPANION THE ASHGatE RESEarCH COMPANION TO IMPERIAL GERMANY ASHGATE RESEARCH COMPANION The Ashgate Research Companions are designed to offer scholars and graduate students a comprehensive and authoritative state-of-the-art review of current research in a particular area. The companions’ editors bring together a team of respected and experienced experts to write chapters on the key issues in their speciality, providing a comprehensive reference to the field. The Ashgate Research Companion to Imperial Germany Edited by MattHEW JEFFERIES University of Manchester, UK © Matthew Jefferies 2015 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior permission of the publisher. Matthew Jefferies has asserted his right under the Copyright, Designs and Patents Act, 1988, to be identified as the editor of this work. Published by Ashgate Publishing Limited Ashgate Publishing Company Wey Court East 110 Cherry Street Union Road Suite 3-1 Farnham Burlington, VT 05401-3818 Surrey, GU9 7PT USA England www.ashgate.com British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Library of Congress Cataloging-in-Publication Data The Ashgate research companion to Imperial Germany / edited by Matthew Jefferies. pages cm Includes bibliographical references and index. ISBN 978-1-4094-3551-8 (hardcover) – ISBN 978-1-4094-3552-5 -

Television and the Cold War in the German Democratic Republic
0/-*/&4637&: *ODPMMBCPSBUJPOXJUI6OHMVFJU XFIBWFTFUVQBTVSWFZ POMZUFORVFTUJPOT UP MFBSONPSFBCPVUIPXPQFOBDDFTTFCPPLTBSFEJTDPWFSFEBOEVTFE 8FSFBMMZWBMVFZPVSQBSUJDJQBUJPOQMFBTFUBLFQBSU $-*$,)&3& "OFMFDUSPOJDWFSTJPOPGUIJTCPPLJTGSFFMZBWBJMBCMF UIBOLTUP UIFTVQQPSUPGMJCSBSJFTXPSLJOHXJUI,OPXMFEHF6OMBUDIFE ,6JTBDPMMBCPSBUJWFJOJUJBUJWFEFTJHOFEUPNBLFIJHIRVBMJUZ CPPLT0QFO"DDFTTGPSUIFQVCMJDHPPE Revised Pages Envisioning Socialism Revised Pages Revised Pages Envisioning Socialism Television and the Cold War in the German Democratic Republic Heather L. Gumbert The University of Michigan Press Ann Arbor Revised Pages Copyright © by Heather L. Gumbert 2014 All rights reserved This book may not be reproduced, in whole or in part, including illustrations, in any form (be- yond that copying permitted by Sections 107 and 108 of the U.S. Copyright Law and except by reviewers for the public press), without written permission from the publisher. Published in the United States of America by The University of Michigan Press Manufactured in the United States of America c Printed on acid- free paper 2017 2016 2015 2014 5 4 3 2 A CIP catalog record for this book is available from the British Library. ISBN 978– 0- 472– 11919– 6 (cloth : alk. paper) ISBN 978– 0- 472– 12002– 4 (e- book) Revised Pages For my parents Revised Pages Revised Pages Contents Acknowledgments ix Abbreviations xi Introduction 1 1 Cold War Signals: Television Technology in the GDR 14 2 Inventing Television Programming in the GDR 36 3 The Revolution Wasn’t Televised: Political Discipline Confronts Live Television in 1956 60 4 Mediating the Berlin Wall: Television in August 1961 81 5 Coercion and Consent in Television Broadcasting: The Consequences of August 1961 105 6 Reaching Consensus on Television 135 Conclusion 158 Notes 165 Bibliography 217 Index 231 Revised Pages Revised Pages Acknowledgments This work is the product of more years than I would like to admit. -
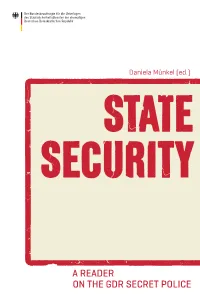
Bstu / State Security. a Reader on the GDR
Daniela Münkel (ed.) STATE SECURITY A READER ON THE GDR SECRET POLICE Daniela Münkel (ed.) STATE SECURITY A READER ON THE GDR SECRET POLICE Imprint Federal Commissioner for the Records of the State Security Service of the former German Democratic Republic Department of Education and Research 10106 Berlin [email protected] Photo editing: Heike Brusendorf, Roger Engelmann, Bernd Florath, Daniela Münkel, Christin Schwarz Layout: Pralle Sonne Originally published under title: Daniela Münkel (Hg.): Staatssicherheit. Ein Lesebuch zur DDR-Geheimpolizei. Berlin 2015 Translation: Miriamne Fields, Berlin A READER The opinions expressed in this publication reflect solely the views of the authors. Print and media use are permitted ON THE GDR SECRET POLICE only when the author and source are named and copyright law is respected. token fee: 5 euro 2nd edition, Berlin 2018 ISBN 978-3-946572-43-5 6 STATE SECURITY. A READER ON THE GDR SECRET POLICE CONTENTS 7 Contents 8 Roland Jahn 104 Arno Polzin Preface Postal Inspection, Telephone Surveillance and Signal Intelligence 10 Helge Heidemeyer The Ministry for State Security and its Relationship 113 Roger Engelmann to the SED The State Security and Criminal Justice 20 Daniela Münkel 122 Tobias Wunschik The Ministers for State Security Prisons in the GDR 29 Jens Gieseke 130 Daniela Münkel What did it Mean to be a Chekist? The State Security and the Border 40 Bernd Florath 139 Georg Herbstritt, Elke Stadelmann-Wenz The Unofficial Collaborators Work in the West 52 Christian Halbrock 152 Roger Engelmann -

1 Karl Wilhelm Fricke: Widerstand Und Opposition Von 1945 Bis Ende Der Fünfziger Jahre Quelle: Deutscher Bundestag (Hrsg.): Ma
Karl Wilhelm Fricke: Widerstand und Opposition von 1945 bis Ende der fünfziger Jahre Quelle: Deutscher Bundestag (Hrsg.): Materialien der Enquete-Kommission. „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“ (12. Wahlperiode des Deutschen Bundestages), Bd. VII, Teil 1, S. 15-26. Auf eigene Definitionsversuche von Opposion und Dissidenz, Resistenz und Widerstand möchte ich hier verzichten. Sie blieben nach meiner Auffassung ohnehin fragwürdig, weil sich Geschichte, auch die Geschichte von Opposition und Widerstand in der DDR, als dialektischer Prozeß vollzieht und daher letztlich kaum definieren oder gar in das Prokrustesbett einer Theorie zwingen läßt. Der Berliner Historiker Peter Steinbach hat im Blick auf den Widerstand unter dem Hakenkreuz-Regime einmal geschrieben, daß „nicht primär eine historisch gesättigte Theorie des Widerstands anzustreben“ sei, „sondern eine möglichst farbige, inhaltlich und historisch differenzierte Gesamtgeschichte des Widerstands.“ Eine solche Gesamtgeschichte wäre ein wichtiger Beitrag der Historiker zu einer Theoriebildung oder, zumindest, zu einer Begriffsbestimmung von Opposition und Widerstand auch unter dem Regime der SED. Welche historischen Sachverhalte und Verhaltensweisen aus der Nachkriegszeit in der Sowjetischen Besatzungszone und aus den fünfziger Jahren in der DDR in eine solche Gesamtgeschichte einzubeziehen wären – eben dies will ich in der nächsten halben Stunde kurz aufzuzeigen versuchen als Einleitung zu einer hoffentlich lebhaften Diskussion mit den Zeitzeugen. Der -

The East German Secret Service Structure and Operational Focus by J.A
Fall 1987 The East German Secret Service Structure and Operational Focus by J.A. Emerson Vermaat INTRODUCTION The East German secret service, more than any other Eastern bloc service, exercises the bulk of its activities in the Federal Republic of Ger many (FRG). Until 1945 the two Germanies shared a common past and culture and Germans in East and West still speak the same language. Consequently, it is much easier for East German agents to penetrate West German society and recruit West German citizens than it is for the Soviet KGB. Of the roughly 4000 Communist spies in West Germany, some 2500-3000 originate in East Germany. ' Most of the East German espionage is conducted by the Ministry of State Security (MfS) at the Normannenstrasse in East Berlin. Military in telligence operations are chiefly conducted by the Ministry of National Defence (MfNV). Founded in February 1950 — five months after the creation of the German Democratic Republic (GDR) — the Ministry's main purpose was to contribute to consolidating the new Communist regime imposed on the population in the Soviet controlled zone of Ger many. About 80% of the Ministry's activities continue to be focussed on internal control and repression and only 20% of its work is devoted to external espionage.2 As an organ of the GDR Ministerial Council the MfS is to protect "the socialist order of state and society against hostile attacks on the sovereignty and territorial of the GDR, the socialist achievements and the peaceful life of the people."3 The Soviets had a strong hand in the creation of the East German state security apparatus. -

The German Question
Part II The German Question Gorbachev and the GDR 145 Chapter 7 Gorbachev and the GDR Daniel S. Hamilton The German Democratic Republic (GDR) was the illegitimate off- spring of the Cold War, in the words of one writer, the “state that can- not be.”1 Even after forty years of separate existence, the GDR never became a nation; it was never seen as a 1egitimate state by its own people, by West Germans or even by its own superpower patron, the Soviet Union.2 The illegitimate nature of the East German regime proved to be an incurable birth defect. It was also a characteristic that distinguished East Germany from its socialist neighbors. Unlike Polish, Hungarian or Czechoslovak rulers, the GDR regime could not fall back on distinct national traditions or a sense of historical continuity binding its citi- zens to its leaders. The Finnish diplomat Max Jacobson captured the essence of the GDR’s precarious position: The GDR is fundamentally different from all other Warsaw Pact members. It is not a nation, but a state built on an ideological con- cept. Poland will remain Poland, and Hungary will always be Hun- gary, whatever their social system. But for East Germany, main- taining its socialist system is the reason for its existence.3 As J.F. Brown put it, “history has been full of nations seeking state- hood, but the GDR was a state searching for nationhood.”4 This lack of legitimacy afflicted the regime during the entire 40-year existence of the East German state. Without legitimacy, the regime could never consolidate its internal authority or its external stability. -

Legitimation, Repression and Co-Optation in the German Democratic Republic Udo Grashoff
Legitimation, Repression and Co-optation in the German Democratic Republic Udo Grashoff I. Legitimation and Legitimacy of the SED Rule The German Democratic Republic (GDR) was created by the Soviet power. Therefore, all efforts to gain acceptance of its own people should be considered as actions to compensate for its general intrinsic lack of legitimacy as a nation state.1 Moreover, the idea of nationalism in East Germany took on a subversive meaning because of the division of Germany. The Federal Republic of Germany (FRG) claimed to represent all Germans, which made the political leadership of the “Sozialistische Einheitspartei Deutschlands” (SED, “Socialist Unity Party of Germany”) seem questionable. The communist Party could only partly rely on national values and was forced to establish substitutes. Furthermore, the permanent rivalry between the two German states and the fact that communists were a minority within the East German society put strong pressure on the SED to legitimize its dictatorship. 1. Normative Justification of the Rule: Communism as the Ultimate Aim Throughout 1945/46 to 1990, the SED used Marxist-Leninist ideology as the basic justification for its claim to power in all stages of its rule. At the core of this oversimplified historical materialism lay the belief that the communists not only knew the law of historical development but were also able to control social progress. Hence, the constitutionally stated leading role of the SED was legitimized by the idea that the party should act as the executor of the historical law that would lead towards a classless society. This idea allows the designation of the GDR as an ideocracy. -

Die Akten Der Wahrheit
Edda Ahrberg/Roger Engelmann/ Karl Wilhelm Fricke/Joachim Gauck/ Vera Lengsfeld/Peter Sense Die Akten und die Wahrheit Aktuelle Fragen der Politik Heft 49 Herausgegeben von der Konrad-Adenauer-Stiftung Redaktion dieses Heftes: Felix Becker Mit dem 1992 verabschiedeten Gesetz über die Stasi-Unterlagen und der Errichtung der Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (BStU) wurde die offizielle Grundlage zur Aufarbeitung der SED-Vergangenheit geschaffen. Die praktische Umsetzung und Erfahrungen, der Stand der wissenschaftlichen Aufarbeitung und die Aufnahme der Ergebnisse in der Öffentlichkeit bedürfen stetiger Bilanzierung. Vorliegendes Heft enthält Vorträge einer in Zusammenarbeit mit dem BStU veranstalteten Fachkonferenz der Konrad-Adenauer-Stiftung über ”Die Akten und Wahrheit”. Die Autoren: Edda Ahrberg, Landesbeauftragte in Sachsen-Anhalt für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR Dr. Roger Engelmann, Wiss. Mitarbeiter in der Abteilung Bildung und Forschung beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR Dr. h.c. Karl Wilhelm Fricke, ehem. Leiter der Ost-West-Abteilung des Deutschlandfunks, Mitglied der beiden Enquete-Kommissionen des Deutschen Bundestages zur Aufarbeitung der SED-Diktatur Joachim Gauck, Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR Vera Lengsfeld, Bürgerrechtlerin, 1988 in der DDR verhaftet, verurteilt und abgeschoben, seit 1990 MdB (B.90/Grüne, 1996 CDU) Peter Sense, Landesbeauftragter in Mecklenburg-Vorpommern für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR Die Reihe kann bezogen werden von der Konrad-Adenauer-Stiftung Referat für Publikationen Postfach 1420 D-53732 Sankt Augustin Telefon 0 22 41/246-264 Telefax 0 22 41/246-294 E-Mail: [email protected] Die Hefte der Reihe ”Aktuelle Fragen der Politik” können auch im Internet unter der Adresse http://www.kas.de abgerufen werden. -

Oldenburger Beiträge Zur DDR- Und DEFA-Forschung
Oldenburger Beiträge zur DDR- und DEFA-Forschung Band 4 Die Schriftenreihe soll ein Forum für die wissenschaftliche Auseinander- setzung mit den politisch-kulturellen Hinterlassenschaften der SED-Diktatur bieten. Dabei werden die Filme der DEFA im Mittelpunkt stehen. Dieses Filmerbe, das mit Gründung der DEFA-Stiftung im Januar 1999 in Berlin den Rang eines „nationalen Kulturerbes” erhalten hat, stellt für politik- und kultur-wissenschaftliche Forschungen einen außerordentlich bedeutsamen Quellenbestand dar. In der Mediathek der Universitätsbibliothek Oldenburg steht ein umfangreicher Bestand an Spiel- und Dokumentarfilmen der DEFA sowie weiteres Quellenmaterial zur Filmgeschichte der DDR für Lehre und Forschung zur Verfügung. Worin besteht die Bedeutsamkeit dieses Erbes? Was zeigen die Bilder des Staatsmediums? Bilden sie die ideologischen Fiktionen eines totalitären Herr- schaftssystems in seinen unterschiedlichen Erscheinungsweisen ab oder kön- nen sie Einblicke gewähren in die Lebenswelt der sozialistischen Gesell- schaft? Darin ist die ganze Spannweite möglicher Fragen enthalten. Auf sie Antworten zu geben, wird Anliegen dieser Schriftenreihe sein. Sie steht Wis- senschaftlern, Publizisten, Zeitzeugen, Studierenden und allen Interessierten offen. Die Herausgeber Oldenburger Beiträge zur DDR- und DEFA-Forschung Eine Schriftenreihe der Arbeitsstelle „DEFA-Filme als Quellen zur Politik und Kultur der DDR“ und des Bibliotheks- und Informationssystems der Universität Oldenburg Herausgegeben von: Klaus Finke, Helmut Freiwald, Gebhard Moldenhauer, -

The Stasi at Home and Abroad the Stasi at Home and Abroad Domestic Order and Foreign Intelligence
Bulletin of the GHI | Supplement 9 the GHI | Supplement of Bulletin Bulletin of the German Historical Institute Supplement 9 (2014) The Stasi at Home and Abroad Stasi The The Stasi at Home and Abroad Domestic Order and Foreign Intelligence Edited by Uwe Spiekermann 1607 NEW HAMPSHIRE AVE NW WWW.GHI-DC.ORG WASHINGTON DC 20009 USA [email protected] Bulletin of the German Historical Institute Washington DC Editor: Richard F. Wetzell Supplement 9 Supplement Editor: Patricia C. Sutcliffe The Bulletin appears twice and the Supplement usually once a year; all are available free of charge and online at our website www.ghi-dc.org. To sign up for a subscription or to report an address change, please contact Ms. Susanne Fabricius at [email protected]. For general inquiries, please send an e-mail to [email protected]. German Historical Institute 1607 New Hampshire Ave NW Washington DC 20009-2562 Phone: (202) 387-3377 Fax: (202) 483-3430 Disclaimer: The views and conclusions presented in the papers published here are the authors’ own and do not necessarily represent the position of the German Historical Institute. © German Historical Institute 2014 All rights reserved ISSN 1048-9134 Cover: People storming the headquarters of the Ministry for National Security in Berlin-Lichtenfelde on January 15, 1990, to prevent any further destruction of the Stasi fi les then in progress. The poster on the wall forms an acrostic poem of the word Stasi, characterizing the activities of the organization as Schlagen (hitting), Treten (kicking), Abhören (monitoring), -

Nr. 3-4/2014 40. Jahrgang
Rundfunk und Geschichte Nr. 3-4/2014 ● 40. Jahrgang Ansgar Diller / Edgar Lersch Von Vereinsmitteilungen zur wissenschaftlichen Zeitschrift Editorial: 40 Jahre „Rundfunk und Geschichte“ Interview Audiovisuelles Erbe Europas online zugänglich Eggo Müller über EUscreenXL Thema: Deutsch-deutsch und international – Rundfunk im Kalten Krieg „…was machen unsere West-Kollegen?“ Heinz Adameck (†) im Gespräch Christoph Classen „Um die Empfangsmöglichkeiten … des Senders RIAS völlig auszuschalten…“ Störsender in der DDR 1952 bis 1988 Anke Hagedorn Deutsch-deutsche Konkurrenz? Die Deutsche Welle und der DDR-Auslandssender Radio Berlin International Laurens Form Aus dem „Wunderland des Sports“ DDR-Sportberichterstattung im ZDF von 1963 bis 1992 Alina Laura Tiews Egon Günther als Grenzgänger Deutsch-deutsche medienhistorische Verlechtungen Studienkreis-Informationen (mit Call for Papers Jahrestagung des Studienkreises 2015)/ Forum / Dissertationsvorhaben / Rezensionen Zeitschrift des Studienkreises Rundfunk und Geschichte e.V. IMPRESSUM Rundfunk und Geschichte ISSN 0175-4351 Selbstverlag des Herausgebers erscheint zweimal jährlich Zitierweise: RuG - ISSN 0175-4351 Herausgeber Studienkreis Rundfunk und Geschichte e.V. / www.rundfunkundgeschichte.de Beratende Beiratsmitglieder: Dr. Alexander Badenoch, Utrecht Dr. Christoph Classen, ZZF Potsdam Prof. Dr. Michael Crone, Frankfurt/M. Redaktion dieser Ausgabe Dr. Margarete Keilacker, verantwortl. (E-Mail: [email protected]) Melanie Fritscher (E-Mail: [email protected]) Dr. Judith Kretzschmar (E-Mail: [email protected]) Martin Stallmann (E-Mail: [email protected]) Alina Laura Tiews (E-Mail: [email protected]) Layout und Endredaktion Frank und Margarete Keilacker Druck und Vertrieb Deutscher Philatelie Service GmbH, Wermsdorf Redaktionsanschrift Dr. Margarete Keilacker, Brunnenweg 3, 04779 Wermsdorf/OT Mahlis Tel.: 034364/889858, E-Mail: [email protected] Änderungen bei Adressen bzw.