Oldenburger Beiträge Zur DDR- Und DEFA-Forschung
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

WEGE NACH BAUTZEN II We G E Nac H Bautz N Ii
Lebenszeugnisse – Leidenswege n ii E bautz H WEgE nac E g nacH bautzEn ii WE biographische und autobiographische Porträts Eingeleitet von Silke Klewin und Kirsten Wenzel STIFTUNG ISBN 978-3-9805527-7-6 SÄCHSISCHE GEDENKSTÄTTEN zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft 8 Heft LL8-Umschlag_042013.indd 1 06.05.13 10:00 Lebenszeugnisse – Leidenswege Heft 8 WEGE NACH BAUTZEN II Biographische und autobiographische Porträts Eingeleitet von Silke Klewin und Kirsten Wenzel Dresden 2013 Lebenszeugnisse – Leidenswege Eine Heftreihe herausgegeben von Klaus-Dieter Müller, Siegfried Reiprich und Clemens Vollnhals im Auftrag der Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft in Zusammenarbeit mit dem Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e.V. an der TU Dresden Heft 8 © Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft (1998) 4. korrigierte Auflage 2013 Titelfoto: Hossein Yazdi bei seiner Einlieferung nach Bautzen II, 1962 Satz: Walter Heidenreich, HAIT Dresden Umschlaggestaltung: CCP Kummer & Co. GmbH, Dresden Druck: Stoba-Druck GmbH, Lampertswalde Printed in Germany ISBN 978-3-9805527-7-6 In halts ver zeich nis Ein lei tung 7 Bio graphi sche und au to bio gra phi sche Por träts 15 Karl Wil helm Fri cke Mei ne We ge nach Baut zen II 17 Gus tav Just Der Re form kom mu nist 31 Man fred Wil ke Heinz Brandt – in Selbst zeug nis sen 45 Hoss ein Yaz di Als Ira ner in Baut zen II 61 Rein hard Borg mann Die vier Le ben der Eri ka Lo ken vitz 77 Jan-Hen rik Pe ters Adolf-Hen ning Frucht: Wis sen- schaft ler und Ama teur spi on 91 Mat thi as Bath Die Flucht hel fer Rai ner Schu bert und Hart mut Rich ter 105 Kirs ten Wen zel Char lot te Rauf ei sen: Haus frau und Mut ter 121 Sil ke Kle win/Cor ne lia Lie bold Bo do Streh low – Der ab trün ni ge Maat der Volks ma ri ne 131 An hang 145 Sil ke Kle win/Kirs ten Wen zel Ein lei tung I. -

Television and the Cold War in the German Democratic Republic
0/-*/&4637&: *ODPMMBCPSBUJPOXJUI6OHMVFJU XFIBWFTFUVQBTVSWFZ POMZUFORVFTUJPOT UP MFBSONPSFBCPVUIPXPQFOBDDFTTFCPPLTBSFEJTDPWFSFEBOEVTFE 8FSFBMMZWBMVFZPVSQBSUJDJQBUJPOQMFBTFUBLFQBSU $-*$,)&3& "OFMFDUSPOJDWFSTJPOPGUIJTCPPLJTGSFFMZBWBJMBCMF UIBOLTUP UIFTVQQPSUPGMJCSBSJFTXPSLJOHXJUI,OPXMFEHF6OMBUDIFE ,6JTBDPMMBCPSBUJWFJOJUJBUJWFEFTJHOFEUPNBLFIJHIRVBMJUZ CPPLT0QFO"DDFTTGPSUIFQVCMJDHPPE Revised Pages Envisioning Socialism Revised Pages Revised Pages Envisioning Socialism Television and the Cold War in the German Democratic Republic Heather L. Gumbert The University of Michigan Press Ann Arbor Revised Pages Copyright © by Heather L. Gumbert 2014 All rights reserved This book may not be reproduced, in whole or in part, including illustrations, in any form (be- yond that copying permitted by Sections 107 and 108 of the U.S. Copyright Law and except by reviewers for the public press), without written permission from the publisher. Published in the United States of America by The University of Michigan Press Manufactured in the United States of America c Printed on acid- free paper 2017 2016 2015 2014 5 4 3 2 A CIP catalog record for this book is available from the British Library. ISBN 978– 0- 472– 11919– 6 (cloth : alk. paper) ISBN 978– 0- 472– 12002– 4 (e- book) Revised Pages For my parents Revised Pages Revised Pages Contents Acknowledgments ix Abbreviations xi Introduction 1 1 Cold War Signals: Television Technology in the GDR 14 2 Inventing Television Programming in the GDR 36 3 The Revolution Wasn’t Televised: Political Discipline Confronts Live Television in 1956 60 4 Mediating the Berlin Wall: Television in August 1961 81 5 Coercion and Consent in Television Broadcasting: The Consequences of August 1961 105 6 Reaching Consensus on Television 135 Conclusion 158 Notes 165 Bibliography 217 Index 231 Revised Pages Revised Pages Acknowledgments This work is the product of more years than I would like to admit. -
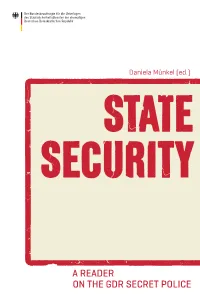
Bstu / State Security. a Reader on the GDR
Daniela Münkel (ed.) STATE SECURITY A READER ON THE GDR SECRET POLICE Daniela Münkel (ed.) STATE SECURITY A READER ON THE GDR SECRET POLICE Imprint Federal Commissioner for the Records of the State Security Service of the former German Democratic Republic Department of Education and Research 10106 Berlin [email protected] Photo editing: Heike Brusendorf, Roger Engelmann, Bernd Florath, Daniela Münkel, Christin Schwarz Layout: Pralle Sonne Originally published under title: Daniela Münkel (Hg.): Staatssicherheit. Ein Lesebuch zur DDR-Geheimpolizei. Berlin 2015 Translation: Miriamne Fields, Berlin A READER The opinions expressed in this publication reflect solely the views of the authors. Print and media use are permitted ON THE GDR SECRET POLICE only when the author and source are named and copyright law is respected. token fee: 5 euro 2nd edition, Berlin 2018 ISBN 978-3-946572-43-5 6 STATE SECURITY. A READER ON THE GDR SECRET POLICE CONTENTS 7 Contents 8 Roland Jahn 104 Arno Polzin Preface Postal Inspection, Telephone Surveillance and Signal Intelligence 10 Helge Heidemeyer The Ministry for State Security and its Relationship 113 Roger Engelmann to the SED The State Security and Criminal Justice 20 Daniela Münkel 122 Tobias Wunschik The Ministers for State Security Prisons in the GDR 29 Jens Gieseke 130 Daniela Münkel What did it Mean to be a Chekist? The State Security and the Border 40 Bernd Florath 139 Georg Herbstritt, Elke Stadelmann-Wenz The Unofficial Collaborators Work in the West 52 Christian Halbrock 152 Roger Engelmann -

1 Karl Wilhelm Fricke: Widerstand Und Opposition Von 1945 Bis Ende Der Fünfziger Jahre Quelle: Deutscher Bundestag (Hrsg.): Ma
Karl Wilhelm Fricke: Widerstand und Opposition von 1945 bis Ende der fünfziger Jahre Quelle: Deutscher Bundestag (Hrsg.): Materialien der Enquete-Kommission. „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“ (12. Wahlperiode des Deutschen Bundestages), Bd. VII, Teil 1, S. 15-26. Auf eigene Definitionsversuche von Opposion und Dissidenz, Resistenz und Widerstand möchte ich hier verzichten. Sie blieben nach meiner Auffassung ohnehin fragwürdig, weil sich Geschichte, auch die Geschichte von Opposition und Widerstand in der DDR, als dialektischer Prozeß vollzieht und daher letztlich kaum definieren oder gar in das Prokrustesbett einer Theorie zwingen läßt. Der Berliner Historiker Peter Steinbach hat im Blick auf den Widerstand unter dem Hakenkreuz-Regime einmal geschrieben, daß „nicht primär eine historisch gesättigte Theorie des Widerstands anzustreben“ sei, „sondern eine möglichst farbige, inhaltlich und historisch differenzierte Gesamtgeschichte des Widerstands.“ Eine solche Gesamtgeschichte wäre ein wichtiger Beitrag der Historiker zu einer Theoriebildung oder, zumindest, zu einer Begriffsbestimmung von Opposition und Widerstand auch unter dem Regime der SED. Welche historischen Sachverhalte und Verhaltensweisen aus der Nachkriegszeit in der Sowjetischen Besatzungszone und aus den fünfziger Jahren in der DDR in eine solche Gesamtgeschichte einzubeziehen wären – eben dies will ich in der nächsten halben Stunde kurz aufzuzeigen versuchen als Einleitung zu einer hoffentlich lebhaften Diskussion mit den Zeitzeugen. Der -

The East German Secret Service Structure and Operational Focus by J.A
Fall 1987 The East German Secret Service Structure and Operational Focus by J.A. Emerson Vermaat INTRODUCTION The East German secret service, more than any other Eastern bloc service, exercises the bulk of its activities in the Federal Republic of Ger many (FRG). Until 1945 the two Germanies shared a common past and culture and Germans in East and West still speak the same language. Consequently, it is much easier for East German agents to penetrate West German society and recruit West German citizens than it is for the Soviet KGB. Of the roughly 4000 Communist spies in West Germany, some 2500-3000 originate in East Germany. ' Most of the East German espionage is conducted by the Ministry of State Security (MfS) at the Normannenstrasse in East Berlin. Military in telligence operations are chiefly conducted by the Ministry of National Defence (MfNV). Founded in February 1950 — five months after the creation of the German Democratic Republic (GDR) — the Ministry's main purpose was to contribute to consolidating the new Communist regime imposed on the population in the Soviet controlled zone of Ger many. About 80% of the Ministry's activities continue to be focussed on internal control and repression and only 20% of its work is devoted to external espionage.2 As an organ of the GDR Ministerial Council the MfS is to protect "the socialist order of state and society against hostile attacks on the sovereignty and territorial of the GDR, the socialist achievements and the peaceful life of the people."3 The Soviets had a strong hand in the creation of the East German state security apparatus. -

The German Question
Part II The German Question Gorbachev and the GDR 145 Chapter 7 Gorbachev and the GDR Daniel S. Hamilton The German Democratic Republic (GDR) was the illegitimate off- spring of the Cold War, in the words of one writer, the “state that can- not be.”1 Even after forty years of separate existence, the GDR never became a nation; it was never seen as a 1egitimate state by its own people, by West Germans or even by its own superpower patron, the Soviet Union.2 The illegitimate nature of the East German regime proved to be an incurable birth defect. It was also a characteristic that distinguished East Germany from its socialist neighbors. Unlike Polish, Hungarian or Czechoslovak rulers, the GDR regime could not fall back on distinct national traditions or a sense of historical continuity binding its citi- zens to its leaders. The Finnish diplomat Max Jacobson captured the essence of the GDR’s precarious position: The GDR is fundamentally different from all other Warsaw Pact members. It is not a nation, but a state built on an ideological con- cept. Poland will remain Poland, and Hungary will always be Hun- gary, whatever their social system. But for East Germany, main- taining its socialist system is the reason for its existence.3 As J.F. Brown put it, “history has been full of nations seeking state- hood, but the GDR was a state searching for nationhood.”4 This lack of legitimacy afflicted the regime during the entire 40-year existence of the East German state. Without legitimacy, the regime could never consolidate its internal authority or its external stability. -

Legitimation, Repression and Co-Optation in the German Democratic Republic Udo Grashoff
Legitimation, Repression and Co-optation in the German Democratic Republic Udo Grashoff I. Legitimation and Legitimacy of the SED Rule The German Democratic Republic (GDR) was created by the Soviet power. Therefore, all efforts to gain acceptance of its own people should be considered as actions to compensate for its general intrinsic lack of legitimacy as a nation state.1 Moreover, the idea of nationalism in East Germany took on a subversive meaning because of the division of Germany. The Federal Republic of Germany (FRG) claimed to represent all Germans, which made the political leadership of the “Sozialistische Einheitspartei Deutschlands” (SED, “Socialist Unity Party of Germany”) seem questionable. The communist Party could only partly rely on national values and was forced to establish substitutes. Furthermore, the permanent rivalry between the two German states and the fact that communists were a minority within the East German society put strong pressure on the SED to legitimize its dictatorship. 1. Normative Justification of the Rule: Communism as the Ultimate Aim Throughout 1945/46 to 1990, the SED used Marxist-Leninist ideology as the basic justification for its claim to power in all stages of its rule. At the core of this oversimplified historical materialism lay the belief that the communists not only knew the law of historical development but were also able to control social progress. Hence, the constitutionally stated leading role of the SED was legitimized by the idea that the party should act as the executor of the historical law that would lead towards a classless society. This idea allows the designation of the GDR as an ideocracy. -

Die Akten Der Wahrheit
Edda Ahrberg/Roger Engelmann/ Karl Wilhelm Fricke/Joachim Gauck/ Vera Lengsfeld/Peter Sense Die Akten und die Wahrheit Aktuelle Fragen der Politik Heft 49 Herausgegeben von der Konrad-Adenauer-Stiftung Redaktion dieses Heftes: Felix Becker Mit dem 1992 verabschiedeten Gesetz über die Stasi-Unterlagen und der Errichtung der Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (BStU) wurde die offizielle Grundlage zur Aufarbeitung der SED-Vergangenheit geschaffen. Die praktische Umsetzung und Erfahrungen, der Stand der wissenschaftlichen Aufarbeitung und die Aufnahme der Ergebnisse in der Öffentlichkeit bedürfen stetiger Bilanzierung. Vorliegendes Heft enthält Vorträge einer in Zusammenarbeit mit dem BStU veranstalteten Fachkonferenz der Konrad-Adenauer-Stiftung über ”Die Akten und Wahrheit”. Die Autoren: Edda Ahrberg, Landesbeauftragte in Sachsen-Anhalt für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR Dr. Roger Engelmann, Wiss. Mitarbeiter in der Abteilung Bildung und Forschung beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR Dr. h.c. Karl Wilhelm Fricke, ehem. Leiter der Ost-West-Abteilung des Deutschlandfunks, Mitglied der beiden Enquete-Kommissionen des Deutschen Bundestages zur Aufarbeitung der SED-Diktatur Joachim Gauck, Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR Vera Lengsfeld, Bürgerrechtlerin, 1988 in der DDR verhaftet, verurteilt und abgeschoben, seit 1990 MdB (B.90/Grüne, 1996 CDU) Peter Sense, Landesbeauftragter in Mecklenburg-Vorpommern für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR Die Reihe kann bezogen werden von der Konrad-Adenauer-Stiftung Referat für Publikationen Postfach 1420 D-53732 Sankt Augustin Telefon 0 22 41/246-264 Telefax 0 22 41/246-294 E-Mail: [email protected] Die Hefte der Reihe ”Aktuelle Fragen der Politik” können auch im Internet unter der Adresse http://www.kas.de abgerufen werden. -

The Stasi at Home and Abroad the Stasi at Home and Abroad Domestic Order and Foreign Intelligence
Bulletin of the GHI | Supplement 9 the GHI | Supplement of Bulletin Bulletin of the German Historical Institute Supplement 9 (2014) The Stasi at Home and Abroad Stasi The The Stasi at Home and Abroad Domestic Order and Foreign Intelligence Edited by Uwe Spiekermann 1607 NEW HAMPSHIRE AVE NW WWW.GHI-DC.ORG WASHINGTON DC 20009 USA [email protected] Bulletin of the German Historical Institute Washington DC Editor: Richard F. Wetzell Supplement 9 Supplement Editor: Patricia C. Sutcliffe The Bulletin appears twice and the Supplement usually once a year; all are available free of charge and online at our website www.ghi-dc.org. To sign up for a subscription or to report an address change, please contact Ms. Susanne Fabricius at [email protected]. For general inquiries, please send an e-mail to [email protected]. German Historical Institute 1607 New Hampshire Ave NW Washington DC 20009-2562 Phone: (202) 387-3377 Fax: (202) 483-3430 Disclaimer: The views and conclusions presented in the papers published here are the authors’ own and do not necessarily represent the position of the German Historical Institute. © German Historical Institute 2014 All rights reserved ISSN 1048-9134 Cover: People storming the headquarters of the Ministry for National Security in Berlin-Lichtenfelde on January 15, 1990, to prevent any further destruction of the Stasi fi les then in progress. The poster on the wall forms an acrostic poem of the word Stasi, characterizing the activities of the organization as Schlagen (hitting), Treten (kicking), Abhören (monitoring), -

Erich Mielke's Last Gift
Erich Mielke’s Last Gift The Legacy of the Stasi in the Middle East: From the German Democratic Republic to the Islamic State Saskia Pothoven 3987868 Supervisor: Prof. Dr. B.A. de Graaf MA Research Thesis International Relations in Historical Perspective 2 | Abstract [Page intentionally left blank] Erich Mielke’s Last Gift | 3 Abstract This thesis examines to what extent the way the Islamic State operates can be traced back to the intelligence relationship between the Stasi and the Ba’ath party in Iraq during the 1970s and 1980s. As an explorative research, it aims to map potential continuities between the Stasi and the Islamic State with regard to both the organizational structure of the Islamic State’s intelligence apparatus, as well as its operational techniques. In the first chapter, the ideological role of the Stasi within the GDR is examined. In the second chapter, materials from the Stasi archives are analysed to determine the extent of the intelligence relationship between the Stasi and the Ba’ath, and to see how this relationship has influenced the intelligence apparatus of the Ba’ath. In the third chapter, the intelligence apparatus of the Islamic State and its link with the Ba’ath are explored. In order to trace such continuities, a framework of different degrees of influence has been developed, which ranges from level 1 (low) to level 4 (high). There are several similarities, in organizational structure, as well as in the extent of surveillance of citizens, and the heavy use of informants, that indicate that the intelligence apparatus of the Islamic State has been indirectly influenced by the Stasi support to the Iraqi Ba’ath party. -

AHR Forum “1968” East and West: Divided Germany As a Case Study in Transnational History
AHR Forum “1968” East and West: Divided Germany as a Case Study in Transnational History TIMOTHY S. BROWN Downloaded from https://academic.oup.com/ahr/article/114/1/69/43903 by guest on 30 September 2021 THE YOUTH REBELLIONS OF THE LATE 1960s—associated in the popular and scholarly consciousness with the year 1968—were part of a global event. They embraced, in differing forms, the capitalist West as well as the communist East, the countries of the Third World as well as those of the First and Second. The term “1968” has become a shorthand not only for a particular series of events—social unrest in lo- cations as diverse as Mexico and China, France and Japan, Czechoslovakia and the United States—but for a certain type of interconnectedness closely associated with the process of globalization shaping the contemporary world. Yet the study of “1968” poses a set of profound conceptual and practical difficulties. Alongside the basic problem of analyzing an ill-defined “event” with amorphous contours, decentralized agency, and (in most cases) little lasting institutional signature, there is the question of how exactly its “globality” is to be studied. However global in scope and orien- tation, “1968” was played out in and around specific national contexts, and it is to these that we must look to understand the larger, world event. Yet the nation-state cannot function as our primary frame of reference, not only because of the impor- tance of transnational influences in shaping local events, but because of how inti- mately “1968” was linked to the creation of globalizing imagined communities that cut across national boundaries.1 Work on “1968” has increasingly emphasized comparative perspectives and the investigation of transnational linkages; yet it has also exhibited a tendency to take the “global” somewhat for granted. -

East Germany: the Stasi and De-Stasification
East Germany: The Stasi and De-Stasification JOHN O. KOEHLER hortly after Mikhail Gorbachev was installed as secretary general of the Sovi- Set Union’s Communist Party in the spring of 1985, he began to pursue his liberalization policies of glasnost and perestroika. The impact was felt almost immediately within the ruling Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED), the Communist Party of the East German Deutsche Demokratische Republik (DDR). Gorbachev’s policies gave new hope for political, economic, and social renewal to those disenchanted with the gerontological Stalinist leadership of Erich Honecker and his sycophants.1 A new wind was blowing from the East, generated by the “great teacher”—the Soviet Union. In line with the USSR’s change of course, both Moscow’s German- language propaganda magazine, Sputnik, and its weekly newspaper, Neue Zeit, reprinted Gorbachev’s speeches and editorialized on the necessity for reforms of the socialist system. For East Germany’s leaders, however, they became hostile publications and were banned despite protests emanating from Moscow. Nonethe- less, they presaged a major change: For the first time since the founding of the DDR in 1949, the restlessness of Party members and much of the citizenry could not be blamed on the capitalist enemy of the proletariat. Until the mid-1980s, opposition to the regime was largely underground, although hundreds of thousands of burghers spent time in penitentiaries for pub- licly voicing their discontent. The repression began immediately after the end of World War II, carried out by Soviet security services and German Communist Party veterans (both those who had been in exile in the Soviet Union and those that had survived Nazi imprisonment).