Discussion Papers ISSN 1862-8079
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
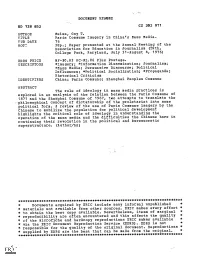
Paris Commune Imagery in China's Mass Media
DOCUMENT RESUME ED 128 852 CS 202 971 AUTHOR Meiss, Guy T. TITLE Paris Commune Imagery in China's mass Media. PUB DATE 76 NOT: 38p.; Paper presented at the Annual Meeting of the Association for Education in Journalism (59th, College Park, Maryland, July 31-August 4, 1976) EDRS PRICE MF-$0.83 HC-$2.06 Plus Postage. DESCRIPTORS *Imagery; *Information Dissemination; Journalism; *Mass Media; Persuasive Discourse; Political Influences; *Political Socialization; *Propaganda; Rhetorical Criticism IDENTIFIERS China; Paris Commune; Shanghai Peoples Commune ABSTRACT The role of ideology in mass media practices is explored in an analysis of the relation between theParis Commune of 1871 and the Shanghai Commune of 1967, two attempts totranslate the -philosophical concept of dictatorship of the proletariatinto some political form. A review of the use of Paris Commune imagery bythe Chinese to mobilize the population for politicaldevelopment highlights the critical role of ideology in understanding the operation of the mass media and the difficulties theChinese have in continuing their revolution in the political andbureaucratic superstructure. (Author/AA) *********************************************************************** Documents acquired by ERIC include manyinformal unpublished * materials not available from other sources.ERIC makes every effort * * to obtain the best copy available.Nevertheless, items of marginal * * reproducibility are often encounteredand this affects the quality * * of the microfiche and hardcopyreproductions ERIC makes -

Chapter 1 the Meaning of Detente
Notes CHAPTER 1 THE MEANING OF DETENTE I. Arthur M. Schlesinger,Jr., 'Detente: an American Perspective', in Detente in Historical Perspective, edited by G. Schwab and H. Friedlander (NY: Ciro Press, 1975) p. 125. From Hamlet, Act III, Scene 2. 2. Gustav Pollak Lecture at Harvard, 14 April 1976; reprinted in James Schlesinger, 'The Evolution of American Policy Towards the Soviet Union', International Security; Summer 1976, vol. I, no. I, pp. 46-7 . 3. Theodore Draper, 'Appeasement and Detente', Commentary, Feb . 1976, vol. 61, no. 8, p. 32. 4. Coral Bell, in her book, TheDiplomacy ofDitente (London: Martin Robertson, 1977), has written an extensive analysis of the triangular relationship but points out that, as of yet, no third side to the triangle - the detente between China and the USSR - exists, p. 5. 5. Seyom Brown, 'A Cooling-Off Period for U.S.-Soviet Relations', Foreign Policy , Fall 1977, no. 28, p. 12. See also 1. Aleksandrov, 'Peking: a Course Aimed at Disrupting International Detente Under Cover of Anti Sovietism', Pravda , 14 May 1977- translated in Current DigestofSovietPress . Hereafter, only the Soviet publication will be named. 6. Vladimir Petrov , U.S.-Soviet Detente: Past and Future (Wash ington D.C .: American Enterprise Institute for Publi c Policy Research, 1975) p. 2. 7. N. Kapcheko, 'Socialist Foreign Policy and the Reconstruction of Inter national Relations', International Affairs (Moscow), no. 4, Apr . 1975, p. 8. 8. L. Brezhnev, Report ofthe Tioenty-Fiftn Congress ofthe Communist Parry ofthe Soviet Union, 24 Feb. 1976. 9. Marshall Shulman, 'Toward a Western Philosophy of Coexistence',Foreign Affairs, vol. -

Neuerwerbungsliste Der Bibliothek Im Evangelischen Zentrum
Neuerwerbungsliste der Bibliothek im Evangelischen Zentrum Zeitraum: Oktober 2016 1 3173 (Buch) 125 Jahre Elisabeth-Diakonissen und Krankenhaus in Berlin 1837-1962 : Festschrift / Walter Augustat [Hrsg.]. - Berlin, 1962. - 124 Seiten Schlagwörter: Elisabeth-Diakonissen- und Krankenhaus IV 13b/487 (Buch) Jahrbuch für Kindertheologie. - Stuttgart : Calwer Verl. - ; 24 cm Theologisieren mit Kindern und Jugendlichen Ersch. unregelmäßig Nebentitel : Theologisieren mit Kindern und Jugendlichen Sach-Schlagwort: Religionspädagogik; Kindertheologie IV 13b/487,15 (Buch) 15. "Da muss ich dann auch alles machen, was er sagt" : Kindertheologie im Unterricht. - 2016. - A M2 11.13, 9 (Buch) Giese, Gerhardt: Die Kirche in der Berliner Schule : ein Arbeitsbericht über den Aufbau des Religionsunterrichts im Auftrag der Kirche seit 1945 / Gerhardt Giese. Mit drei schulpolitischen Denkschriften von Hans Lokies. - Berlin : Lettner-Verlag, 1955. - 163 Seiten Schlagwörter: Berlin / Religionsunterricht M2 11.224, 2 (Buch) Dzubba, Horst: Briefe und Auslegungen von Horst Dzubba aus dem Nachlass / Horst Dzubba; Karl-Johann Rese [Hrsg.]. - [als Ms. gedr.] Rotenburg : Selbstverlag, 1982. - 68 Seiten : Illustrationen Schlagwörter: Bibelauslegung M2 A/555 (Buch) Wagner, Herwig: Erstgestalten einer einheimischen Theologie in Südindien : ein Kapitel indischer Theologiegeschichte als kritischer Beitrag zur Definition von "einheimischer Theologie" / Herwig Wagner. - München : Kaiser, 1963. - 306 Seiten (Mission und Ökumene) Schlagwörter: Indien / Theologie, christliche ; Indien / Kirche / Mission M2 A/566 (Buch) Wolff, Otto: Mahatma und Christus : eine Charakterstudie Mahatma Gandhis und des modernen Hinduismus / von Otto Wolff. - 1. Auflage Berlin : Lettner-Verlag, 1955. - 275 Seiten Sach-Schlagwort: Hindiusmus ; Ghandi ; Christentum ; Christus M2 A/580 (Buch) Faulwetter, Helmut: Indien Bilanz und Perspektive : Bilanz und Perspektive einer kapitalistischen 2 Entwicklung. Innere und äußere Bedingungen der ökonomischen Reproduktion / Helmut Faulwetter, Peter Stier. -

By KLAUS MEHNERT the Beautiful Hawaiian Word "'Aloha
.. By KLAUS MEHNERT Va mall. k6 fla 0 ka aina i ka pono. (The life of the la~ is preserved by righteousness.) Motto of Hawaii. The beautiful Hawaiian word like this. If, for instance, a person "'Aloha" cannot be translated. It says, "1 am now leaving Germany," means love, friendship, sympathy, it really does not mean very much. He farewell, and much more. The follow is perhaps looking at a railway station ing lines are an Aloha in two ways. on the Belgian border, or at the banks They are a friendly farewell to the hos of the lower Elbe, or possibly at the pitable islands on which I lived for mountains of the Brenner Pass, and four years, and they are also a good each time he sees only an infinitesimal bye to old Hawaii, which toward the fragment of Germany. Germany itself dosure of my sta:Jh-,was undergoing a is much more, ( ...;k nOPQdy has ever rapid transformation. and which, if seen i~ a whole. But here the entire this development shou.ld continue, will island 11e; before me. From the light disappear. never to return. house on Barber's Point to the crater Hawaii's transformation from a of Koko Head I can see every ridge of south sea paradise to a naval and the two parallel volcanic mountain military fortress of first magnitude ranges and the broad valley lying be 'seems inevitable. The time may soon tween them, filled with sugar cane and come. when people, who no'tl':rassociate pineapple fields. In the fiery sunset the name of Hawaii with rt·1Jt~·girls the mountains and valleys are indescrib and palm trees in the moonlignt, will ably green and seem very near as the link the islands with nothing but coast deep shadows accentuate every line. -

Vol 24 Issue 5
11 AIR rcvicwU N I VERSI TY THE PROFESSIONAl JOURNAL Of THE UNITED STATES AIR FORCE U.S. M il it a r y Stratecy: P aradoxes in Per spect ive...................................................................... 2 Maj. Edd D. Wheeler, US.AF Mish a p Analysis: An Impr o ved Appr o a c h to Air c r a f t Accident Prevention . 13 Col. David L. Nichols, US.AF T he Many Faces of the Spa c e Shuttle........................................................................................23 Williani G. Holder T he Lea d-Time Problem: T heory .and Appl ic a t io n s ................................................................ 36 Lt. Kenneth C. Stoehrmann, US.AF Lvtel l igence and Information Pr o c essin g in Co un t er insur c en c y................................... 46 Dr. Charles A. Russell Maj. Robert E. Hildner, US.AF T he Middle East, 1973: C old W.ar Chances and Amer ic a n Interests........................ 57 Capt. Bard E. O Neill, US.AF Air Force Review Modern Communications, a Wise Investment......................................................................... 63 Maj. Gen. Paul R. Stonev, US.AF ln My Opinion O rcaniz.atio.nal Devel o pmen t : C an It Be Effective in the Armed Forces? ... 68 Lt. Col. Peter E. LaSota, US.AF Capt. Robert A. Zawacki, USAF Syst ema t ic Reso l ut ion of Social Problems within the Mil it .ary............................. 73 Capt. Jon M. Samuels, US.AF Books and Ideas A chtunc! Fuecer th vppex! ...................................................................................................................80 Dr. Alfred Goldberg A C o mmun t t y within “A Nation of Strangers" .......................................................................89 Col. Andrew J. Dougherty, US.AF Marjorie M. -

Das War 2012 ZEITUNG SONDER 31.12.2012 2 28.12.12 08:48:16
ZEITUNG SONDER 31.12.2012 1 28.12.12 08:47:28 Das war 2012 ZEITUNG SONDER 31.12.2012 2 28.12.12 08:48:16 Seite 2 POLITIK/WELTGESCHEHEN Traunsteiner Tagblatt Januar 1.: Guimarães im Norden Por- tugals und Maribor in Slowe- nien sind die Kulturhauptstädte Europas 2012. Maribor ist die erste Kulturhauptstadt im frü- heren Jugoslawien. Sie steht für fünf weitere Partnerstädte in Ostslowenien. 3.: Mit der dritten Runde der Parlamentswahl in Ägypten si- chern sich die islamistischen Parteien mehr als 70 Prozent der 498 Mandate. Allein die Mus- limbrüder erzielen 47,2 Prozent. Auf den zweiten Platz kommt die radikal-islamische Partei des Lichts (»Hizb al-Nur«). 6.: Im Universitätsklinikum Leipzig werden eineiige Vierlin- ge geboren. Die Wahrscheinlich- Das Kreuzfahrtschiff »Costa Concordia« kentert mit 4232 Menschen an Bord vor der toskanischen Insel Giglio. keit, eineiige Vierlinge zu be- 32 Menschen kommen bei der Havarie ums Leben, darunter 12 Deutsche. Der Prozess gegen den beschuldigten kommen, liegt den Ärzten zufol- Kapitän Francesco Schettino soll 2013 beginnen. ge bei 1 zu 13 Millionen. 6.: Die saarländische CDU- schuldigten Kapitän Francesco mistengruppe Boko Haram in cherheitskräfte. Die letzten Ministerpräsidentin Annegret Schettino soll 2013 beginnen. der nigerianischen Stadt Kano deutschen Soldaten verlassen Kramp-Karrenbauer kündigt 17.: »Döner-Morde« als Be- bei Anschlägen etwa 185 Men- Feisabad Anfang Oktober. überraschend die Jamaika-Ko- schen. Im Juni gibt es bei Atten- zeichnung für eine rechtsterro- 24. Der Energieriese Eon ei- alition aus CDU, FDP und Grü- taten auf zwei Kirchen und Ver- ristische Mordserie an neun nigt sich mit den Gewerkschaf- nen auf. -
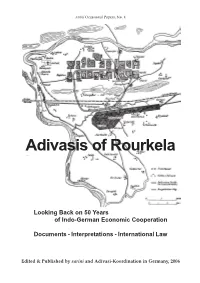
Adivasis of Rourkela
sarini Occasional Papers, No. 4 sarini Occasional Papers, No. 4 Adivasis of Rourkela Adivasis of Rourkela Looking Back on 50 Years of Indo-German Economic Cooperation Documents - Interpretations - International Law Edited & Published by sarini and Adivasi-Koordination in Germany, 2006 - 1 - sarini Occasional Papers, No. 4 Adivasis of Rourkela Adivasis of Rourkela Looking Back on 50 Years of Indo-German Economic Cooperation Documents - Interpretations - International Law Edited and published by sarini and Adivasi-Koordination in Germany Printed by CEDEC, Bhubaneswar 2006. (sarini Occasional Papers, No. 4) sarini Occasional Papers hold NO COPYRIGHT. Adivasi-Koordination in Germany Widest possible dissemination of these informa- Secretariat: Dr. Theodor Rathgeber tions is intended. Jugendheimstr. 10 Further ideas about the functioning and inten- D-34132 Kassel, Germany tions of this network - and about the work of Phone ++49-561-47597800 Adivasi-Koordination can be found on the back Fax ++49-561-47597801 cover. email [email protected] A version will also be available on the Internet. www.Adivasi-Koordination.de This sarini publication is distributed from: sarini c/o Johannes Laping Sahayog Pustak Kuteer (Trust) Christophstr. 31 11-A, Nangli Rajapur D-69214 Eppelheim, Germany Nizamuddin east Phone ++49-6221-766557 New Delhi 110 013, India Fax ++49-6221-766559 Phone ++91-11-24353997 email [email protected] email [email protected] B.I.R.S.A. Mines Monitoring Centre Earlier publications of sarini: B6 Abilasha Apartments, 11 A Purulia Road Jai Adibasi - A political reader on the life and Ranchi 834001, Jharkhand, India struggles of indigenous peoples in India Phone ++91-651 2531874 150 p., 1994. -

Research Annual on Intergroup Relations- -1966
DOCUMENT RESUME ED 024 702 UD 006 449 By- Tumin, Melvin M., Ed.; Greenblat, Cathy S., Ed. Research Annualon Intergroup Relations- -1966; A ResearchStudy of the Anti-Defamation League of B'nai B'rith. B'nai B'rith, New York, N.Y. Anti-Defamation League. Pub Date 67 Note- 344p. Available from-Frederick A.Praeger. Inc., 111 Fourth Avenue, New York, N.Y. 10003 ($2.95). EDRS Price MF-$1.50 HC-$17.30 Descriptors- Action Research, *AnnotatedBibliographies, Attitudes, Civil Rights, Crime, Culturally Disadvantaged. Delinquency. Educational Opportunities, *Ethnic Groups, *Intergroup Relations, International Education, *Research Reviews (Publications), Social Characteristics, Social Integration Identifiers-Right Wing Groups The emphasis in this annotated bibliogra_phy of research reports is on relations among ethnic, racial, and religious groups.The research is in different stages of completion (contemplated, ongoing, or completed). The reports vary in amplitude and detail,including research inforeign countries.Also, the reports are organized according to their major concern: attitudes;the characteristics; structure; and position of the various groups; patterns of discrimination, segr*gation, desegregation, and integrzition; civilrights; education for the culturally disadvantaged; crime and delinquency; the Radical Right; action programs; and international education. Student studies and summary papers are also listed. Whenever possible, an author's own summary serves as the annotation, and hisaddress accompanies the citation of his report. (EF) U.S. DEPARTMENT OF HEALTH, EDUCATION & WELFARE OFFICE OF EDUCATION THIS DOCUMENT HAS BEEN REPRODUCED EXACTLY AS RECEIVED FROM THE PERSON OR ORGANIZATION ORIGINATING IT.POINTS OF VIEW OR OPINIONS STATED DO NOT NECESSARILY REPRESENT OFFICIAL OFFICE OF EDUCATION posITION OR POLICY. -
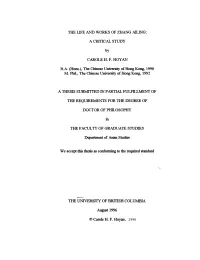
The Life and Works of Zhang Ailing
THE LIFE AND WORKS OF ZHANG AILING: A CRITICAL STUDY by CAROLE H. F. HOYAN B. A. (Hons.), The Chinese University of Hong Kong, 1990 M. Phil., The Chinese University of Hong Kong, 1992 A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FUIJFJ1LMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY in THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES Department of Asian Studies We accept this thesis as conforming to the required standard THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA August 1996 © Carole H. F. Hoyan, 1996 In presenting this thesis in partial fulfilment of the requirements for an advanced degree at the University . of British Columbia, I agree that the Library shall make it freely available for reference and study. I further agree that permission .for extensive copying of this thesis for scholarly purposes may be granted by the head of my department or by his or her representatives. It is understood that copying or publication of this thesis for financial gain shall not be allowed without my written permission. Department of _/<- 'a. The University of British Columbia Vancouver, Canada Date 3» /\/,rv. (f<lA Abstract This dissertation is a study of Zhang Ailing's life and works and aims to provide a comprehensive overview of her literary career. Zhang Ailing (Eileen Chang %. jf; 5£% 1920-1995) is a significant figure in modern Chinese literary history, not only because of her outstanding artistry and modernist vision, but also because of her diverse contributions to the course of Chinese literature. The study follows the conventional chronological order of her life and is divided into eight chapters, together with an introduction and a conclusion. -

Curriculum Vitae Sören Urbansky
Curriculum vitae Sören Urbansky Education and Degrees 18/2/2014 Dr. phil. in History, University of Konstanz (summa cum laude) Title of dissertation: “Beyond the Steppe Hill: The Making of the Sino- Russian border” Academic advisors: Jürgen Osterhammel and Karl Schlögel 20/10/2006 Diploma in History and Cultural Studies, European University Viadrina Frankfurt/Oder (1,1) 01/7/2000 Abitur, Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel (1,7) Visiting studies at Tsinghua University Beijing (9/2006–7/2007); University of California, Berkeley (8/2005–5/2006); Heilongjiang University Harbin (9/2004–6/2005); Kazan’ State University (2/2003– 7/2003) Employment 1/2021–present Head of Office and Research Fellow in Global and Transnational History, Pacific Regional Office of the German Historical Institute Washington at the University of California, Berkeley 1/2018–12/2020 Research Fellow in Global and Transnational History, German Historical Institute Washington, DC 10/2016–12/2017 Postdoctoral Fellow, Department of Social Anthropology, University of Cambridge, Darwin College Postdoctoral Research Affiliate (10/2016– 12/2016 on paternity leave) 4/2014–12/2017 Senior Lecturer (Akademischer Rat auf Zeit) of Russian and Asian Studies at the Ludwig Maximilian University of Munich 10/2009–3/2014 Lecturer (Wissenschaftlicher Mitarbeiter) of East Asian History at the University of Freiburg (11/2013–1/2014 on paternity leave) Visiting appointments and Membership in research groups 1/2021–present Visiting Professor, History Department, Central European University, Vienna -

Philosophische Fakultät Forschungsbericht 2009-2010
Philosophische Fakultät Forschungsbericht 2009-2010 Vorwort Der Forschungsbericht der Philosophischen Fakultät bietet für die Jahre 2009 und 2010 eine umfassende Darstellung aller forschungsbezogenen Aktivitäten der Lehrbereiche wie: ‣ Forschungsschwerpunkte ‣ Forschungsprojekte ‣ Nachwuchsförderung (laufende Promotionen und Habilitationen) ‣ Publikationen ‣ Vorträge, Tagungsorganisationen u.ä. ‣ Herausgeber- und Gutachtertätigkeiten ‣ Vermittlung von Forschungsergebnissen an eine breitere Öffentlichkeit Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben sind die Beiträger verantwortlich. Die Fakultät befindet sich derzeit in einem Restrukturierungsprozeß, dessen Ziel eine hinsichtlich Forschung und Lehre sinnvolle Bündelung von Fächern ist. Die Gliederung des Berichtes in drei Fächergruppen spiegelt den derzeitigen Diskussionsstand dieses Prozesses wider. Über ausgewählte laufende Forschungsprojekte informiert die Broschüre „Forschungsprojekte 2011“ der Philosophischen Fakultät. Die Broschüre kann über das Dekanat der Fakultät bezogen oder digital abgerufen werden (www.fb7.rwth-aachen.de/forschung). Aachen, 7. April 2011 Univ.-Prof. Dr. Simone Roggenbuck Prodekanin für Forschung RWTH Aachen, Philosophische Fakultät, Forschungsbericht 2009-2010 1 Inhaltsverzeichnis Vorwort 1 Gesellschaftswissenschaften, Geschichte, Theologie, Philosophie VDI-Professur für Zukunftsforschung — Daniel Barben 6 Politische Wissenschaft — Helmut König 9 Politische Systemlehre und Comparative Politics — Emanuel Richter 12 Politische Wissenschaft: Internationale -

Short Biographies of Participants in Alphabetical Order
ZOiS Conference 2017 A New Research Agenda on Eastern Europe 28 March 2017 Short biographies of participants in alphabetical order Mark R. Beissinger is the Henry W. Putnam Professor of Politics at Princeton and Director of the Princeton Institute for International and Regional Studies (PIIRS). His recent writings have dealt with such topics as individual participation in the Orange Revolution in Ukraine and in the Egyptian and Tunisian revolutions, the impact of new social media on opposition movements in autocratic regimes, Russian imperialism in Eurasia, the historical legacies of communism, the relationship between nationalism and democracy, the impact of the Great Recession on protest in the post- communist states, and the evolving character of revolutions globally over the last century. He is the author of Nationalist Mobilization and the Collapse of the Soviet State (Cambridge University Press 2002) and the co-editor (with Stephen Kotkin) of Historical Legacies of Communism in Russia and Eastern Europe (Cambridge University Press 2014). Katharina Bluhm is Professor for Sociology and director of the Institute for East European Studies at the Freie Universität Berlin. She has held previous appointments at the University of Osnabrück and has been a visiting scholar at Harvard, Berkeley and the National Research University – Higher School of Economics in Moscow. Her research interests focus on varieties of capitalism in Central and Eastern Europe, economic and political sociology. She is the author of Modernisation, Geopolitics and the New Russian Conservatives (Leviathan 1/2016), Machtgedanken. Ideologische Schlüsselkonzepte der neuen russischen Konservativen (Mittelweg 6/2016), and co-author of Business Leaders and the New Varieties of Capitalism in Post-Communist Europe (Routledge 2014).